Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Der Verlust der Transzendenz wäre für Menschen, die man im und zum Glauben erzogen hat, niederschmetternd, wenn er plötzlich käme wie ein Saulus-Paulus-Erlebnis. Er kommt aber schleichend. Er tröpfelt. Das theatralische ‚Gott hat zugelassen, dass …‘, worauf tränenerstickt folgt ‚meine Feinde gesiegt haben‘, ‚meine Hütte abgebrannt‘, ‚meine Tochter gestorben‘ oder gar ‚geschwängert worden ist‘ oder ‚dass meine Frau mir erst jetzt gebeichtet hat, wie lesbisch ihr Verhältnis mit meiner nach Australien ausgewanderten PR-Assistentin war‘ – ‚und deshalb glaube ich nicht mehr an ihn!‘ – diese Strafaktion aufgrund einer plötzlichen Einsicht ist selten. Zugegeben: Eine schmerzhaftere Bestrafung als die, nicht an ihn zu glauben, hat man Gott gegenüber nicht in der Hand. Zwar ist das – zumindest gegenüber den noch auf Wahlen angewiesenen – Politikern nicht viel anders, bloß, dass der christliche Gott – im Gegensatz zu den politischen Göttern – seit den Kreuzzügen auf unsere Hilfe ja auch gar nicht mehr als angewiesen gilt. Damit befindet er sich außerdem im Gegensatz zum Allah des Islam, jedenfalls im Selbstverständnis seiner Gotteskrieger, die ihm helfen müssen, die Welt zu erobern – entweder, weil sie an die Segnungen seiner Botschaft glauben oder weil sie sich davon eine Aufnahme ins Paradies mit seinen – in vielen Glossen bereits breitgewalzten – 72 Jungfrauen versprechen. Ob diese im Orient übliche sexuelle Auslegung des Glücks gegenüber der im Abendland erfundenen kulinarischen Hoffnung auf gebratenes Geflügel, sobald man den Mund aufmacht, eine moralisch höher zu bewertende Vorstellung von Seligkeit ist, diese Entscheidung müssen die Religionswissenschaftler den Moraltheoretikern überlassen. Auch ich mische mich da nicht ein. Ich begnüge mich damit, ein Leben zu betrachten, in dem die Vorstellung, dass es nach unserem Erdendasein weiter bzw. erst richtig losgeht, weder Furcht noch Freude auslöst, sondern allenfalls irritierte Ungläubigkeit.
Wenn also die Idee, es gäbe keinen Gott, selten niederschmetternd ist, so ist sie doch verarmend. Oder bereichernd? Dann habe ich zwar keine Angst mehr vor der Hölle, aber auch keine Hoffnung mehr auf Erlösung. Das Seelenheil im Kloster zu suchen, scheint mir weniger sinnvoll, als im Internet nach Triebbefriedigung Ausschau zu halten. Und dann? Dass es so nicht klappt, wissen Opernliebhaber, seit Mozart Da Pontes ‚Don Giovanni‘ vertont hat. Für Menschen, die kulturell bei null anfangen müssen, dauert es etwas länger, wie meistens bei Einsichten, zu denen man sich ohne Vorkenntnisse durchkämpfen muss.
Dass Geld nicht glücklich macht, ist eine Arme-Leute-Weisheit. Dass Geben seliger denn Nehmen sei, kommt aus derselben Ecke. Es stimmt, aber es bringt nichts. Man hat es so oft gehört oder gesagt, dass es zu bedeutungslosen Wörtern verkommen ist. Floskeln. Worte, die immer noch gern benutzt werden, sind die von Hamlets Vermutung: ‚Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt.‘ Shakespeare hat damit aber wohl weder dem dänischen Prinzen noch seinem Bühnendarsteller eine Aufforderung zu Séancen oder Globuli-Verabreichungen in den Mund legen wollen. Glaskugeln und Tischerücken beschwören weder die Geister der Zukunft noch die Toten der Vergangenheit. Richtig ist: Was wir nicht verstehen, nehmen wir hin, oder wir versuchen, es zu deuten. Im Allgemeinen haben das für uns schon andere gemacht, denen wir vertrauen können. Sie haben uns Jahrtausende lang bei Sturm belehrt: ‚Die Götter zürnen!‘, und behaupten jetzt: ‚Ein Sturm entsteht, wenn sehr hohe Luftdruckunterschiede auf kurzer Distanz auftreten.‘
Was nicht erklärt werden konnte, war natürlich übernatürlich. Früher. Für die einen war das beruhigend, für die anderen furchterregend. Somit kamen die naturgegebenen, physikalischen Erklärungen des Sachverhalts für die einen als enttäuschende, für die anderen als befreiende Information. Ein Gott nach dem anderen verschwand. Nicht mehr der verärgerte Gott blitzte und donnerte: Es blitzte und es donnerte. Die Entpersonifizierung raubte der Angelegenheit ihre Größe. ‚Ich regne, du schneist‘ – das wäre durchschaubar alltäglich, wenn es stattfände. Wenn ich dagegen etwas besser weiß, ist das mit dem Glauben schwierig. Kant erkannte in seiner ‚Kritik der reinen Vernunft‘: ‚Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.‘ In der ‚Kritik der praktischen Vernunft‘ rudert er zurück: ‚Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir‘ – sie wiesen ihn hinaus und hinauf zu etwas Höherem. – Viel weiter sind wir auch bis heute nicht gekommen. Entweder da passiert nach wie vor etwas, das sich nicht durch Zauberkunststücke, sondern nur durch Walten höherer Mächte erklären lässt, oder es gibt dafür eine bloß noch nicht erforschte, wissenschaftliche Erklärung. Entweder ich habe einen Schutzengel oder ich muss mich selbst um meine Sicherheit kümmern. Entweder ist mit dem Tod alles vorbei, oder danach geht es erst richtig los. Entweder muss ich alles, was nur irgend geht, in mein Leben packen, oder ich muss mich so verhalten, dass mir das im nächsten Leben zugutekommt. Der Humanismus hat versucht, dieses Gute im Menschen hervorzuheben, das auch ohne Aussicht auf Gottes Strafe oder Belohnung die Lebenden das Richtige tun lässt. Aber die Religions- und Staatsgründer fanden es doch immer sicherer, durch Gebote und Gesetze festzulegen, wen die Leute lieben durften, was sie wann essen durften und was sie wann anzuziehen hatten, damit während der Fastenzeit kein schwules Pärchen im rosa Fummel Schweinebraten aß. Putin unterstellt, dass gerade das im dekadenten Westen ständig ungestraft passiere, und lässt sich dabei vom Moskauer Patriarchen assistieren. Wahrscheinlich glaubt Putin auch, falls er irgendetwas glaubt, der Himmel wird ihn für die Befreiung der Ukraine belohnen. Der Glaube, dass es noch eine andere Welt gäbe, hat die Menschen leider nicht ‚besser‘ gemacht, im Kampf der Religionen gegeneinander eher ‚schlechter‘: Ungläubige abzuschlachten sei nicht strafbarer Mord, sondern verdiene irdische – oder spätestens himmlische – Belohnung.
Aber auch die Gottlosigkeit im Sozialismus hat Güte und Edelmut nicht gerade befördert. Die jahrtausendealte Sicherheit, ‚Wenn ich mich ordentlich benehme, dann wird nach meinem Tod alles gut‘, die ist weg. Wenn es mir hilft, kann ich sie mir ja trotzdem einreden. Dass nach meinem Tod gar nichts mehr passiert, sollte eigentlich keine beängstigende Vorstellung sein, sie ist es für die meisten aber doch. Für die ist dann die tröstliche Ungewissheit der aussichtslosen Gewissheit vorzuziehen, und deshalb tröpfelt die Hoffnung auf Transzendenz gegen Ende des Lebens in viele Seelen wieder zurück.
Zuversichtlich, jedenfalls ein bisschen,
Hanno Rinke
Grafik mit Material der mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH
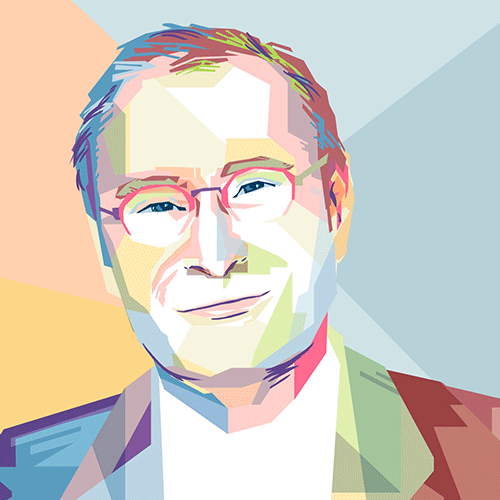
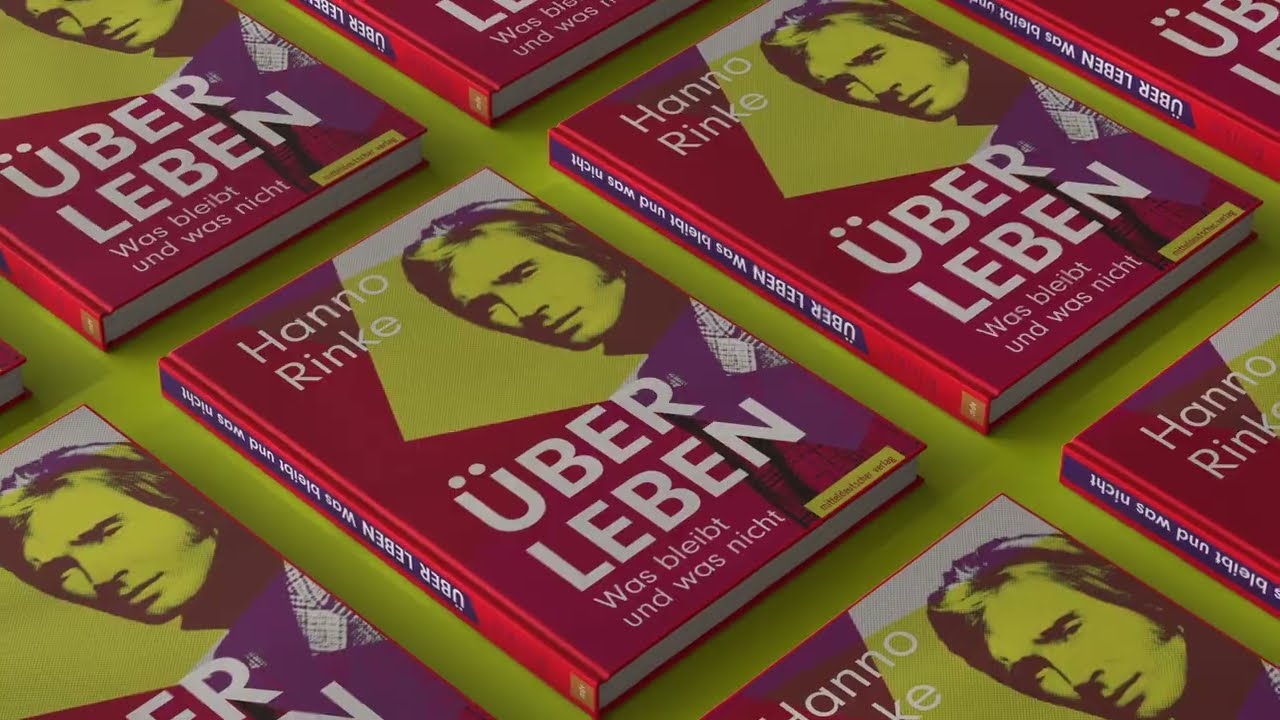
Ob Geld glücklich macht, darüber kann man noch viele Jahrzehnte streiten. Aber ein Leben ohne Geld ist ohne Frage äußerst zehrend. Man kommt eben einfach nicht sehr weit.
Es macht auf jeden Fall nicht automatisch glücklicher kein Geld zu haben 😉 Das ist wohl sicher.
Etwas allein macht wohl selten glücklich. Es muss noch etwas dazukommen: Geld und Geborgenheit, Lust und Liebe, Würstchen und Senf.
Aber Geld und Senf reicht nicht?
Die Kombination ist individuell unterschiedlich. Für Herrn Kühne ist Geld und Senf dasselbe.
Und trotzdem … braucht es einen drohenden Gott um sich auf der Erde zu benehmen?
Ohne Furcht vor Strafe scheint es weder im Straßenverkehr noch im Hinblick aufs Jenseits zu klappen.
Schlimm, oder?! In dem Zusammenhang … Es wäre mal an der Zeit für Strafen für Idiotie in den Sozialen Medien.
Welche Polizei wäre dafür zuständig?
Wäre ich kein Atheist, würde ich vorschlagen Gott straft die Übeltäter. So muss sich demnächst vielleicht Herr Merz was ausdenken. Aber man sieht ja bei Musk und Meta und überall, dass es eher cool ist überhaupt gar nicht zu regulieren, zu kontrollieren oder zu strafen. Jeder sagt was er will, egal mit welcher Konsequenz für die Mitmenschen.
Ganz so trist ist es ja noch nicht um den Strafvollzug bestellt. Habeck lässt auch Rentner wegen übler Nachrede belangen.
😆
Ein faszinierender Gedanke ist, wie die Entzauberung der Naturphänomene nicht nur den Glauben erschüttert, sondern auch eine Art Bedeutungsverlust mit sich bringt. Früher war ein Sturm ein Zeichen göttlichen Zorns, heute ist er nur noch eine meteorologische Notwendigkeit. Doch nimmt uns das Wissen nicht auch eine gewisse Ehrfurcht? Der Text zeigt eindrücklich, wie das Verschwinden der Transzendenz nicht abrupt, sondern schleichend geschieht – und wie viele am Ende doch wieder Trost in ihr suchen. Ein Kreis, der sich immer wieder schließt.
Da mag etwas Wahres dran sein. Aber ich sehe keine Alternative. Wollen wir stattdessen wieder an die zürnenden Götter glauben, sobald es draußen gewittert?
Es schient jedenfalls so, als würde es vielen jüngeren Menschen auch nicht mehr reichen an gar nichts zu glauben. Wie Ehlers schreibt, es scheint sich wohl im Kreis, oder zumindest in Wellen von Glauben und Unglauben / Spiritualität und Realität zu entwickeln.
Die Ehrfurcht vor der Physik des Wetters und dem Aufbau des Lebens könne man sich eigentlich bewahren, aber ohne Schöpfer bleibt wohl nur Erstaunen übrig. Ehrfurcht ist ein erhebendes Gefühl, schade, dass es so oft mit Intoleranz gegenüber den Unbeteiligten verbunden ist.
Ehrfurcht sollte doch nicht an eine bestimmte Überzeugung gebunden sein. Ob mit oder ohne Schöpfer – sie bleibt eine tiefe, menschliche Reaktion auf das Staunen über die Welt.
Vielleicht eine Begriffsfrage: Staunen und Bewunderung ist auch gegenüber der Natur und der Technik möglich. Ehrfurcht setzt für mich einen Schöpfer oder eine Schöpferin voraus.
Was wäre eigentlich schlimmer, völlig desillusioniert und hoffnungslos den letzten Atemzug zu tun oder mit der gelassenen Gewissheit zu sterben, dass der Tod nur ein Durchgangsort ist, ohne hinterher jemals zu erfahren, dass diese Gewissheit vielleicht ein letzter großer Irrtum war? 🤷🏼♂️
Ich mach mir es vielleicht zu einfach, aber Gelassenheit geht doch auch, wenn die Gewissheit fehlt. Oder?
Gelassenheit ohne Gewissenheit ist sicher möglich, aber wahrscheinlich denen überlassen, die das Nirvana erreichen.
Nicht sein zu müssen, ist, wenn man schreckliche Qualen leidet, eine angenehme Aussicht. Ganz und gar weg zu sein, wird aber normalerweise nicht als erfreuliche Zukunft empfunden.
Es stimmt, dass das Ende von Qualen als Erleichterung erscheinen kann, während das völlige Verschwinden oft Angst oder Unbehagen auslöst. Vielleicht liegt der Unterschied darin, ob man sich vom Schmerz oder vom Sein selbst befreien möchte – zwei sehr verschiedene Dinge.
Vielleicht ist aber das eine nicht ohne das andere zu haben.
Ich glaub kaum, dass Putin glaubt, sein Kampf für ein größeres russisches Reich wäre gottgewollt. Er weiss schon sehr genau, was er da tut. Die Religion spielt da ausnahmsweise mal keine große Rolle.
Ich glaube, Putin ist einfach größenwahnsinnig. Da geht es nicht um Logik oder so etwas.
Größenwahn hat eine Logik, wenn auch nicht unsere.
Vielleicht wäre es mal an der KI, diese Logik zu entschlüsseln. Politik und Historiker haben das ja bisher nicht so gut geschafft. Zumindest nicht in einer Form, die schlimmere Ereignisse verhindert hätte.
Im Allgemeinen halten sich Größenwahnsinnige nicht für größenwahnsinnig und Dumme nicht für dumm. Wie klug die KI ist, wird sich bald erweisen. Oder?
Ich wünschte mir, der Glauben würde bei den auf Wahlen angewiesenen Politikern bzw. vielmehr bei eben diesen Wahlen weniger eine Rolle spielen. Ginge es ausschließlich um kühle Fakten, hätte die AfD vielleicht weniger Chancen.
Es ist wie in den USA. Erstmal denkt man, dass die Menschen nicht so dumm sein können, wie es auf den ersten Blick erscheint. Später merkt man dann, dass es leider doch viel schlimmer ist, als man angenommen hat.
Mir graust es vor der Bundestagswahl!
Da bin ich realistisch: Eine erfolgversprechende Koalition bringt höchstens noch der Heilige Geist zustande.
Ich dachte lange Zeit, dass die Menschen hier im Land weniger extrem, oder weniger verzweifelt sind als anderswo. Es geht uns ja trotz allem deutlich besser als es in anderen Ländern der Fall ist. Aber die Waage kippt scheinbar doch viel leichter nach rechts, als ich dachte. Demokratie ist fragil. Was soll man tun um die Wähler zurückzugewinnen? Und um rechte Strömungen zu unterbinden? Ich bin noch ratlos.
Wir sollten nicht hysterisch werden. Adenauer koalierte jahrelang mit der Deutschen Partei (DP), einem Sammelbecken für ehemalige NSDAP-Mitglieder. Drei Minister dieser Partei saßen in seinem Kabinett. Die DP stand deutlich weiter rechts als die heutige AfD – und doch ging die noch junge deutsche Demokratie daran nicht zugrunde. Mehr Demokratie wagen!
Man muss erstmal die Wahl abwarten. Ich sorge mich allerdings auch ein wenig. Und zwar hauptsächlich, weil es ja kein Deutsches Problem zu sein scheint, sondern weltweit autoritärere und rechtere Regierungen „in“ zu sein scheinen.
Der Zeitgeist (auch ein typisch deutsches Wort) schlägt nach einer Weile immer wieder um. Das zu ändern schafft nie die Demokratie, aber in gewissem Umfang die Diktatur.
Heute zürnen die Wähler statt der Götter. Das Resultat ist sicher ähnlich destruktiv.
Reinigende Gewitter nicht ausgeschlossen.
Man hofft ja, dass nach dem großen Knall etwas neues, besseres entsteht. Aber in dem Fall bleibt das bei mir wirklich eher Hoffnung als Glaube.
Das Beste hoffen, das Schlimmste einkalkulieren, das ist schwierige realistische Sichtweise.
Ihr Text beschreibt ziemlich eindrücklich, wie der Verlust der Transzendenz oft nicht plötzlich, sondern schleichend geschieht – ein Prozess, der sich über Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinzieht. Dabei stellt sich die Frage: Ist dies ein Verlust oder eine Befreiung? Die schrittweise Entzauberung der Welt mag einerseits den Schrecken des Ungewissen mindern, nimmt andererseits aber auch die tröstende Illusion einer höheren Ordnung. Vielleicht ist es gerade diese Spannung zwischen Enttäuschung und Erleichterung, die viele Menschen im Alter wieder zur Religion zurückkehren lässt – nicht aus Überzeugung, sondern aus dem Bedürfnis nach Halt. Ein faszinierendes Dilemma unserer Zeit.
Habe ich eine Wahl? Kann ich mir aussuchen, was ich glauben möchte? Das ist ja kein Basar. Wenn ich mich zu zwingen versuche, etwas zu glauben, weil es doch so schön wäre, wenn es so wäre, dann läuft das auf Selbstbetrug hinaus. Aber vielleicht ist auch der legitim.
Glaube ist kein Basar, aber auch kein starres Konstrukt. Es geht nicht darum, sich etwas einzureden, sondern zu hinterfragen, welche Überzeugungen einem Halt geben oder weiterbringen. Selbstbetrug? Vielleicht eher eine bewusste Entscheidung, sich für bestimmte Möglichkeiten offen zu halten – nicht aus Naivität, sondern weil wir ohnehin immer mit begrenztem Wissen handeln.
Schon Goethes Faust sagt ja: „Die Botschaft hör‘ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“ Das geht inzwischen vielen so. Aber wer sich mit dem Teufel einlässt, der ist wohl noch nicht ganz verloren für das große Himmelsspektakel.
Man sollte sich mehr Zeit zum Lesen nehmen – Ich bin trotzdem etwas traurig, dass es in dem Artikel nicht um den Verlust der Tanztendenz geht.
Im Fasching wird die Tanztendenz sicher wieder etwas steigen. Aber dann ab Aschermittwoch …
Ob mit oder ohne Gott – der Mensch bleibt sich selbst das größte Rätsel.
Amen
Wo der Mensch dem Menschen kein Rätsel ist, weil er genau zu wissen meint, wie der Russe, der Jude, der Kommunist ‚tickt‘, da wird es leider oft schlimmer und nicht besser.
Ja, das stimmt. Wenn man denkt, man weiß schon alles, verliert man oft den Blick für das, was wirklich wichtig ist – und das kann die Sache eher schlimmer machen. Manchmal ist es gerade das Unbekannte, was uns weiterbringt.
Die einen lieben das Altbewährte, die anderen lieben das Abenteuer. Im Urlaub ist das Geschmackssache, in der Politik ist es lebensentscheidend.
Na mal schauen, wie es wird, wenn Trump in Gaza seine neue Riviera im Nahen Osten baut. Die Palästinenser buchen dann sicher gerne mal eine Nacht im dortigen Trump-Tower.
Wenn die Palästinenser dort blieben, fände ich die Idee nicht schlecht. Sie könnten Manager und Dienstleister sein und den Tourismus betreuen. Die Gegend muss erst mal völlig entrümpelt, also flach gemacht werden. So wie jetzt ist sie noch nicht lebbar. Wer kann diesen Schutt Heimat nennen?
Nun ja, die Palästinenser nennen es Heimat. Schutt hin oder her. Dass die ganze Gegend zerstört wurde, haben sie sich ja nicht ausgesucht. Aber dass Donald Trump tatsächlich Soldaten in den Gazastreifen schickt, daran glaube ich sowieso nicht. Das kann er ausnahmsweise mal weder seinen Wählern noch der Partei verkaufen.
die amerikaner spinnen doch völlig
Da kann man ausnahmsweise nichts hinzufügen.
‚Die Amerikaner‘ ist wieder so ein Klischee. Weder in New York noch in Hollywood hat Trump viele Freunde. Aber so ist nun mal Demokratie: Wer keine Ahnung hat, hat genauso eine Stimme wie jemand, der sich mit allen Themen gründlich auseiandergesetzt hat.
Was ist denn mit der These ‚Wenn ich mich ordentlich benehme, dann wird in meinem Leben alles gut‘?
Da gibt es im Laufe der Geschichte zu viele Beispiele, dass das nicht stimmt. Da wurde Kathargo ausgelöscht, Hexen wurden verbrannt und Juden in Auschwitz umgebracht. Wie ordentlich die Umgebrachten benommen hatten, spielte keine Rolle. In Odessa und Gaza ist es nicht anders. Wer sich ‚unordentlich‘ benimmt, kommt oft weiter.
Interessanter Punkt, aber ich glaube, man kann daraus keine feste Regel ableiten. Die Geschichte ist voll von Momenten, in denen sowohl „unordentliches“ als auch „ordentliches“ Verhalten Erfolg oder Tragödien gebracht haben. Es hängt immer von der Situation, den Menschen und den Machtverhältnissen ab. Pauschalisieren ist da in beide Richtungen schwierig.
Sie haben völlig recht. Traurig ist nur, dass viele Menschen auf festen Regeln bestehen, auch da, wo es – objektisch gesehen – keine gibt. Glücklich der Staat, dessen Gesetze die freie Entfaltung des Einzelnen ermöglichen.