>> ZWISCHEN WEGDÖSEN UND AUFSTEHEN <<
Der rote Knopf
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Der Tag, der Traum, der Tod. Gespürt habe ich da abgründige Zusammenhänge, bevor ich sie denken konnte. Das war schlimm damals. Nur was man denken kann, kann man bannen.
Immer schon gab es in mir die Angst. Die Angst als unbestimmbares Grauen vor Unendlichkeit und dem Ausgeliefertsein an das Leben; die Furcht vor stärkeren Klassenkameraden, schlechten Schulnoten, verärgerten Eltern. Und trotz all dieser Widrigkeiten, die meine Freude am Leben ohnehin einschränkten, gab es darüber hinaus die krönende Angst vor dem Tod als die Angst vor dem Nichts, dem Ausgelöschtwerden. Todesangst, das ist die Angst, sterben zu müssen. Meine Angst aber war die Angst vor dem Zustand eines entleerten Alls. Es gibt nichts, gar nichts – außer meinem Bewusstsein in dieser zeitlichen und räumlichen Leere: keine Farbe, nicht mal Schwarz; keine Geräusche, nicht mal Stille; keine Gerüche, nicht mal Geruchlosigkeit. Kein Gedanke, nur der Fluch, sein zu müssen. Weniger als nichts: das Garnichts. Es war der Schrecken meiner Kindheit.
Die Sorgen des Alters sind anders: Furcht vor Krankheit, Armut, Einsamkeit und Trauer über den Verfall des Körpers. Wer nie attraktiv war, dem bleibt dieser Kummer erspart, aber es bleibt die Trauer über den Verlust geistiger Fähigkeiten, die für die schon immer Hässlichen ja nun das letzte Tafelsilber sind. Erfolg, Macht, Geld – wie lange kann man sich daran festklammern? Jahrelang pendelt der Körper zwischen Wohlbefinden und wilder Pein, der Rest (oft Geist oder Seele genannt) schwankt zwischen Wohlbefinden und Wahnsinn. Mit viel Glück befinden sich beide überwiegend mittig zwischen den Extremen, also im Zustand schmerzloser Gleichgültigkeit, die von Zeit zu Zeit durch ein bisschen Kitzel am Leib oder Wut im Hirn aufgelockert wird. So vergehen die Jahre. Die Fassade hält oft lange, die Innenräume tragen bereits Trauer. Die Angst vor dem Sterben: nicht die Angst vor dem Totsein, sondern vor dem Vorgang des Sterbens. Eben lieber einschlafen und nicht wieder aufwachen, statt amputiert, aufgeschnitten, bestrahlt, an Masken, Sonden, Schläuche gefesselt, endlich irgendwann mal weg sein zu dürfen. Sterbehilfe: Barmherzigkeit oder Frevel? Die Moral wurde zeitweise als absolute Größe angeordnet oder eingeprügelt: gute Tat – guter Tod. Helfe ich dir in diesem Leben, dann hilfst du mir im nächsten, zumindest als Zeuge für meine Himmelswürdigkeit. Und helfe ich gar der ganzen Menschheit, dann kommt es auf ein paar Tausend Tote während des Vollzugs nicht so an. Im Namen des Glaubens sind viele absurde Thesen entwickelt worden. Was aber bringt der Tod wirklich?
Neues Leben – transformiertes Leben (an Orten wie Nirwana, Schlaraffenland, Himmel oder Hölle) – gar kein Leben mehr. Das sind die drei Möglichkeiten, die die Menschheit, nachdem sich ihr Bewusstsein herausgebildet hatte, als Zustand jenseits des Todes beschäftigten. Und jede der drei Möglichkeiten war Anlass für entsetzliche Gedanken und Taten und für wundervolle Gedanken und Taten. Blutopfer, Selbstverbrennung – Auferstehung? Die einen sehnen sich nach dem fremden, nur der Fantasie vertrauten, nächsten Zustand und betrachten ihr ‚irdisches Dasein‘ als Grundausbildung oder Durchgangslager. Die anderen sind misstrauisch und wollen so viel wie möglich von dem ergattern, was sie hier schon mal einheimsen können: erhabene Landschaften, edle Gesinnungen, praktische Nächstenliebe, frisches Gemüse, strebsame Kinder, versauter Sex, geile Musik. „Was man hat, das hat man.“ Und: „Die Erinnerung kann einem keiner nehmen“, sagen die Zuversichtlichen, bevor Alzheimer sie erwischt.
Ich glaube, die meisten Menschen, die sich die Zeit zum Denken nehmen, sind sich über keine der drei Möglichkeiten hundertprozentig sicher: Der lungenentzündete Papst hat vielleicht schon mal klammheimlich in Erwägung gezogen, als indische Tempelratte wiedergeboren zu werden, und der „Gott ist tot!“ schreiende Nietzsche-Nihilist hofft womöglich auch sekundenweise, dass er für diesen lästerlichen Ausspruch nicht ab in die Hölle muss. Schon Hamlet fand ja das Nichtsein so riskant, dass er sich doch nicht umbrachte, was ihm allerdings am Ende genauso wenig nutzte wie den übrigen Darstellern: wie im wahren Leben. Der Rest ist Schweigen. Die einzige Frage, die ich in diesem Zusammenhang spannend finde, ist die, ob ich denn dann noch weiß, was vorher war, oder ob der Tod die ganz große Demenz ist.
Wie Sisyphos: neues Leben, neues Streben, neues Sterben. Optimisten hoffen, dass der Stein mit jedem Leben kleiner wird. Und wenn der Kiesel dann den Abhang auf der anderen Seite heruntergekullert ist? Endloser Orgasmus oder ewige Ruhe? Je nach Laune schlummere ich mit der Vorstellung ein, mal das eine, mal das andere schlimmer zu finden. Ich schlafe, also bin ich. Der Sinn besteht im Sinn, wenn überhaupt. Und dann träume ich diesen ganzen Unsinn von Menschen, die ich in diesem oder einem weiß Gott anderen Leben gekannt, gemocht, geliebt habe, und mal weiß ich von den Vertrauten, dass sie tot sind, und mal nicht, und im Halbschlaf frage ich mich, ob wohl eine Party mit all den lieben Verblichenen oder eine Party mit all den noch Vorhandenen lustiger wäre; und weil ich keine Kinder habe, kann ich mir ja schon ausrechnen, wer noch wegfallen muss, damit ganz sicher der Totentanz die amüsantere Veranstaltung würde.
Schon vor dem Totentanz gab es Mysterien: Vom alten Ägypten mit seinen Osiris-Spielen bis zum Oberammergau-Tourismus kam der fromme Schauder auf der Beliebtheitsskala immer gleich nach Gladiatorenkämpfen oder Löwenspeisungen (Lieblingsfutter: Christen) und Fußballspielen mit anschließendem Polizistenzertrampeln, überspitze ich es mir in gespensterseligen Nachtgedanken zulasten der Glaubwürdigkeit des fernen Tageslichtes.
Der Tod: allgegenwärtig und allem entrückt. Tyrannenmord und Hinrichtung; und Stierkampf und Schlachtfest; und Verkehrsunfall und Explosion; und Arsen und Zyankali; und ‚plötzlich und unerwartet‘ und ‚nach langem schweren Leiden‘; und Friedhofsgärtner und Selbstmordattentäter: Ein endloser Reigen zu Ehren des Mannes mit der Sense; ich höre einen wiegenden Dreivierteltakt, mtata, mtata – wie es pocht und dreht! –, und ich drehe mich auch, sobald ich hineinwache in die fahle Dunkelheit, vom Raum zur Wand, von der Wand zum Raum und wieder zurück, mtata, mtata – bis ich mich für das nächste Traumgespinst erneut der Seite zuwende, auf der ich meine vorigen, schon verblassten Mutproben bestanden hatte.
Morgens wache ich dann also erwartungsgemäß doch auf, weil ich das ja sonst nicht gemerkt hätte. Da ich diesen äußerst unruhigen, traumbeladenen Schlaf habe, bin ich auf den Augenblick, in dem ich der Wirklichkeit endgültig nicht mehr durch verstohlenes Dahinschlafen entrinnen kann, bereits über Stunden vorbereitet. Erst träume ich all den irrealen Wahrheiten und realistischen Wahnvorstellungen, deren einziges Publikum ich war, noch ein wenig hinterher, doch dann kommt die tägliche Morgen-Frage:
Wenn ich einen roten (Farbe egal) Knopf hätte, um mein Leben sofort zu beenden, sodass nichts von mir übrig bliebe: die Umkehrung meiner Existenz, keine fiese Leiche, keine fiese Lache – nichts, weder blutige Tatsachen für die, die mich finden, noch bleischwere Erinnerungen für die, die mich dann ja nach-, also vorträglich, nie gekannt hätten –, würde ich diesen Knopf drücken? Meist bin ich morgens in der (un)glücklichen Lage, ohne Termindruck zu sein, sodass ich diesem völlig unsinnigen Gedanken minutenlang hinterhersinnen kann. Nach den ganzen erschöpfenden Träumen, in denen die verlorenen Weggefährten und die traumatischen Neuzugänge ständig um mich herumgekreist waren, als sei ich ein besonders heißer Brei, ist meine Lust auf die Lebenden am Nullpunkt. Der Weg ist weg. Ich versuche, mich auf irgendetwas hinzufreuen. Vielen Menschen reicht dafür schon ein gemütlich-häusliches Müsli oder zumindest ein Hotel-Frühstücksbuffet voller Schinken und Croissants. Mit derartigen Anstrengungen brauche ich mich gar nicht erst abzumühen. Mein Frühstück findet frühestens gegen halb zwei statt, besteht aus Fisch oder Fleisch plus Gemüse oder Baguette, gern auch zur Abwechslung Pasta, und statt Latte macchiato gibt es vorab schon mal das ein oder andere Glas Weißwein, damit ich was Festes nicht nur meine widerspenstige Speiseröhre runterbekomme, sondern auch am Mageneingang nicht vorzeitig Schluss ist.
Nun koche ich sehr gern und gehe auch sehr gern in Restaurants, wobei ich, nachdem ich in fast feierlicher Vorfreude die Bestellung aufgegeben habe, den Besuch am liebsten wieder beenden würde, gar nicht mal wegen der Rechnung, sondern vor allem, weil ich das Bestellte ja auch essen soll und mir die Kellner immer so leid tun, wenn sie meine halb vollen Teller wieder wegräumen müssen. Ich gehe nie allein ins Restaurant und bin immer erleichtert zu sehen, wie leer meine Gäste ihre Teller essen. Das muss den Koch doch freuen. Meistens gehen wir ja in italienische Lokale, und da kann ich es dann nicht lassen, vor meinen Mitessern und vor dem Personal mit meinen recht umfangreichen Sprachbrocken zu protzen. Der Kellner reagiert bisweilen etwas hilflos, nicht weil meine Aussprache so schlecht wäre, sondern weil er Kroate ist und noch weniger Italienisch versteht als ich. Gedemütigt wiederhole ich meine Bestellung auf Deutsch. Der Effekt ist verpufft, aber zumindest brauche ich ‚Carpaccio‘ nicht in ‚dünn geschnittene Rinderscheiben‘ zu übersetzen. Bei Selbstgekochtem schäme ich mich weniger. Da putze ich meist hemmungslos alles weg, nicht weil ich so toll koche, sondern weil die Angst vor dem Liegenlassen wegfällt. Dieses Verhalten klingt und ist natürlich völlig verdreht, nur kann ich es nicht ändern, es sei denn, ich drücke diesen roten Knopf, dessen größter Vorteil darin besteht, dass es ihn nicht gibt, sodass ich, was dennoch selten vorkommt, ganz unbesorgt denken kann: ja. Ja. Ja, ja! Heute würde ich ihn drücken, und alles wäre vorbei. Denn das ist nun mal der Vorteil dieses Knopfes: Er ist nicht Philosophie oder Religion, sondern Technik: Strom weg – Ende. Keine ‚Ewige Lampe‘ neben dem Altar, kein schummeriges Segenslicht am Ende des Tunnels, keine Heerscharen überirdischer Heilsgestalten, keine Belohnung, keine Strafe: Schluss. Dieser hypothetische Entschluss bereitet mir einen masochistischen Genuss: Ätsch, du blödes Hirn – ausgedacht!
Hält natürlich nicht vor. So ist Tod nicht. Ich träume ja oft von lebensbedrohenden Situationen, und immer weiß ich, dass ich unsterblich bin. Ich weiß nicht, warum, aber: Ich! Bin! Unsterblich! Das ist beileibe nichts Esoterisches oder Parapsychologisches. Irgendeine dem Bewusstsein nur halb zugeordnete Vernetzung kennt den Weg aus dem Schützengraben, aus dem Flugzeugabsturz, aus dem Sprung vom Felsen, aus dem auf mich gerichteten Gewehr: Aufwachen! Das reicht.
Ich habe das fast Nacht für Nacht durchgespielt, wobei ich ständig träume, dass ich aufwache und aufstehe, sodass mich meine innere Erlebniswelt durch diesen gemeinen Trick immer in den Glauben entlässt, ab jetzt sei alles Wirklichkeit. Kaum trete ich aus dem Schlafzimmer, passieren wieder hanebüchene Angelegenheiten: Ich laufe barfuß in der Opernpause rum, habe eigentlich auch sonst nichts Rechtes an, mein Gepäck ist in Bogota, und ich bin in Schanghai, die Toten schauen auch noch mal rein, bis ich wieder aufwache und aus dem Fenster springe, so als Test. Wenn ich nicht tot bin, wie bisher noch immer, war das bloß wieder der nächste Traum. Das Ganze geht, meinem Zeitgefühl nach, stundenlang so weiter; das ist ziemlich anstrengend, und dass ich am Morgen lieber an rote Knöpfe als an Rührei mit Speck denke, finde ich nachvollziehbar.
Eher appetitlos als gefräßig,
Hanno Rinke
Grafik mit Material der mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH

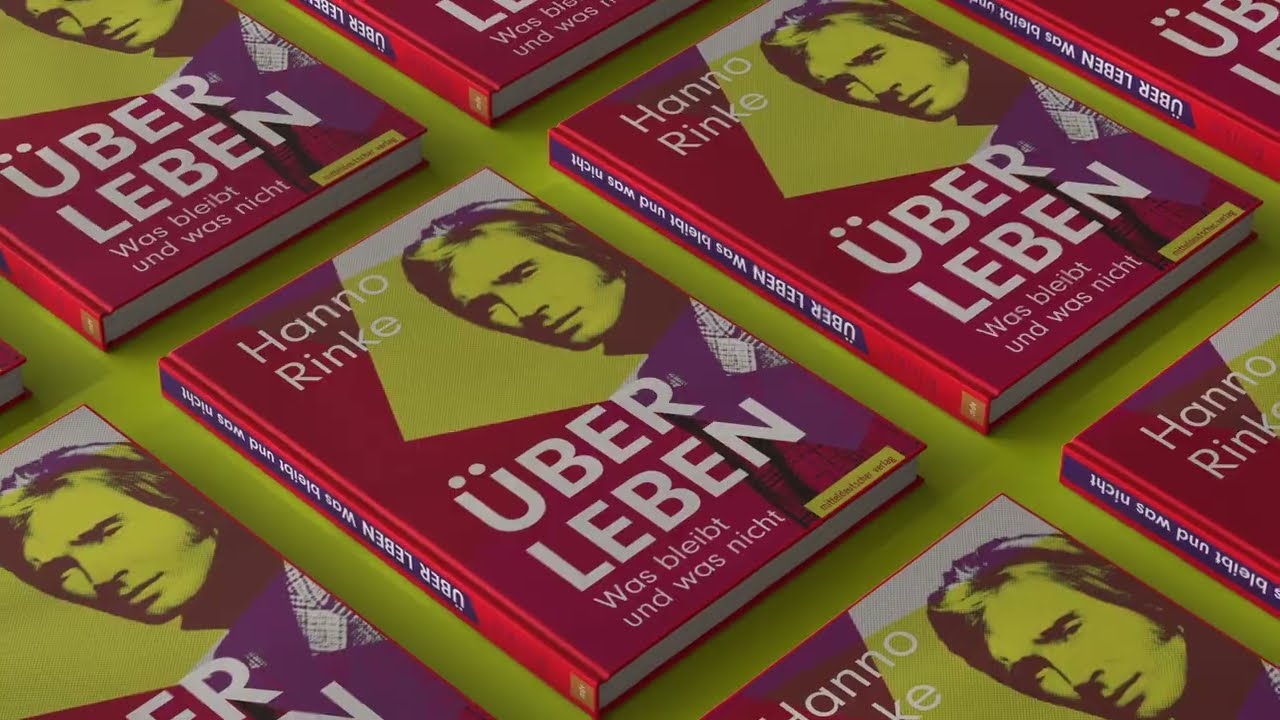
So viel Tod und trotzdem soviel Freude beim Lesen 😉
Das ist die Absicht!
Ich wünschte, ich hätte auch so einen traumbeladenen Schlaf. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich mich wirklich an einen aufregenden Traum erinnern könnte.
Vielleicht ein Traumtagebuch führen? Auch wenn es erstmal albern klingt.
Träumen tut ja jeder. Sich nicht daran zu erinnern, bedeutet: Der Schlaf war sehr tief. Das ist doch gut! Mein Schlaf ist flach, das ist eigentlich schlecht, beschert mir aber ein Zweitleben.
Wer sich nicht an seine Träume erinnert, dem hilft auch kein Traumtagebuch, würde ich sagen.
Auch wieder wahr
Experten schreiben ihr Tagebuch schon im Schlaf. Kein Witz: ich träume recht oft, dass ich schreibe oder komponiere und bin dann sehr enttäuscht darüber, wie wenig im Wachzustand von all dem noch übrig ist.
Da gibt es doch den Witz vom Schriftsteller, der immer seine Träume vergisst. Und sich dann endlich einen Schreibblock neben das Bett legt. Er träumt wieder, wacht kurz auf, notiert seine Gedanken, schläft wieder ein. Am nächsten Morgen greift er gleich zum Block und liest „Mann trifft Frau“.
Ein sehr beliebter Anfang von Dramen und Komödien.
Die Angst vor dem Tod begleitet die Menschheit seit jeher – sei es als Furcht vor dem Nichts, als Ungewissheit über das Danach oder als Angst vor dem Sterbeprozess selbst. Während manche Trost in Religion oder Spiritualität finden, sehen andere den Tod als endgültiges Ende. Gleichzeitig ist da die Frage, wie man mit der eigenen Vergänglichkeit umgeht: Sich an Erfahrungen und Erinnerungen festhalten? Den Moment genießen? Oder die Endlichkeit akzeptieren und sich damit abfinden?
Auch die Vorstellung eines plötzlichen Endes durch einen „roten Knopf“ wirft grundlegende Fragen auf: Ist es der Wunsch nach Kontrolle über das eigene Leben oder eine Flucht vor der Unsicherheit des Sterbens? Und was bedeutet es, wenn diese Möglichkeit nicht existiert? Vielleicht liegt darin auch eine Art Erleichterung – dass das Leben weitergeht, weil es gar keine andere Wahl gibt.
Das Thema des selbstbestimmten Todes taucht in letzter Zeit immer häufiger auf. Ich habe selbst zwar noch keine Antwort, aber die Diskussion ist sicher eine richtige.
Das Lebenmüssen entscheidet man nicht selbst (obwohl ich mal einen Film gedreht habe, wo man sich im Wartezimmer immer sein nächstes Leben aussucht). Das Sterbendürfen hat man unter Umständen in der Hand. Theoretisch. Das zu wissen beruhigt manche Leidgeplagte.
Ist das nicht auch der Plot vom neuen Bong Joon Ho Film? Irgendwie war da so etwas Ähnliches
Es ist ganz tröstlich, sich einzureden: Das habe ich mir beim ewigen Streaming-Dienst so bestellt. Nächstes Mal nehme ich wieder was anderes.
Ich bin ja wirklich nicht gläubig, aber beim Tod sollte man doch trotzdem nicht eingreifen.
Das ist eine nachvollziehbare Haltung. Aber ist Nicht-Eingreifen nicht auch eine Entscheidung, die Einfluss nimmt?
Das Recht auf Tod billige ich jedem zu. Wer nicht mehr mag, soll aufhören. Wieso nicht? Bei mir müsste es allerdings sehr dicke kommen, bevor ich von diesem Recht Gebrauch machen würde.
Man kann jede Unterlassung als Entscheidung sehen: dann bin ich ein Nichtwähler, ein Nichmörder, ein Nicht-Trump-Fan. Viel weiter hilft mir diese Einsicht nicht.
Ich bin auch der Meinung, dass das jedem selbst überlassen bleiben sollte. Bei so einem Thema bringen Vorschriften herzlich wenig. Ich glaube außerdem nicht, dass sich, auch wenn diese Entscheidung irgendwann legal werden sollte, deswegen vom einen zum anderen Mal umbringen würden.
Abtreibung, Selbstmord, Canabis! Ich bin dafür.
Dieser fromme Schauder ist wohl einfach eine weitere Art sich mit dem Thema zu beschäftigen und dadurch etwas die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen.
Mein Schauder ist nie fromm. Als ich noch gläubig war, war ich erfüllt von der Botschaft, Wenn mich jetzt Entsetzen packt, reiße ich lieber aus als zu beten.
Hamlet selbst hat sein Tod vielleicht nichts genützt – die Schauspieler freuen sich aber bis heute.
😂
Den Schauspielern macht die Rolle besonderen Spaß, solange die Figur noch lebt, obwohl später für die Leiche weniger Text zu lernen ist.
Hahaha! Das wird wohl stimmen!
Ich kenne diese Zustände. Was mir immer hilft ist: Dankbarkeit. Für alles was ich habe und kann, und für alles was ich (noch) nicht habe und kann. Für Letzteres dankbar zu sein macht froh, denn es gibt dem Leben den Drive, den ich brauche, um aktiv zu werden. Und der Tod? Vermutlich bleibt sein Wesen und damit das Wissen nach dem Danach im Nebel, weil wir die Wahrheit mit unseren Sinnen (noch) nicht erfassen können. Das ist gut so, denn der allein der Gedanke sich statt dem erschreckenden „Nichts“ dem gewaltigen „Alles“ hingeben zu müssen/dürfen verursacht dem Gehirnchen Probleme. Error, Tilt, Malfunction.
Auch die kleinste Mahlzeit will ausgiebig genossen sein. Im Hier und Jetzt.
Genießen zu können, ist ein Segen. Aber auch ein Talent. Wenn ich es nicht mitbekommen hätte, wäre ich lieber ungeboren geblieben.
Die Angst vor dem Tod und die Ungewissheit darüber, was danach kommt, sind doch Themen, die Menschen seit jeher beschäftigen. Während einige Trost in religiösen oder philosophischen Vorstellungen finden, bleibt für andere nur die Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit. Auch die Frage, wie das Leben bis dahin gestaltet wird, spielt für uns alle eine zentrale Rolle: Ist es wichtiger, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln, oder sich mit der Unvermeidlichkeit des Endes abzufinden? Ich weiss es auch nicht. Letztlich bleibt der Tod eine Grenze, die jeder für sich interpretieren muss – mal mit Furcht, mal mit Gleichgültigkeit, mal mit schwarzem Humor.
Wahrscheinlich ist es gerade diese Ungewissheit, die den Tod so faszinierend und beängstigend zugleich macht. Und genau deshalb hört die Auseinandersetzung damit wohl nie auf.
Man kann ihm halt nicht entweichen
Immer mal wieder, aber zum Schluss doch nicht.
Ich glaube die Angst vor dem Sterben unterscheidet sich von der Angst vor dem Tod. Viele fürchten ja nicht das Nichts, sondern den Prozess des körperlichen Verfalls – das Ausgeliefertsein an Krankheit, Schmerzen oder medizinische Apparate. Der Wunsch, einfach einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, ist weniger ein Ausdruck von Todessehnsucht als vielmehr der Wunsch nach Würde im Abschied. Doch genau hier kollidieren individuelle Vorstellungen mit gesellschaftlichen Normen und moralischen Debatten über Sterbehilfe und das „richtige“ Ende eines Lebens.
Der Wunsch nach Beeinflussung ist groß: gut sein, um in den Himmel zu kommen, und Sport treiben, um gesund zu sterben.
Es wäre ja schön, wenn man einfach sagen könnte „wer gut lebt, der stirbt auch gut“. Aber so einfach ist es wohl leider nicht.
Nee. Leider. Aber gut zu leben ist trotzdem mal ein Anfang.
Heißt ‚gut leben‘: auf langen Reisen köstlich essen oder in langen Nächten fromm beten?
Das muss wohl jeder selber entscheiden, nicht?! Hauptsache, man ist am Ende zufrieden.
Die Lebensentscheidungen leider oft auch abhängig von den Finanzen und den Begabungen.
Ist es die Einschätzung der Zufriedenheit auch?
Daher stammt wohl die subjektive Einschätzung: lieber arm, aber glücklich, verkalauert zu: lieber reich, jung und schön als alt, arm und hässlich.
Schlaraffenland wäre mir ja persönlich die liebste Option.
Also, ich würde ja ganz gern auch mal den Mund aufmachen, ohne dass mir gleich eine gebratene Ente reinfliegt.
Also mir sind diese Optionen ehrlich gesagt alle nicht geheuer. Ich arbeite dann lieber an einer schönen Zeit hier auf Erden und hoffe, dass dann nach einem hoffentlich erfüllten Leben (toi toi toi) irgendwann auch Schluss ist.
Diese ganzen Vorstellungen von Paradisen und Schlaraffenländern dienen ja vor allem dazu, den Menschen, denen es dreckig geht, zu signalisieren: Im nächsten Leben wird alles besser: Der Reiche kommt, ätsch!, in die Hölle, und du kommst, hurra!, in den Speisesaal. Diese Aussicht tröstet und hält gefügig.
Wem’s hilft
Was mir hilft und niemandem schadet, ist erlaubt, selbst, wenn es für andere unverständlich ist.
Also, der Gedanke, dass nur das Gedachte gebannt werden kann, ist faszinierend und zugleich beunruhigend. Was ist aber, wenn das Unsagbare nicht gedacht, sondern nur gespürt wird – wenn es sich jeder gedanklichen Kontrolle entzieht? Dann bleibt nämlich nur das Gefühl der Ausgeliefertheit, ein Schwindel vor der eigenen Ohnmacht. Vielleicht ist das der tiefste Schrecken: nicht das Nichts nach dem Tod, sondern das Unvermögen, das Unbekannte in Worte zu fassen und es dadurch zu bändigen.
Hmmmmmm
Dann bleibt nur, es auszuhalten.
Ja, Gefühle nicht ausdrücken zu können, erzeugt Schwindel. Das ist der Umkehrschluss meines Satzes.
Vielleicht ist es auch gerade die Sprache, die das Unbekannte erst erschafft.
Auf Utopien trifft das sicher zu. Im Allgemeinen wird aber eher eine alte Sache umbenannt und dann als Neuigkeit verkauft.
Das macht’s dem Marketingteam zwar schwerer, aber für den Auftraggeber ist das natürlich um einiges zeitschonender.
Aber nicht immer kostengünstiger.