Liebe Einzelne, liebe Gemeinde,
wie Musikalität oder Gelenkigkeit, so ist auch die Begabung, das Leben aushalten zu können, ungerecht verteilt, und selbst wer diese Begabung besitzt, der muss sie trainieren, wie er ja auch mit Etüden das Klavier beackern oder mit Sport den eigenen Körper quälen muss, damit solche Talente nicht verkümmern.
Jedem, dem sein Leben nicht passt, dem steht es frei, sich umzubringen, statt andere Sinnsucher mit seinen Macken zu belästigen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist es, Leute zu suchen und zu finden, die auf eine ähnliche Weise unzufrieden sind, und mit diesen Gleichgesinnten einen Verein oder eine Partei zu gründen, um das Dorf, das Land oder die Welt umzukrempeln. Ganz besonders Tapfere fangen damit sogar bei sich selbst an. Das gilt natürlich gendergerecht gleichermaßen für Frauen und geschlechtlich Unentschiedene, was, einmal gesagt, ab jetzt vorausgesetzt wird.
Wer mit den Zuständen unzufrieden ist, muss sich entscheiden: akzeptieren oder ändern. Schimpfen gehört noch zum Akzeptieren, Auf-die-Straße-gehen schon zur Änderungsabsicht. Beides kann falsch sein, wenn auch nicht gleichzeitig.
Klar, alles das sind Verallgemeinerungen. Sie sind zwar übel, aber unvermeidlich. Wir wissen doch, nicht jeder Indianer will Weißhäute skalpieren, nicht jeder Berliner schiebt sich Eisbein in die freche Schnauze, und nicht jede Republikanerin möchte von Trump by the pussy gegrabbt werden. Warum wollen wir trotzdem einordnen? – Weil es sonst eben keine Ordnung gäbe. Und die meisten von uns fanden ja auch das meiste im Land bis vor Kurzem ganz in Ordnung. Damals wurden sie noch nicht von dem unberechenbaren amerikanischen Präsidenten und den errechenbaren deutschen Statistiken verschreckt. Nun gilt wieder Lampedusa: Alles muss sich ändern, damit es bleiben kann, wie es ist. Darum ist inzwischen jeder, absolut jeder, für den Fortschritt. Die einen verstehen darunter, sich ihren bisherigen Lebenslauf von der KI aufschreiben und den Rest ihrer Zeit von ihr bestimmen zu lassen, die anderen lassen sich jede Substanz spritzen, die gegen die Grippe oder das Altern auf den Markt kommt, und die dritten essen nur noch (von der EU umbenannte) Tofu-Schnitzel, damit keine Wälder mehr für Rinder und deren Steaks abgeholzt werden.
Am schlimmsten sind die Gleichgültigen, oder? Sie setzen sich weder für die Juden noch für die Palästinenser ein und fühlen sich weder gestört, wenn sie in ihrem Stadtbild eine Demo sehen, noch, wenn sie keine sehen, und bei einzelnen Grüppchen von Aus- oder Inländern gucken sie gar nicht erst hin. Schon Dante wusste, dass die ‚Lauen‘ im tiefsten Kreis der Hölle schmoren. Zu denen gehören vermutlich ziemlich viele Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die von links wie von rechts so sehnsüchtig umworben wird.
Was wäre schlimmer: wenn mir alles, was nicht mir selbst passiert, egal wäre, oder wenn ich zu allem, was in der Welt passiert, eine eigene Meinung verträte und mich für deren Umsetzung vehement einsetzte? – Hypothetische Frage. Was mir egal ist, soll gefälligst auch den anderen egal sein: die sexuelle Ausrichtung fremder Leute, die Religion fremder Leute, die Nagellackfarbe fremder Leute. Aber was mir wichtig ist, das sollen die anderen genauso wichtig finden wie ich: sexuelle Ausrichtung, Religion, Nagellackfarbe. Für den Ausbau des Christentums, den Aufbau des Sozialismus oder die Optimierung des eigenen Körpers war den wahrhaft Gläubigen schon immer jedes Mittel recht.
Der eigentümliche Begriff ‚Streitkultur‘ ist von der Wokeness abgelöst worden, die ihrerseits inzwischen als Schimpfwort benutzt wird. Alle sagen alles, und keiner traut sich noch, etwas zu sagen. Was denn nun? – Stimmt schon: Jedes Wort wird möglichst anders ausgelegt, als es gemeint ist, damit es als Aufreger mehr hergibt. War das denn immer so? – Vielleicht. Aber die Informationsdichte heute macht es schwieriger als früher, auszuweichen.

Im Vorspiel zum ‚Faust‘ reimte bereits Goethe:
‚Die Masse könnt Ihr nur durch Masse zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen;
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.‘
Heute gilt: Zufriedenheit macht nicht glücklicher als Wünsche zu haben, sie ist bloß undynamischer. Deshalb sind die meisten erst zufrieden, wenn sie etwas gefunden haben, um so richtig schön unzufrieden sein zu können. Unbewusst? – Vielleicht. Zufriedenheit ist einfach spießig, cringe.

Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama behauptete: „Wenn die Menschen in einer erfolgreichen Demokratie leben, die friedlich und stabil ist, und sie keine Möglichkeit haben, für die Demokratie zu kämpfen, dann werden sie irgendwann gegen die Demokratie kämpfen.“1 Oje! Dann will ich doch lieber die Demokratie vorlaut benörgeln, als vor lauter Zufriedenheit in der Diktatur zu landen. Mein Trost: Mit dem angeblichen ‚Ende der Geschichte‘ hat sich Fukuyama schon mal geirrt, obwohl mir die Umsetzung dieser These viel mehr Spaß gemacht hätte, als weiterhin unzufrieden an der Demokratie rumschustern zu müssen. Zuerst kommt da ein Vorsatz, dann, wenn es gut geht, ein Einsatz, und hier kommt jetzt ein Absatz.
Stimmt schon – zufrieden kann man später im Grab sein, zumindest als Atheist. Gläubige Christen wissen: Nicht alles, was nach dem Tod passieren kann, ist lustig. ‚Gar nichts‘ ist da noch eine der netteren Möglichkeiten. Wer also die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, lieber mit ‚Nein‘ beantwortet, auf den kommen neue Fragen zu:
1) Sind – auf das ganze Leben gesehen – fünftausend überwältigende Orgasmen, ausgelöst durch fünfhundert unterschiedliche Personen, einer fünfzigjährigen langweiligen Ehe vorzuziehen?
2) Wird, gut zu sein, belohnt durch das eigene Wohlgefühl oder durch die Dankbarkeit der Beglückten, die dieses Wohlgefühl womöglich erst entfacht?
3) Soll man zusehen, dieses Leben entweder so ereignisreich oder so einflussreich oder lieber so schmerzfrei wie möglich hinter sich zu bringen?
Also, da ist zu glauben doch einfacher. Vor allem deshalb, weil der Glaube sich mit den Bedürfnissen, Gutes zu tun, Ereignisse zu genießen und Einfluss auszuüben, herrlich verbinden lässt. Das freut die Seele. Dass der – angeblich – rein körperliche Orgasmus außen vor bleiben muss, schreckt die Seele genauso wenig wie die laienhafte Behauptung, dass es sie gar nicht gäbe. ‚Die ewige Seele‘ – ist das tröstlich oder furchteinflößend? Zumindest Grund genug, sich nicht umzubringen, sondern doch lieber andere mit seinen Macken zu belästigen. Das macht zwar wahrscheinlich auch nicht zufriedener, aber vielleicht wenigstens glücklich.
Viel Glück!
Euer Sonntagsredner
Hanno Rinke

Quelle: ‚Neue Zürcher Zeitung‘ vom 11.07.2025, Interview mit Francis Fukuyama
Grafik: Kl-generiert via Midjourney
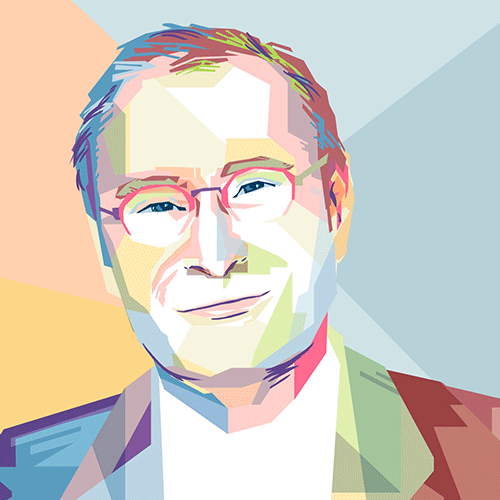
Der Vergleich von Gleichgültigen mit Dantes „Lauen“ hat Wucht, aber vielleicht verwechselt der Text Passivität mit Überforderung. Bei der Informationsflut heute kann Gleichgültigkeit ja auch einfach Selbstschutz sein, nicht moralische Feigheit.
Das konnte Dante natürlich nicht voraussehen. Ohne Auswahl ist Meinungsbildung heute nicht mehr möglich.
Statt Gleichgültigkeit könnte man auch einfach die Informationen nach dem Filtern, was für einen relevant ist. Man muss ja nicht gleich alles ausblenden, nur weil man ein Überangebot hat.
Das Filtern dauert womöglich genauso lange wie die Zur-Kenntnis-Nahme
Ich habe allerdings auch nicht das Gefühl, dass das häufig versucht wird.
Darum bemühe ich mich um neugierig machende Überschriften.
Hahaha! Es gelingt in der Regel, Herr Rinke!
Also, die Polemik gegen Gleichgültige ist herrlich überzogen – und gerade deshalb so treffend. Klar, nicht jeder, der keine Meinung zu Israel-Palästina äußert, ist ein „Lauer“ im dantesken Sinn. Aber diese moralische Erwartungshaltung, zu allem Stellung beziehen zu müssen, ist doch ein Dauerdruck unserer Gegenwart. Schön überspitzt. Ich lese weiter…
Ich muss glaube ich ma Dante lesen
Das schadet sicher nicht.
Wäre heute aber auch nicht mehr meine erste Wahl.
Ich stolpere über die Entweder-Oder-Logik: Umbringen oder Verein gründen. Das ist als rhetorische Provokation gemeint, klar, aber unterschätzt doch ein wenig, wie komplex psychische Krisen und politische Impotenz sind. Der Text spielt für mich etwas gefährlich mit Vereinfachungen.
Solch eine „Provokation“ regt doch zum Nachdenken an, nicht!? Soll das so ein Text nicht gerade?
Vereinfachung ist gefährlich. Unverständlichkeit, weil jede Nuance berücksichtigt werden soll, hilft aber auch nicht weiter.
Nicht nur die Begabung, das Leben aushalten zu können, ist ungerecht verteilt. Auch das Leid, welches uns das Leben zumutet.
Das abzumildern versuchen ja einige Institutionen, es aufzuheben ist unmöglich.
Platt gesagt, das Leben ist ungerecht. Wahr ist das sicher.
Also, ein bisschen gerechter kann man es aber machen. Immer noch.
Der Abschnitt über die ewige Seele hat mich tatsächlich berührt. Nicht, weil ich religiös wäre, sondern weil er das Unbequeme im Denken so gut sichtbar macht: dass der Mensch zwischen Trost und Schrecken pendelt und beides braucht. Ein schöner, fast literarischer Moment inmitten des politischen Gefechts.
Der literarische Moment ist im Literaturblog ja auch gut aufgehoben 😉
Ich glaube, auf den Schrecken könnte ich verzichten. Allerdings wäre das ‚Literarische‘ dann womöglich etwas langweilig.
Ich finde Fukuyama besonders spannend. Der Text suggeriert, dass wir in Demokratien paradoxerweise revoltieren, sobald uns das stabile Leben zu gemütlich wird. Das trifft einen wichtigen Punkt: politische Erregung ersetzt oft politische Handlung. Gleichzeitig muss man ergänzen, dass viele Menschen heute nicht aus Langeweile frustriert sind, sondern aus echter materieller Unsicherheit. Das fehlt mir als Gegenpol. Trotzdem eine scharfe Beobachtung über den „Zwang zur Haltung“, der uns alle überfordert.
Die Inflation drückt definitiv auf den Geldbeutel.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich die Zentralbank über einen Mangel an Inflation Sorgen machte.
Ich lese den Text vor allem als Plädoyer dafür, das Chaos der Welt nicht zu scheuen. Das finde ich sympathisch. Es tut gut, wenn jemand zugibt, dass wir alle zwischen Aktivismus und Überdruss hin- und herfallen, ohne dass daraus gleich eine moralische Abrechnung wird.
Eingeständnis ist manchmal Moral genug.
Und meistens ist es heute ja eh nur performativer Social Media Aktivismus.
Der Ausdruck gefällt mir!
„Akzeptieren oder ändern“ klingt gut, aber ehrlich gesagt: Die meisten von uns schaffen es ja nicht mal, ihr E-Mail-Postfach zu sortieren. Der Text tut so, als wäre politische Handlung ein Fitnessstudio, in das man einfach öfter müsste. So funktioniert’s leider nicht.Die Hanteln heißen Inflation, Krieg, Klimaangst.
Und die Alternative? Alles egal?
Die einen betrachten das ganze Leben als Finessstudio für Körper, Geist und Seele, die anderen gehen in die Kirche, und Dritte entscheiden von Fall zu Fall.
Hmmm, die Fragen am Ende über Ereignisdichte, Einfluss und Schmerzfreiheit fassen im Grunde doch drei sehr unterschiedliche Lebensentwürfe zusammen. Interessant, dass der Text sie nicht hierarchisiert, sondern lediglich nebeneinanderstellt.
Da spielen auch Begabung und Bewusstsein eine Rolle.
Interessant, wie das Motiv der „Ordnung“ als psychologisches Bedürfnis gefasst wird.
Das liegt aber eigentlich doch ziemlich auf der Hand, finden Sie nicht?
So beginnt ja schon die Bibel: mit der Bändigung des Tohuwabohu.
Und ein paar tausend Jahre später sind wir dennoch nicht viel weiter…
Ein paar Unterschiede zur Steinzeit nehme ich aber doch wahr.
Was am meisten hängenbleibt, ist der subtile Vorwurf an die Gegenwart, sie wisse mit Frieden und Stabilität nicht umzugehen. Doch diese Diagnose ignoriert, dass viele der heutigen Konflikte eben nicht aus Langeweile entstehen, sondern aus einer Gemengelage aus globalen Krisen, sozialen Brüchen und politischem Misstrauen. Der Text zeigt für mich schön, wie gern wir die Komplexität unserer Zeit auf psychologische Muster reduzieren. Aber gerade diese Reduktion ist auch Teil des Problems: Sie macht die Wirklichkeit handlicher, aber eben auch harmloser.
Viele Menschen würden es ‚harmvoller‘ gar nicht aushalten.
Tja, wir vereinfachen, weil wir es müssen. Und stolpern dann darüber, dass die Vereinfachung selbst wieder zu kurz greift.
Manche stolpern aber nicht, sondern gehen einfach weiter, wohin auch immer.
Fängt die AfD eigentlich auch bei sich selbst an? Ich frage für einen Freund.
Leider nein. Die anderen sind immer schuld.
Das gilt leider nicht nur für die AfD. Weider hat immerhin Russland-Reisen aus ihrer Partei beanstandet. Spahn sieht seinen Masken-Kauf den Umständen geschuldet.
Da haben Sie sicher recht. Unser Kanzler Merz schaut ja auch lieber auf das Stadt ild als auf sich selbst.
Er muss ja die zuvor zur AfD abgewanderten Wähler zurückgewinnen.
So???
Ihre Kritik am Begriff der „Streitkultur“ hat Witz und trifft dennoch etwas Ernstes: dass wir in einer Zeit leben, in der alle alles sagen dürfen, aber alle gleichzeitig Angst haben, gehört zu werden. Das hätte ich gern noch weiter ausgeführt gesehen. Der Text kratzt hier an einem zentralen Nerv unserer Kommunikation; und Sie haben ohne Frage ein feines Gespür dafür, wie paradox unsere Offenheit eigentlich ist.
Ausführlicher sind Bücher. Blogs kratzen eben nur.
Das wichtige ist ja trotzdem der erste Kratzer. Alles andere folgt dann durch das geweckte Interesse.
Und wer sich viel Wissen erworben hat, darf dann auch ein bisschen aufgekratzt sein, während die anderen noch brüten.
Ich habe Ihren Text gelesen wie jemanden, der mitten im Gespräch plötzlich die Tür aufreißt – ungefragt, direkt, aber genau deshalb erfrischend. Diese Art von Einstieg bekommt man selten: eine klare Behauptung, die weder höflich einbettet noch entschuldigt, sondern sofort ins Thema zieht.
Was mich besonders angesprochen hat, ist Ihre Fähigkeit, politische, existenzielle und alltägliche Fragen in einem Atemzug zu verhandeln, ohne so zu tun, als gäbe es dafür eine einheitliche Lösung. Ihre Beobachtung, dass wir heute aus lauter Angst vor Stillstand jede Form von „Fortschritt“ mitmachen, ist scharf – und gleichzeitig erstaunlich tröstlich. Man fühlt sich ertappt, aber nicht verurteilt.
Auch der Umgang mit Unzufriedenheit gefällt mir: Sie stellen sie nicht als Schwäche dar, sondern als eine Art inneres Frühwarnsystem. Das ist ein Blick, der selten geworden ist. Die Ironie in Ihrem Text stützt das sogar, weil sie zeigt, dass Nachdenken nicht trocken sein muss.
Für Ihre Einschätzung danke ich Ihren. An den kommenden Sonntagen werde ich weitere Türen aufreißen1
Herr Rinke, wie schön, dass Sie zurück sind!
Ich freue mich auch, dass Sie wieder dabei sind!
Ich schließe mich gleich mal an. Sie haben mir gefehlt!
Ich musste an mehreren Stellen laut lachen, einfach weil die Mischung aus Ernst und Frechheit so gut funktioniert. Besonders die kleinen Seitenhiebe schaffen eine Atmosphäre, in der man sich als Leser nicht zurücklehnen kann. Ich habe das Gefühl, Sie sprechen weniger zu einem Publikum als zu einem Gegenüber, und genau das macht die Lektüre lebendig. Man liest weiter, weil man wissen will, wohin Sie als Nächstes abbiegen.
Die kleinen Seitenwechsel, mal humorvoll, mal ernst, haben mich wirklich bei der Stange gehalten. Man weiß nie ganz, wohin der Absatz führt.
So wie man es von Rinke gewöhnt ist.
Und so soll es auch bleiben – Sonntag für Sonntag.
Das ist doch mal ein Wort!
Ich habe fast zufällig auf den Blog geschaut und gesehen, dass die Predigten gerade wieder zu starten scheinen. Hoffentlich für eine Weile. Sie haben mir gefehlt 😉
Bis das Jahr zu Ende geht, geht mir der Stoff nicht aus.
Das freut mich so. Für das nächste Jahr gibt es doch bestimmt auch viel zu schreiben. Die Themen scheinen jedenfalls nie auszubleiben.
Sonst könnte man sie ja erfinden, aber dazu kommt man gar nicht.
Endlich weiß ich, warum die Gegenwart so gestresst ist: zu wenig Langeweiletraining 😂
Lageweile zu erlernen ist mühsam und erfordert viel Ausdauer. Ich habe es bisher noch nicht geschafft!
Sie zu erfahren geht ja einfach. Das Ertragenkönnen schwieriger.
Langweilig ist immer die anderen. Man selbst ist doch interessant!
Vielleicht ist das auch das wahre Problem unserer Existenz, dass uns die Realität keine Bedienungsanleitung mitliefert.
Man könnte fast meinen, die Gegenwart hätte einfach nur ein schlechtes Zeitmanagement: erst globale Krisen horten, dann psychologische Deutungen drüberkippen und am Ende wundern, warum alles klebt. Vielleicht bräuchte sie einfach mal einen Kurs in „Komplexität für Anfänger“.
(Wenn schon die Bedienungsanleitung fehlt…)
Die Gegenwart ist jedenfalls anstrengend. Keine Ahnung ob das allen Generationen immer gleich geht.
Die eigene Gegenwart wird wohl oft als belastend erlebt. Warum meine Altersgenossen, die 68er, sich so aufregten, habe ich aus meinem – vielleicht ziemlich ungewöhnlichen – Elternhaus heraus nie so recht verstanden und in ‚Über Leben‘ darüber ausführlich geschrieben. Die Zeit jetzt kommt mir dagegen tatsächlich extrem schwierig und konfliktreich vor.
Ich glaube auch, dass diese Einschätzung keiner großen Diskussion bedarf. Die Regierung denkt nicht umsonst über eine neue Wehrpflicht nach. Die politischen Konflikte werden größer und gefährlicher, die Allianzen schwächeln.