Liebe Leserinnen und Leser!
Schon vier Jahre war ich alt, fast, da merkte ich: Ich kann denken. Den Geburtstag selbst – mit meiner Mutter auf Rügen – habe ich in plastischer Erinnerung. Ich weiß auch noch, welches Bilderbuch ich geschenkt bekam: das vom Jungen, der ausreißt und es bitter bereut. Um ein Haar wäre er von einem Krokodil gefressen worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir etwas Ähnliches zustoßen könnte, war ja damals auf Rügen, im sowjetisch besetzten Ostdeutschland, nicht besonders groß; trotzdem habe ich mich aufgrund dieses mahnenden Beispiels nie für längere Zeit aus der Obhut meiner Eltern entfernt, so übel ich ihnen oder mir das auch zeitweise nehmen mochte. Denken, das ist Erinnerung plus Schlussfolgerung. So empfand ich es damals. Die Formulierung dazu fiel mir allerdings erst jetzt ein: 2024.
Der Junge, der gerade mal so eben einem Krokodil entkommt, war mir eine Warnung. ‚Vorbild‘ kann man das ja wohl nicht nennen. Als ich größer wurde (eigentlich blieb ich klein), trichterte mir meine Großmutter, immer wenn sie bei uns war (und das war nicht selten), ihre Art von Katholizismus ein. Meine Eltern fanden das rührend und wehrten weder sich noch mich dagegen. Zu Weihnachten und Ostern gingen sie sogar mit in die Kirche. Für meine Eltern wollte ich gut sein in der Schule, für Gott gut auf Erden. Jesus als Vorbild? – Der war mir doch zu fern.
Mit achtzehn war es mir immerhin gelungen, zu wachsen. Wenn meine Mutter ganz flache Absätze trug und ich mir die Haare ordentlich toupierte, waren wir ungefähr gleich groß. Mein Vater schaffte das nicht: wegen seiner Glatze. „Wenn ich mich auf mein Portemonnaie stelle, bin ich zehn Zentimeter größer“, sagte er mal. Er konnte solche Scherze machen. Seine Selbstironie war vorbildhaft. Großkotzig wirkte er nie.
In der Schule wurde uns eingeredet, wir müssten immer eine Antwort parat haben, wenn wir gefragt würden, wer unser Vorbild sei. Im Allgemeinen lief es dann auf Albert Schweitzer hinaus. Den älteren Lehrern war auf unangenehme Weise deutlich geworden, dass das bis vor Kurzem angesagte Vorbild Adolf Hitler nicht mehr vermittelbar war; die jungen Kollegen wollten dringend etwas, das nicht politisch, sondern karitativ war. Meine Eltern machten sich lustig darüber, also ich mich auch. Wahrscheinlich war das ungerecht dem segensreichen Albert Schweitzer gegenüber, aber meine aus ganz unterschiedlichen Lagen und Lagern zueinander gekommenen Eltern hatten wohl nur noch so wenig Vertrauen in ihre jeweiligen ehemaligen Vorbilder, dass sie mir überhaupt keine anerzogen. Was sie mir vorlebten, musste reichen.
Trotzdem habe ich versucht, mir ein paar Vorbilder einzureden. So mit 16. Als Ausrede. Es gab seit einiger Zeit bestimmte Männer – die gefielen mir einfach. So wie der möchte ich werden, darum gefällt er mir, hoffte ich, mir weismachen zu können. Es handelte sich dabei niemals um bejubelte, stramme Toreschießer, sondern um schlanke Schauspieler, manchmal in Nebenrollen. Na ja, schlank war ich auch, und das Schauspielern – anderen etwas vorzumachen –, versuchte ich zu üben. Dass ich an mir persönlich damit scheitern würde, lernte ich schnell. Früh musste ich erkennen, dass ich kein Talent zum Selbstbetrug hatte. Ich wollte gar nicht sein wie diese Männer. Damals hätte ich formuliert: Den hätte ich gern zum Freund. Aber wissen tat ich: Ich bin geil auf den.
Dann war Schluss mit der Suche nach Vorbildern. Ich imitierte Beethovens Sonaten (ein paar von meinen sind besser als seine schlechten) und Daphne du Mauriers Erzählaufbau (klingt für seriöse Literaten nicht sehr anspruchsvoll). Ich hätte gern eine Stimme ähnlich der von Udo Jürgens gehabt, um meine eigenen Versuche in Richtung Pop-Musik besser vermarkten zu können. Ich sah mir genau an, wie Menschen waren, die Karriere machten, und überlegte mir, woran es lag, dass andere es nicht schafften. Als ‚Vorbild‘ habe ich nie jemanden empfunden, aber das ist vielleicht nichts als die Auslegung eines Wortes. Ein Vorbild zu haben, darauf kann man stolz sein oder ist es zumindest. Stolz bin ich darauf, niemals Fan gewesen zu sein. Fan zu sein, geht gar nicht.
Menschen, die mich noch aus meiner Caterina-Valente-Zeit (ich war 10) oder aus meiner Shirley-Bassey-Zeit kennen (ich war 20), dürfen einen zurechtweisenden Kommentar zu diesem Rundbrief schreiben, aber ich vertraue darauf, dass das nicht passieren wird oder mir zumindest eine pfiffige Entgegnung einfallen würde.
Fans sind Leute, die heute für Elvis Presley schwärmen und morgen für Donald Trump. Sie schmeißen vor Wut mit Bierdosen, wenn Concordia Dortmund gegen Eintracht Duisburg verliert, und reisen der Wozzalena Pobakowitsch hinterher, wenn die in Cincinnati die Desdemona gibt. Mein Beruf brachte es mit sich, dass ich Backstage andrängende Fans immer wieder mal abzuwimmeln hatte und mich dabei eisern zwingen musste, sie zu mögen, weil sie gut fürs Geschäft waren – und vor allem, weil sie liebenswerte, begeisterte Menschen waren. Eigentlich wusste ich das ja, aber im Stress erschienen sie mir manchmal ein wenig aufdringlich.
#MeToo hat das Repertoire deutlich erweitert. Mein Idol hat vergewaltigt: wird behauptet. Was überwiegt? Die Enttäuschung, anbetungslos auf dem Trockenen zu sitzen, oder die Lust, auftrumpfend in der Sensation zu baden? Gemischte Gefühle. Einfacher ist es, die Beschuldiger als Lügner zu schmähen, als sich sein Idol aus dem Herzen zu reißen: deutlich befriedigender. Lady Di – eine verletzte Frau, die am kaltherzigen Königshaus zerbrach, oder eine skrupellose Jetset-Zicke, die an ihrem selbstgebastelten Image zugrunde ging? Bewunderung und Glauben hängen eng zusammen. Wer keine Idole hat, ist sicher objektiver. Ist er auch ärmer?
Ich hätte ja privat für alles Mögliche Erlaubte oder Nichtnachzuweisende schwärmen dürfen. Bei meiner Arbeit wäre das unprofessionell gewesen. Als erkennbarer Fan hätte ich weder den Künstler noch die Firma angemessen beraten und vertreten können.
Vorbilder sind etwas Gutes, wenn sie gut sind. – Auslegungssache, was das bedeutet. Es gefällt mir nicht, dass Fans heute die Welt beherrschen. Ihre Likes, ihre Schmähungen regieren das ‚soziale‘ Leben, und über die Wahlurne greifen sie in die Politik ein. Auch Ideologien hatten immer ihre Fans. Jede Utopie braucht einen Heilsbringer, der das abstrakte Zukunftsversprechen personalisiert. Hitler, Stalin und Mao wurden angehimmelt. Für ihren Schwarm gingen die Fans durchs Feuer oder darin unter. Dass sich nach Faschismus und Kommunismus meine Gleichaltrigen 1968 schon wieder ideologisieren ließen und ‚Ho, Ho, Ho Chi Minh‘ den Ku’damm entlang grölten, habe ich nie verstanden, eigentlich sogar verachtet. Das war damals sicher falsch von mir, aber man kann sich seine Verachtungen ja nicht aussuchen.
Begeisterung tut gut. Kritiklosigkeit nicht. Ich bin beunruhigt.
Für die Fans meines Blogs gilt all das natürlich nicht.
Ihr Vielschreiber
Hanno Rinke
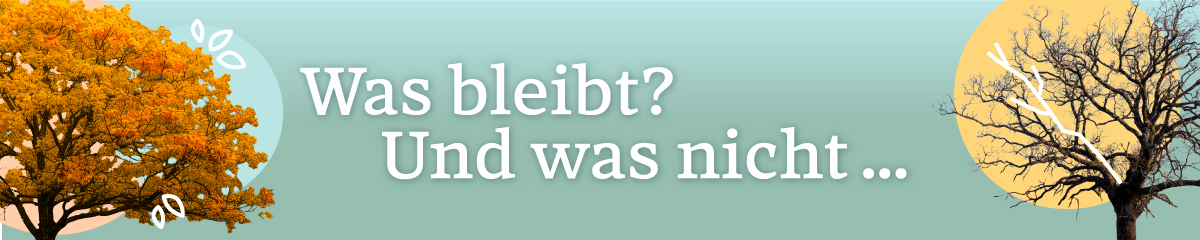
Grafik mit Material von: freepik/freepik, Bild links mit KI generiert

Die totale Objektivität gibt es doch eh nicht. Ob man völlig ohne Idole auskommen kann, sei auch dahingestellt.
Aber klar, bei Ihrer Arbeit war das sicher eine große Hilfe, wenn man sich nicht im schwärmen verliert. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Die Künstler haben ja sicher auch Ergebnisse noch einmal lieber als reine Bewunderung.
idole, tja, ich weiss auch nicht. aber an irgendetwas muss man sich ja immer orientieren.
Vielleicht ist es wirklich eine Definitionsfrage, was man ‚Vorbild‘ nennt. Sich an Werten zu orientieren scheint mir trotzdem im Allgemeinen weiser als an Menschen, aber vielen ist das halt zu abstrakt.
Oft sind solche Werte aber ja an Menschen gebunden bzw. werden entsprechend vorgelebt. Aber man muss wahrscheinlich unterscheiden ob jemand den Dalai Lama verehrt oder Justin Bieber hinterher reist.
Der Unterschied zwischen: ein Vorbild haben und ein Fan sein eben.
Damals Ho-Chi-Minh-Rufe, heute Herzchen und Likes – offenbar kann keine Generation ohne ihre Helden und Antihelden. Heute drückt man Ideologien halt mit Emojis aus. Ob das besser oder schlechter ist? Schwer zu sagen. Immerhin kann man bei Likes einfach weiter scrollen, wenn’s nervt. Aber irgendwie beruhigend, dass wir uns über die Fan-Kultur heute genauso aufregen wie früher über die Demo-Rufe. Zeiten ändern sich, und die Verachtung bleibt konstant!
Oder: Die Zeichen ändern sich, aber der Hype bleibt.
Ich denke, die Ho-Chi-Minh-Rufe 1968 waren eher bewusste Provokation als echte Gläubigkeit. Hypes gibt es erst sein den 90er Jahren. Vorher war das einfach ‚Gewese‘. Dafür gibt es heute keine Schwierigkeiten mehr, sondern bloß noch Herausforderungen.
.
Die Ho-Chi-Minh-Rufe waren Ausdruck einer echten Protestkultur, kein bloßes ‚Gewese‘. Aber der Wandel der Begriffe zeigt natürlich auch, wie sich das Verständnis von Widerstand verändert hat.
Es ging mir nicht um die Absicht der Protestierenden, sondern um den Wandel dessen, was mit dem Begriff ausgedrückt wird.
Die #metoo Anschuldigungen als Unsinn abtun und weitermachen, als wäre nichts gewesen ist auf alle Fälle bequemer, als sich sein Idol aus dem Herzen zu reißen. Aber Spaß macht das auch nicht.
Oft wird doch eh nur bestätigt, was man sich schon lange denkt. Siehe Trump, Epstein, Kanye, Diddy, etc. etc.
Bei den meisten wundert man sich wirklich nicht. Dass auf einmal ein Idol entlarvt wird, von dem man sich so etwas nie hätte denken können, ist wohl selten.
Michael Jacksons Drang zu kleinen Jungen ist für viele seiner Bewunderer genauso ein Tabu wie die Evolutionstheorie für viele Mormonen. Je weniger man jemanden mag, desto lieber traut man ihm Schlimmes zu.
Das stimmt. Und je größer die Bewunderung, desto eher übersieht, oder zweifelt, oder verzeiht man die Verfehlungen.
Mannomann, Trumps „Locker room talk“ kommt in den Sinn. Wobei ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann, dass irgendjemand Bewunderung für diesen Clown aufbringen würde.
Gerade junge Männer scheinen nach wie vor ein Bedürfnis nach „starken“ Führungspersonen zu haben. Warum das so ist, bzw. warum polterndes Auftreten als Stärke empfunden wird, ich weiss es nicht.
Es wird immer von Trumps Unterhaltungswert gesprochen. Im Land des Show-Biz scheint das ein Faktor zu sein. Dass Selenskyj Schauspieler war, hilft ihm auf der internationalen Bühne sicher.
Donald Trumps Unterhaltungswert war zu „The Apprentice“ – Zeiten größer … da hatte er noch ein wenig Selbstironie.
Selbst-Ironie kann Trump sich nicht mehr leisten. Die schätzen seine Fans nicht mehr als ich Stierhoden zum Texas-Frückstück
Bei seinen Auftritten in McDonald’s-Schürze und Müllmannweste könnte er diese allerdings gut brauchen 😉
Die #MeToo-Bewegung war notwendig und lange überfällig. Was da als Konsequenzen folgen muss man eben in Kauf nehmen.
Verfehlungen anzuprangern, ist richtig. Aber schon die Geschichte der christlichen Kirchen zeigt, dass es dabei – in gutem Glauben oder in böser Absicht – zu falschen Anschuldigungen kommen kann, die Existenzen vernichten.
Es ist sicher wahr, dass es im Lauf der Geschichte immer wieder Fälle gab, in denen Unschuldige durch falsche Anschuldigungen schwer getroffen wurden. Und dass es auch in der #MeToo-Bewegung mal zu Missbrauch und überzogenen Anschuldigungen kommen kann, ist sicher kein Geheimnis. Aber das ist ja kein Grund, die Dringlichkeit und Bedeutung der Auseinandersetzung mit sexueller Belästigung infrage zu stellen oder gar herunterzuspielen. Damit meine ich gar nicht unbedingt Sie, Herr Rinke, sondern die Gesellschaft. Dieses Tabu, über sexuellen Missbrauch öffentlich zu sprechen, wurde ohne Frage zu recht in Frage gestellt.
Die Gesellschaft besteht aus Einzelnen. Aber wenn die sich zusammenrotteten und gemeinsam auf Hexenjagt gingen oder Juden als Brunnenvergifter denunzierten, wurde es meistens schrecklich. Wir müssen Vertrauen in unsere Gerichte haben, dass sie Verfehlungen angemessen ahnden. Die Zeiten der ‚Kavaliersdelikte‘ ist – Gott oder der Justiz sei Dank – vorbei.
Eine Anschuldigung im Rahmen von Me Too ist aber ja nun wirklich keine Hexenjagd. Es war einfach ein Moment, in dem offen gesagt wurde, dass man sich als Frau nicht schämen muss vergewaltigt oder missbraucht worden zu sein. Dass daraufhin erst einmal eine große Welle von Fällen öffentlich wird, ist ja selbstverständlich. Im Zweifelsfall glaubt man hoffentlich erst dem Opfer. Genau wie Sie schreiben, kümmern sich dann die Gerichte um Gerechtigkeit.
Dass übergriffiges Verhalten – in unseren westlichen Gesellschaften! – nicht mehr geduldet wird, ist wichtig und richtig. Problematisch finde ich es, wenn jemand – Frau oder Mann – seine Reize bewusst einsetzt und, nachdem das Ziel erreicht ist, in Klagen ausbricht.
Dass der US-Wahlkampf nun auf den Müll gekommen ist,
sagt viel über den Zustand des Westens aus, und das ist leider nicht ironisch gemeint.
Fans sind gut fürs Geschäft, aber nervig. Ich denke immer, wenn ich z.B. auf ein Konzert gehe, dass ich anders bin als die anderen, die nonstop ihr Idol abfilmen. Aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Mich wundert es jedenfalls immer, wenn man Stars sieht, die ihre Fans tatsächlich zu lieben scheinen.
Lieben die nicht eher den Erfolg und den von den Fans ermöglichten Lifestyle?
Wahrscheinlich können die das ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr voneinander unterscheiden.
So ein Erfolg wie der von Taylor Swift ist für mich genauso unvorstellbar wie die Unendlichkeit von Zeit und Raum. Hätte es das zu Mozarts Zeiten schon gegeben, hätte er Maria Theresia Schönbrunn abgekauft.
Man fragt sich, was kommt danach? Größer kann es ja nicht mehr werden.
Die Dinosaurier konnten auch immer größer werden.
Ich verstehe Ihre Skepsis gegenüber der Fan-Kultur und der oft unkritischen Idealisierung von Persönlichkeiten. Der Einfluss von Fans und ihren „Likes“ hat zweifellos die Mechanismen des sozialen Lebens und der Politik verändert. Oft geht es um schnelle Zustimmung oder Ablehnung, nicht um tiefes Verständnis. Doch für viele ist diese Bindung an Idole auch Ausdruck von Zugehörigkeit oder Identitätssuche in einer fragmentierten Welt.
Vielleicht liegt die Herausforderung nicht im Prinzip von Vorbildern, sondern darin, wie wir lernen, zwischen Inspiration und Idealisierung zu unterscheiden. Ideologien waren – und sind – oft verlockend, weil sie scheinbar einfache Antworten auf komplexe Fragen geben und Menschen das Gefühl, „richtig“ zu handeln. Doch wenn die eigene Perspektive erstarrt, wird jede Form von „Fan-Sein“ problematisch.
Aber ob sich ein „Fan“ mit solchen Fragen auseinandersetzt… !?
Sicher nicht. Fan-Sein und Auseinandersetzung widersprechen einander. Entscheidend ist der von BlogGremlin angesprochene Unterschied zwischen Inspiration und Idealisierung. Wird es mir als Rassismus ausgelegt, wenn ich mich wundere, dass sich Hooligans gegenseitig verprügeln, weil sie für zwei unterschiedliche Clubs einstehen, die in zwei nebeneinander liegenden Städten beheimatet sind und jeweils Spieler haben, die von überall her stammen, aber nicht von dort? Das ist weder Inspiration noch Idealisierung, sondern Identifikation mit einem Hirngespinst – oder einfach eine Ausrede, um sich zu kloppen.
Fan-Sein heißt ja nicht unbedingt, das Hirn an der Stadionkasse abzugeben!
Nein. Aber Hooligan sein schon eher.
„und das Schauspielern – anderen etwas vorzumachen –, versuchte ich zu üben“
😂😂😂
…mit wechselhaftem Erfolg, aber edlen Absichten.
Ich las erst karikativ, aber karitativ macht dann doch mehr Sinn. Und karikaturesk wäre außerdem wohl richtiger.
Ich glaube, ich habe zuerst auch ‚karikativ‘ geschrieben, den Fehler aber beim Durchlesen bemerkt. Im übrigen fände ich urig-karikaturig etwas bodenständiger als karikaturesk.
Idole waren meine Sache nicht, und dass Freunde schwarze Krawatten trugen, als Elvis das Zeitliche segnete, fand ich interessant, aber nicht nachahmenswert. Natürlich gab es Musiker, die mich begeisterten und Sänger wie Fritz Wunderlich oder Mario Lanza, trugen mit zu meiner Entscheidung bei, Musik zu studieren. Während des Studiums wurden bekamen sie allerdings starke Konkurrenz durch Steve Winwood und Otis Redding. Wenn das damals nicht zu spießig geklungen hätte, wären sie wohl durchaus unter dem Label „Vorbilder“ einzuordnen gewesen. Heute haben junge Menschen es sehr viel einfacher, sie können im Zweifelsfall auf Anglizismen zurückgreifen. Role model klänge unverdächtig und das ist es, was wir ja alle in unserer Entwicklung brauchten.
Role Models, vielleicht ist das auch einfach nur ein neuer Name für dasselbe alte Bedürfnis: ein wenig Inspiration, ein wenig Anleitung fürs Leben.
Das brauchen die jungen Leute doch mehr denn je. Gerade wo die Kirche immer weniger eine Rolle spielt.
Ich würde auch 2024 Otis Redding der Kirche vorziehen. Egal welches Label man dafür verwendet.
Bewundern kann ich alles, was mir gefällt, vom Schmetterling bis zum Stabhochspringer. Aber als Vorbild kann mir nur jemand dienen, dessen Qualitäten ich mit Anstrengung erreichen kann. Da fällt – bei meiner Stimme – Otis Redding für mich aus. Solange ich auch on the dock of the bay sitzen mag: es kommt nur Krächtzen dabei raus.
Manchmal reichen ja auch schon kleinere Eigenschaften, die man kopieren kann. Zum Genie reicht es bei den meisten von uns ja eh nicht.
Aber selbst ein Genie, das nicht an sich arbeitet, erreicht nur wenig.