>> ZWISCHEN WEGDÖSEN UND AUFSTEHEN <<
Schlagerweisheiten
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Ist 11 Uhr spät? – Fürs Frühstück ja, fürs Mittagessen nicht. Zeit ist relativ. Das, was ich noch ‚Morgen‘ nenne, nennen andere bereits anders. Obendrein beginnt heute die Sommerzeit. Da war es um zehn erst neun. Lässt mich an sich kalt. Sowieso schon zwinge ich mich im Aufstehen, sachlich zu denken, pflichtbewusst, ernsthaft. Das wichtigste Instrument, um die Dimension einer Ernsthaftigkeit ausloten zu können, ist die Albernheit, und deshalb bediene ich mich ihrer regelmäßig. So kommt mir als erstes Petula Clark in den Sinn. Als ich mich 1967 zum ersten Mal – selbstverständlich in weiblicher Begleitung – über sechs bedrohliche Stufen in ein schummriges Lokal auf St. Pauli hinuntertraute, in dem salopp gekleidete Herren saßen, die darauf hofften, von anderen salopp gekleideten Herren angesprochen zu werden, sang im Hintergrund ‚Pet‘ Clark auf Deutsch ein Lied, in dem das Sterben vorkam. Von ihrer Muttersprache her war sie das durchaus gewohnt, weil in zünftigen Lovesongs der Reim ‚Without you I must die‘ auf ‚Without you I must cry‘ zum unverzichtbaren Repertoire gehört. Im deutschen Schlager war es damals hingegen unüblich, das Sterben zu thematisieren, weil die Liebe und das Leben als verkaufsfördernder galten als der Tod, den allerdings die in der Kellerbar anwesenden Gäste zumindest vom Krieg her, in dem er ja besonders häufig vorkommt, altersmäßig kaum in Erinnerung haben konnten. Während dort also die meisten Ausschauhaltenden gediegen freizeitlich angezogen waren, hatte sich einer richtig in Schale geworfen, sodass Kathrin und ich ihn den ‚Hosenanzug‘ nannten. Die unsägliche Bürgerlichkeit des Ambiente und die unausgesprochenen Wünsche der Anwesenden bildeten eine Symbiose, an die ich mich mit leichtem Ekel gern erinnere. Miss Clark sang dazu:
„Alle Leute wollen in den Himmel, aber sterben woll’n sie nicht, oh no, das woll’n sie nicht, oh no, das woll’n sie nicht, alle Leute wollen in den Himmel, aber wann und wie und wo – das ist das, das ist das, das ist das Risiko.“
Ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass zur gleichen Zeit selbst in deutscher Sprache Profunderes zu diesem Thema, das jeden angeht, gesagt worden ist, wenn auch immer seltener an den Universitäten, in denen es vorzugsweise darum ging, das gegenwärtige Leben in der Bundesrepublik und in Nicaragua an Ideologien anzupassen, die sehr genau wussten, wie der zukünftige Mensch glücklich zu sein habe. Da musste ich mich als aufgeschlossener Jungwähler mit Gedankengängen beschäftigten, die postulierten: ‚Das Individuum hat nur damit einen Lebens- und damit auch einen Todes-Sinn, als es sich in den Geschichts- und Gesellschaftszusammenhang integriert.‘ (Arnold Gehlen) Ich war bereits damals uneinsichtig und habe die zunehmende Schrumpfung meines Lernprozesses zielstrebig weiterverfolgt. Noch heute leuchtet mir weniger ein, dass das Individuum sich in den Gesellschaftszusammenhang integrieren möchte, als dass es vorzugsweise in so etwas wie den Himmel kommen will. Den Himmel auf Erden im Sozialismus zu errichten, wäre mir damals, als diese Aussicht vielen Studenten notwendig oder zumindest fortschrittlich erschien, nicht eingefallen. Ich wusste, dass der kommunistische Norden den Vietnamkrieg ausgelöst hatte und nicht der demokratische Süden. Aber die Wahrheit zählt nicht, wenn der Überschwang sich ein Ziel sucht. Da kann man dann auch behaupten, dass die Ukraine Russland angegriffen oder zumindest provoziert hätte. Nun wird wieder ideologiebedingt gestorben, aber ohne ein Bewusstsein dafür, wie es danach weitergehen soll: weder im Himmel noch auf Erden.
Die Generation Z (Geburtenjahrgänge ab 1998) nähere sich erneut dem Sozialismus an, heißt es. Es heißt ja immer irgendwas, und die meisten von denen, die den Faschismus heraufziehen sehen, wissen überhaupt nicht, was Faschismus bedeutet. Hauptsache ankämpfen gegen ein selbstgewähltes Übel. ‚Du bist ein Faschist!‘ bedeutet eigentlich nur noch ‚Du bist ein Arschloch!‘. Die ohne Internet aufgewachsenen Angehörigen der Loser-Generationen A bis Y müssen sich von den entflammten Vordenkern aus Z sagen lassen, dass sie Imperialisten und Rassisten seien. Zuhören müssen sie nicht.
Obwohl: Stimmt schon, Autokratien sind im Aufwind. Gründe dafür gibt es genug: Die Demokratie ist nun mal schlecht. Aber etwas Besseres fällt mir auch nicht ein. Einfältige Nachfolger von Friedrich II. auf dem preußischen Thron glaubten womöglich selbst daran, von Gott eingesetzt worden zu sein. Die meisten ihrer Untertanen dachten das erst recht: Gottesgnadentum. Dabei steht fest: Die Gefahr, dass ein – dann auch wieder von Gott erwählter – Nachkomme des verblichenen Monarchen es vermurkst, ist größer als die Gefahr, dass mündige Wähler es vermurksen. Hoffen wir. Wir hoffen so vieles und begnügen uns dann doch mit dem, was kommt: das Wetter, der Schiedsspruch, die Quote.
In sehr viel weniger plüschigem Ambiente als in jener zahm-verruchten Kellerbar auf St. Pauli hat mich später überall zwischen Amsterdam und San Francisco jahrelang diese banale Zeile gepiesackt: ‚Alle Leute wollen in den Himmel, aber sterben woll’n sie nicht.‘ Damals, damals. Ach, wie viele Sehnsüchtige von dort sind seither gestorben, weil sie in ihre Art von Eros-Himmel wollten, ohne vorher sterben zu müssen! Statt der Seligkeit bekamen sie dann das Aids-Virus. Mit viel Glück zumindest beides, wenn auch nacheinander. Im Gegensatz zu den akademischen Welterklärern Adorno und Marcuse hatte ich bei meinen eigenen Aktivitäten Petula Clark zu Ende gedacht: ‚Aber wie und wann und wo: das ist das, das ist das, das ist das Risiko.‘ Lebenslust und Todeslust. Liebestod und tödliche Liebe: Das sind so seltsame Geschwister, dass ich mir von deren Eltern gar kein Bild machen kann. Sie scheinen mir so ähnlich wie Walfisch und Rollmops.
Petula Clark, die sich doch mit Charlie Chaplins ‚Love, This Is My Song‘ sehr männeranhimmelnd gegeben hatte und es mit ‚Kiss Me Goodbye‘ vollends auf die Spitze trieb, indem sie ihrem entschwindenden Liebhaber auch noch alles Gute wünschte (wobei ich die Zeilen ‚for the last time / pretend you are mine‘ wirklich immer sehr ergreifend fand), war natürlich das rote Tuch für alle, die dauernd mit roten Fahnen rumliefen und obligatorisch Janis Joplin verehrten, die zwar auch ich in ihrer hemmungslosen Kratzbürstigkeit mochte, aber – let’s face it – die sich doch mit ihrem Alkohol- und Drogenkonsum dem Tod sehr willfährig angedient hatte. Er schnappte sie sich ganz flink. Das brauchte vom abschließenden Protokoll der Pathologie nicht unterstrichen zu werden. Auch für die Frauenbewegung ist Petula Clark eine Schlager-Tussi und Janis Joplin eine Ikone. Falls man allerdings Probleme mit dem Glauben an ein Leben nach dem Tod hat, dann ist Petula Clark mit satten 92 Jahren in ihrer französischen Villa unbestreitbar in einer komfortableren Situation als viele Weltverbesserer, deren Engagement ihnen wertvoller ist als ein Landsitz an der Côte d’Azur. Bewunderns-, aber nicht nachahmenswert.
Untadelige Gutmenschen waren mir nie ein Vorbild für meinen eigenen Lebenswandel. Meine Mutter hatte leicht ironisch konstatiert: „Man muss das Laster kennen, um es verachten zu können!“, und meinem Vater gefiel dieser Ausspruch. Dabei waren meine Eltern wirklich keine lasterhaften Menschen. Mein – zeitweise vehementer – Katholizismus kam ihnen wohl rührend bis seltsam vor. Weiß Gott! In Abwandlung des Zitats meiner Mutter und ganz ohne Ironie sage ich: „Man muss den Rausch erlebt haben, um ihm bewusst entsagen zu können.“ Ohne Rausch ist das Leben zu ertragen, aber nicht zu verstehen. Die einen berauschen sich öffentlich an ihrer Vision einer gleichberechtigten, also gleichgeschalteten, Menschheit, die anderen ganz privat an irgendwelchen bewusstseinsbeeinflussenden Drogen. Ob Unberauschte imstande sind, die Welt vor den religiös oder anderweitig Fehlgeleiteten zu retten, ist ungewiss.
Wer die Wirklichkeit nicht aushält und nichts ändern kann, der will fliehen. Aus dem Gefängnis wird überwiegend im Film geflohen, aus Syrien wirklich. Die Begeisterung der Wunschländer hält sich in Grenzen. Ärztinnen sind willkommener als Schulabbrecher. In der DDR, in der auf Flüchtende geschossen wurde, war der Schnapsverbrauch hoch. Ein Aus-Weg? Das Problem beginnt, wenn die Flucht endet. War die BRD das Risiko wert und der Rausch den Kater? Schon Hamlet sah das Problem nicht im Träumen, sondern im Aufwachen. Das Ärgerliche an Höhepunkten ist eben, dass es anschließend abwärtsgeht, und nicht jeder hat das Glück von Tristan und Isolde, denen Wagner gleich nach dem Orgasmus melodiös mit dem Liebestod winkt. Ab in die Erlösung! Da hatte in der realen Opernpause noch ein Joint auf dem Klo reichen müssen.
Die Cannabis-Freigabe zurückdrehen zu wollen, ist einfach nichts als weltfremd. Man bekommt es doch per Mausklick, per Anruf und an jeder einschlägigen Ecke sowieso. Ich weiß das, ohne davon Gebrauch zu machen. Meine eigene Droge Alkohol ist wohl außerhalb islamistischer Staaten seit der fehlgeschlagenen Prohibition in den USA von 1920 bis 1933 nicht mehr verbotsgefährdet. Die damals groß gewordene Mafia schwenkte sofort ganz flexibel auf Heroin um.
Den Rausch zu vermeiden, muss eine bewusste Entscheidung sein, und selbst dann bleibt unklar: Ist es nicht doch bloß Feigheit? Wer bei seinen Entscheidungen, seien sie für die eigene Erfahrung (beim Sex, beim Sport) oder seien sie für das Wohl der Menschheit (in der Medizin, in der Raumfahrt), den Tod nie (miss)billigend in Kauf genommen hat, der hat das Lebenmüssen – von mir aus auch Lebendürfen – nicht ausgereizt. Mein Hausarzt rät mir zu ‚Ekstasen der Nüchternheit‘, was interessant klingt, aber es nicht ist. Das Gegenteil von Rausch wäre Vernunft. Wie vernünftig ist es, sein Leben lang vernünftig gewesen zu sein? Diese Frage werde ich mir aus ungegebenem Anlass während des Sterbens nicht stellen müssen, vorher also erst recht nicht. Wird das Abtreten später dann so sein wie bei der Narkose: die eher lustige Gewissheit, gleich weg zu sein? Na ja, bei der Narkose ist es eben nicht für immer. Und doch kommt auch vor dem Wegdämmern im OP als würzende Zutat ein bisschen Angst in die Suppe. Wie werde ich wieder aufwachen – wenn überhaupt? Ist angstlos lustlos? Braucht die Lust Angst? Auf dem Motorrad, in der Achterbahn, bei der Partnersuche. Die Furcht davor, endgültig abzutreten. Fußabtreter. Kopfabtreter. Ganzabtreter. Falls nach dem Tod alles vorbei ist, wäre das Gemeinste daran, dass man all den gläubig Gestorbenen nicht mehr rechthaberisch hinterherrufen könnte: „Siehste, du Idiot! Wusst’ ich’s doch. Hier kommt nix mehr.“
Ganz sicher wird tot zu sein bequemer werden, als zu leben es war: Man braucht überhaupt keine Entscheidungen mehr zu treffen! Obwohl mir das eigentlich immer leichtfiel und sogar Spaß gemacht hat. Früher. Jetzt trainiere ich jeden Tag gewissenhaft meine Aktionslosigkeit, um nachher im Grab mit dem Stillliegen keine ‚Schwierigkeiten‘ zu haben. (‚Herausforderungen‘ sagt man dann wohl nicht mehr dazu.) Aber oberhalb der Erdkruste nennt man alles, wovon man glaubt, dass es im Grunde gar nicht geht, ‚eine Herausforderung‘. Das ist so ein richtiges Modewort geworden, und es klingt sympathischer als ‚unmöglich‘. Jedoch: Moden feuern nicht nur an, sie können auch verdrießen.
Im Deutschen muss ich ja schon lange dieses gendernde ‚Innen‘ ertragen: BürgerInnen, WählerInnen, MörderInnen. Der Ärger darüber, dass Gott einen maskulinen Artikel trägt, hat sich bereits in wenig inspirierten Gemälden von Christa am Kreuz ein Ventil geschaffen. Aber noch nie habe ich Feministinnen beklagen gehört, dass ‚der‘ Tod männlich ist. Entweder denken die: ‚So was Gemeines wie Sterben kann sich nur ein Kerl ausgedacht haben‘, oder sie sind kompromissbereit, weil auch ‚das‘ ganz und gar sächliche ‚Leben‘ keinem Geschlecht zugeordnet wird, obwohl es doch ‚die‘ Hauptsache ist. Aber das Große ist ja sowieso nicht wichtig. Es kommt selten vor. Maßgeblich ist das Kleine. Es passiert dauernd.
Ich gehe mit einer Freundin nett essen. Ihr ist nach Feiern. Ich will bloß Wein, aber für sie bestelle ich beim Kellner Champagner. Kurz darauf kommt eine ausländische Frau mit einem Glas auf ihrem Tablett an unseren Tisch und fragt freundlich: „Sekt – für wen?“ Ich zeige jovial auf meine Begleitung und sage: „Für meinen Gast.“ Ganz falsch. Ich bin alt, also unbelehrbar. Dabei weiß ich, dass mein Hinweis weder woke noch cool ist. So etwas formuliert man anders. Eine Auswahl: „Für meine Gästin, bitte“ oder „Das ist für die Dame mir gegenüber“ oder „Für Iris, wir kennen uns seit Juni 1998“ oder „Für die Alte da!“ oder „Is’ mir doch egal!“ oder „Was? Ist das etwa kein ‚Champagner‘?!“ Regeln kenne ich. Wer sie nicht kennt, verstolpert sie bloß. Ich kann sie übertreten. Natürlich gezielt. Meistens halte ich mich an Zuordnungen. Ganz beamtenhaft.
Die Administration hat einen schlechten Ruf: Sie lähmt die Kreativität. Angeblich. Dabei besteht Leben im Katalogisieren: Wir benennen etwas und ordnen es ein. Klänge zum Beispiel. Ein Streichquartett musiziert, ein Orchester macht Musik, eine E-Gitarre macht Radau. Oder: Klassik ist was für alte Leute, Rave hat phatte Beats. Musik verbindet mehr als Worte: im Konzertsaal beim Husten, als Open Air beim Frieren. Unsere unterschiedlichen Einteilungen unterscheiden uns. Unterschiedliche Hautfarben, Werdegänge, Ansichten sind interessant. Unterschiedliche Werte sind irritierend. Ich hatte nie eine Art Klassenbewusstsein. Dafür kamen meine Eltern aus zu unterschiedlichen Welten. Klassenunterschiede lernte ich dagegen schnell: Bei armen Leuten war es immer überheizt, und es gab zu viel zu essen. Bei reichen Leuten war es kühl und die Teller waren halb leer. Eine andere Weisheit, die mir meine Eltern vorlebten, war deren Gewissheit: Format setzt sich durch. Als links galt, sich für die einzusetzen, die kein Format haben. Aber das kann man auch über Stiftungen tun, ohne sein konservatives Weltbild infrage zu stellen.
Tja, wenn man sich zwischen Zahnbürste und Rasierapparat solche feuilletonistischen Gedanken hat durchgehen lassen, dann greift endlich die Erziehung der oberen Mittelschicht und man zwingt sich allmählich, nun doch zu akzeptieren, dass da ein Tag ist, der – mal redlicher Vorarbeiter, mal lasziver Gigolo – darauf wartet, beschäftigt zu werden: gelenkt, geführt, verführt, entführt. Dann bin ich wohl so weit. Nun darf ich nicht weiter träumen, sondern muss leben. Dass ich währenddessen sterben könnte, damit rechne ich nicht mehr, zumindest nicht am heutigen Tag: Ich schlucke Pillen gegen Bluthochdruck und begebe mich nicht mehr in militärische oder sexuelle Krisengebiete. Es scheint mir, dass ich den Tod etwas langweile. Ich langweile nicht gern, aber aufopfern kann man sich halt nur einmal. Deshalb gilt es auch unter Islamisten als sinnvoll, junge Gotteskrieger in den Tod zu schicken und selbst lieber rein strategisch am Laptop tätig zu bleiben. Genug. Um nicht völlig in der Theorie abzusaufen, gehe ich zurück in mein Schlafzimmer und verrichte mich.
Ich habe entweder aufgeräumt oder nicht, gebadet oder nicht und mir etwas angezogen, das immer im Zusammenhang mit dem steht, wem ich begegnen werde, wenn ich mich von Todes Bruder Schlaf losgelöst habe und für die nächsten Stunden halbherzig in die Welt hinaustrete. Wenn es ein einsamer Tag wird, stehen die Chancen schlecht für schicke Garderobe; will ich dagegen Eindruck schinden, mache ich mich zum Pfau und genieße die Lächerlichkeit der Kostümierung. Ich bin großzügig. Ich lade gern ein. Ich mache gern Geschenke: ‚Das letzte Hemd hat keine Taschen.‘ Immer bedaure ich es, dass man aus seinen Träumen nichts mitnehmen kann. Dass man nichts mit ins Grab hineinnehmen kann, finde ich dagegen gerecht, und ich schwanke zwischen Respekt und Belustigung über die uralten Riten, seinen Toten Schätze mitzugeben auf den Weg, von dem keiner weiß, ob es ihn überhaupt gibt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe viel Kraft aus der Hoffnungslosigkeit geschöpft und mochte es, dass mir eine Freundin den Spitznamen ‚Phönix‘ gab. Dass ich schon aufgegeben hatte und doch plötzlich wieder wusste, es geht weiter: der nächste Traum, die nächste Aufgabe, die nächste Erkenntnis, die nächste Möglichkeit, etwas zu tun, was auch anderen, einem Freund, einem Fremden, einer Gruppe Verzweifelnder dabei hilft, sich aufzurichten, das Bett zu verlassen, den Weg zu gehen – ohne erkennbares Ziel, aber mit der Möglichkeit, plötzlich einen Richtungsweiser wahrzunehmen. Solche Augenblicke sind keine Triumphe, aber sie gestatten auf der mühsamen, lehrsamen, heil- und unheilsamen Strecke immer mal wieder kleine Etappensiege:
über den Tod.
September 2010
Leicht angepasst: im März 2025
Und nun verabschiede ich mich von der Prediger-Kanzel mit einem zärtlichen Blick auf meine Gemeinde und einer Melodie, die ich 1986 für meinen aktuellen Jahresfilm geschrieben hatte. Sie war schon damals unmodern, ist also immer noch zeitlos.
Credits: Video mit Soundtrack ‚Boston‘ aus Privatarchiv Hanno Rinke
Mit all meinen guten Wünschen,
Euer
Hanno Rinke
Grafik mit Material der mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH
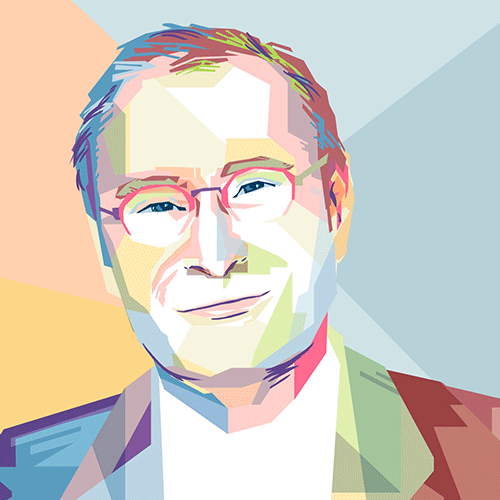


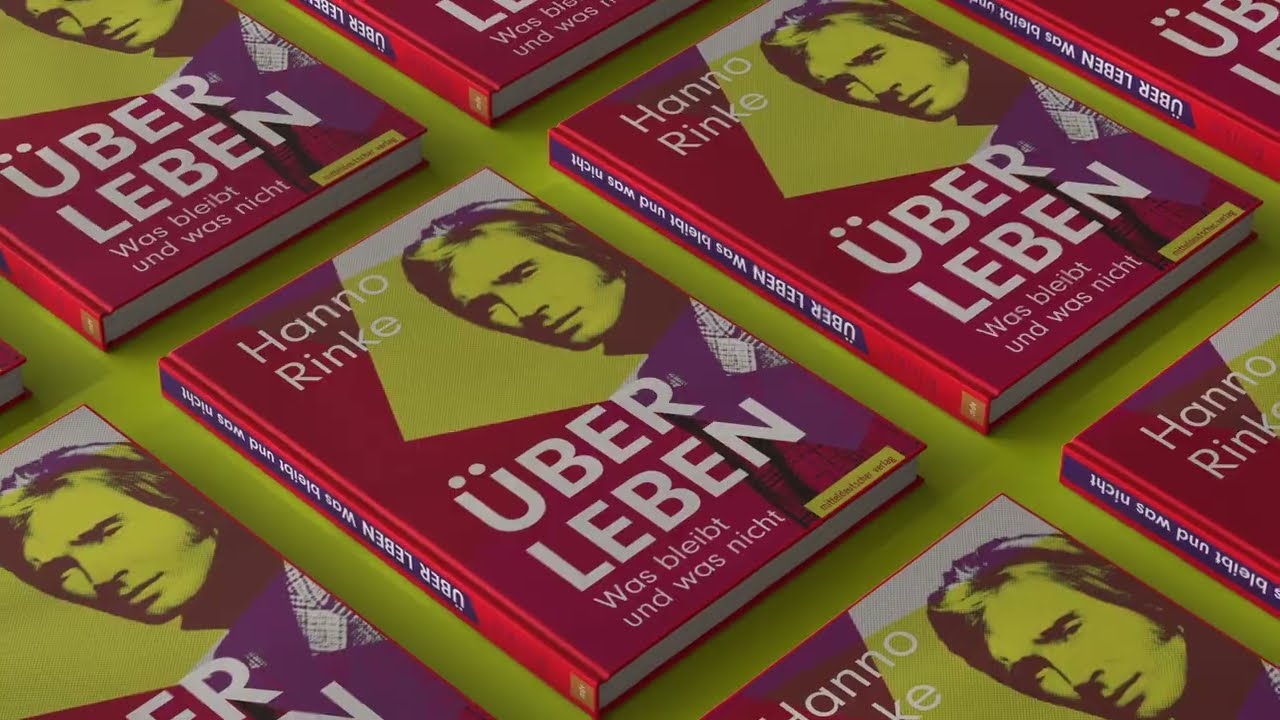
Ach, Heute war die Zeitumstellung! Ich hatte mich schon gewundert.
Mich hat es, wie meistens, auch überrascht. Wird es nicht wikrlich Zeit, dass diese Umstellung abgeschafft wird?
Geld kann, wenn man es richtig einsetzt, glücklich machen. Zeit, wenn man sie hat und richtig einsetzt, auch.
Und welches funktioniert besser?
Charakterfrage.
Ob nun 11 Uhr früh oder spät ist – das ist wohl die kleinste aller Relativitäten in diesem Text. Zwischen Petula Clark, Sozialismus und Rausch stellt sich eher die Frage: Gibt es überhaupt eine Wahrheit, die nicht gerade in Mode ist?
Ich hoffe, dass das noch so ist.
Lieber wäre mir, Sie meinten ’nicht‘.
🤔
11 Uhr ist für den DJ früher als für den Bäcker.
Um zwei schlafen sie beide.
Vierzehn
Ein schöner Abschied! Hoffentlich nicht allzu lange. Wie immer, lieben Dank.
Im Kopf passiert (immer noch) viel. Was davon mitteilenswert ist, wird sich zeigen.
Das bisherige Leseerlebnis lässt daran keine zweifel aufkommen 🙂
…der nächste Traum, die nächste Aufgabe, die nächste Erkenntnis, die nächste Möglichkeit, etwas zu tun…
Warten mit einer Mischung aus Geduld und Ungeduld.
Es ist doch spannend, wie Sprache nicht nur beschreibt, sondern gleichzeitig unsere Realität formt. Die Art, wie man über Dinge schreibt, legt fest, wie sie erinnert werden – und vielleicht sogar, wie sie empfunden wurden.
Auf jeden Fall! Und wenn man dann noch im Kopf hat, wie sich Sprache mit der Zeit immer wieder verändert und weiterentwickelt, wird das Ganze nochmal interessanter.
Interessant schon, nachvollziehbar nicht immer. Daran, dass jetzt ein Kochrezept oder ein Lampenschirm ‚geil‘ sein soll, kann ich mich schwer gewöhnen.
Geil ist ja zum Glück auch schon wieder vorbei.
Bleibt es denn dann wenigstens bei seiner ursprünglichen Bedeutung?
Also die kleinen Details – Geräusche, Blicke, eine bestimmte Körperhaltung – spielen in dem Text scheinbar eine besonders große Rolle. Sie sind oft der Ausgangspunkt für tiefere Reflexionen oder Emotionen, fast so, als wären sie geheime Träger der Erinnerung. Sind diese scheinbar nebensächlichen Momente tatsächlich bedeutungsvoller als das Offensichtliche? Werden sie gezielt gesucht, oder treten sie eher zufällig hervor?
So ist es in Geschichten doch oft.
Die entscheidende Frage, ob der Augenblick wichtiger ist als die Ewigkeit, habe ich bewusst wegelassen. Aber alle, die nicht durch Indoktrinierung oder Folter daran gehindert werden, sollten sich damit beschäftigen.
Das hebt Literatur von den Nachrichten ab 😉
Der kleine Unterschied.
Bei aller Problematik mit übertriebenem Rausch … Ekstase der Nüchternheit klingt wirklich albern.
Es gibt ja genügend Formen des „natürlichen“ Rausches, aber das Wort Nüchternheit passt wirklich nicht.
Ist wohl eher ein Wortspiel. Aber ohne Drogen in Ekstase zu geraten, gelingt manchen schon auf der Fußballtribüne.
Beneidenswert
Jaaa?
Die Formulierung „leicht angepasst“ klingt zunächst unscheinbar, aber sie trägt eine interessante Doppeldeutigkeit in sich. Ist das. gezielt?
Einerseits verweist sie auf eine behutsame Veränderung des Textes – kleine Korrekturen, die vielleicht nur Nuancen verschieben. Andererseits erinnert sie auch an eine subtile gesellschaftliche Anpassung: nicht zu viel, um die eigene Identität zu verlieren, aber auch nicht zu wenig, um nicht anzuecken.
Ist es mit Sprache nicht ähnlich? Schon minimale Änderungen können eine Aussage in eine neue Richtung lenken – so wie eine leichte Anpassung in der Gesellschaft darüber entscheidet, ob man als eigenwillig oder als passend wahrgenommen wird.
#SpracheIstWichtig
Das ‚leicht‘ ist eine leichte Übertreibung. Untertreibung?
Die Administration hat meiner Meinung nach einen schlechten Ruf, weil sie sich oft nur um sich selbst dreht, anstatt den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. Also Administration um der Administration wegen.
Das würden die Administratoren bestreiten. Selbst kafkaeske Zuständen werden von ihren Ausführenden als das Wohl der Menschheit verstanden. Wie ging es wohl Grenzbeamten der DDR, als die Mauer fiel? Ich glaube, ich wäre verrückt geworden.
Die Demokratie ist schlecht, Autokratien sind weitaus schlechter!
Demokratie ist das Beste, was wir haben, weil sie uns immerhin Freiheit, Mitbestimmung und die Möglichkeit zur Veränderung gibt – auch wenn sie nicht immer perfekt ist. Wie Rinke schon schreibt, was wäre denn eine Alternative?
Ich bin ehrlich gesagt geschockt, dass in letzter Zeit so viele Menschen zu glauben scheinen, dass die Demokratie NICHT das beste für uns ist.
Egal wie oft man darüber spricht – es bleibt ein Rätsel.
Es macht nun mal vielen Menschen Spaß, Entscheidungen abgenommen zu bekommen. Liebe diesen! Töte jenen! Ist es im Tierreich anders? Traurig.
Traurig ohne Frage
Es gibt auch Ermutigungen, aber im Politischen zurzeit wenig. Da ereifere ich mich dann bei wohlschmeckendem Essen. Glücklichsein gibt’s nicht mehr. Nicht unglücklich zu sein muss reichen
Die Nachricht, dass Marine Le Pen nicht bei der nächsten Wahl antreten darf, hat mich kurzfristig gefreut. Wahrscheinlich muss man aber davon ausgehen, dass sie unter den rechten Wählern nun als Märtyrerin gesehen wird, und die Leute nun erst recht ihr Kreuz dem FN geben. Egal wer für das Amt des Präsidenten antreten werden.
Die Kröte ist noch nicht geschluckt. Im Froschschenkel liebenden Frankreich schon gar nicht. Einen Dreh gibt es immer.
Es gibt mit Jordan Bardella doch eh schon einen Nachfolger, der in den Startlöchern steht…
…und offensichtlich auch erstmal ein Berufungsverfahren
Jung und hübsch. Was will das Stimmvolk mehr?
Sie kritisieren Ideologien als Selbsttäuschung und stellen den Rausch der Vernunft gegenüber. Doch liegt nicht gerade in dieser Spannung eine treibende Kraft für Veränderung? Die zunehmende Hinwendung der Generation Z zum Sozialismus ist keine naive Glorifizierung, sondern eine Reaktion auf die Krisen des Kapitalismus.
Rausch kann zerstörerisch sein, aber auch neue Einsichten ermöglichen. Er öffnet mitunter Türen, die die reine Vernunft verschlossen hält. Ist es nicht gerade das Zusammenspiel von Rausch und Vernunft, das neue Perspektiven eröffnet?
Na vielleicht – aber manchmal führt Rausch auch nur im Kreis 😉
Es gibt auch schöne Kreise, zum Beispiel die, in denen ich verkehre.
hahaha!
Wendet sich die Generation Z wirklich dem zum Sozialismus zu? Das scheint mir nicht so richtig zu stimmen.
War nicht gerade in dieser Altersgruppe der Anteil an AfD-Wählern besonders hoch? Oder habe ich das falsch im Kopf?
Es gibt da sicherlich unterschiedliche Meinungen innerhalb der Gen Z, aber die Mehrheit neigt wohl dazu, sozialere und gleichberechtigtere Ansätze zu bevorzugen.
Es wird so viel rumanalysiert. Am besten, man glaubt das, was einem am meisten Spaß macht oder worüber man sich am wirkungsvollsten ereifern kann.
Das ist ja ein Ding! Dass Petula Clark damals auch Lieder auf deutsch veröffentlicht hat, war völlig an mir vorbei gegangen.
Es gibt glaube ich eine ganze CD…
https://www.amazon.de/Die-deutschen-Erfolge-Petula-Clark/dp/B00004SIDJ
Wenn man weiß, wonach man suchen muss, findet man heute alles. Das ist herrlich! Schade bloß, dass so viele nicht wissen, wonach sie suchen könnten.
Ich mag solche alten Riten, wo man seinen Toten Schätze (oder neuer ein paar Andenken) mitgibt. Da spielt immerhin eine Wertschätzung mit, die ich für das Ende eines Lebens angemessen finde.
Es macht in dem Zusammenhang dann sicher einen Unterschied, ob man das als sentimentale Geste oder als versöhnliche Gabe für die Götter ansieht. Aber vielleicht sind solche Kleinigkeiten bei einem Abschied auch völlig gleichgültig.
Den Angehörigen ist so etwas wichtig, der Leiche nicht.
„Sekt – für wen?“ scheint mir als Frage zu belanglos um eine völlig durchdachte, un-woke Antwort zu generieren.
Fragen sind nie belanglos. Nur Antworten.
Von der Bedienung im Restaurant einmal abgesehen 😂, da haben Sie sicher recht.
Sie kommt ja wohl auch eher aus einem slavischen Landstrich als aus der Champagne
Hanno Rinke scheint dieses Mal so leise in der Kommentar-Sektion. Der Abschied von der Prediger-Kanzel war scheinbar ernst gemeint 🥺
Nein, nein. Ich bin noch dabei. Wahr ist: Ich erlebe nicht mehr, ich lasse erleben.
Huch, und wie geht das? Macht das jetzt auch schon die KI?
Bisher noch sind es reale Menschen, deren Erfahrungen ich zu Gedanken verarbeite.
Die KI macht nur dumme Studio Ghibli Memes. Den Rest muss man bisher noch selbst machen.
Bisher!
Mir fällt heute Morgen erst auf, dass dies tatsächlich ein Abschiedstext war. Ich hoffe es handelt sich wieder nur um eine kleine Verschnaufpause…
Mal sehen!
🥺
Es passiert so viel in der Welt – mehr denn je –, und Hanno Rinkes Blick darauf ist stets einzigartig. Es dürfte also reichlich Material geben, vielleicht sogar mehr, als uns lieb ist.
Eine weltweite Rezession, Nationalismus allerorts, WW3, alles scheint möglich…..
Thorsten Ehrlichs Einschätzung ermutigt mich so sehr, dass ich fast schon wieder zu formulieren beginne.
Na dann, bis zur nächsten Predigt 🙂