Liebe Einzelne, liebe Gemeinde!
Einfach nur da zu sein, ist natürlich etwas wenig. Findet zumindest der Mensch. In meinem Alter geht es dabei nicht mehr so sehr um das ‚Wie lange‘, sondern vor allem um das ‚Wie intensiv‘. Dies ist jedenfalls mein Eindruck. Aber jeder altert anders.
Außerdem geht es, finde ich, auch darum, seine eigenen Erkenntnisse weiterzugeben. Mein Gott, es sind doch schon so viele Erkenntnisse weitergegeben worden! Aber nein, das muss uns nicht mutlos machen; denn es gibt zwei Arten von Hoffnungen: Entweder das früher Kundgetane war gar keine Erkenntnis, sondern ein Irrtum, (Pech), oder das jetzt Kundgetane ist so neu, dass noch niemand vorher darauf gekommen ist. Diese Zuversicht herrscht vor allem in der Wissenschaft, berechtigterweise, und in der Popmusik, erstaunlicherweise. Bei der Weitergabe von Erkenntnissen geht es darum, zunächst mal sich selbst einen Eindruck zu verschaffen (möglichst) und anschließend bei anderen einen Eindruck zu hinterlassen (unbedingt).
Der Unterschied ist riesig.
1. Sich einen Eindruck machen:
Na ja. Der eine findet sich in der Welt, der andere findet die Welt in sich. Das sind bereits zwei Welten, zwei Wege; den ersten bin ich gegangen, auf dem zweiten befinde ich mich. Das zuvor Erlebte hilft dabei, denn nicht alles, was vorbei ist, ist vorbei.
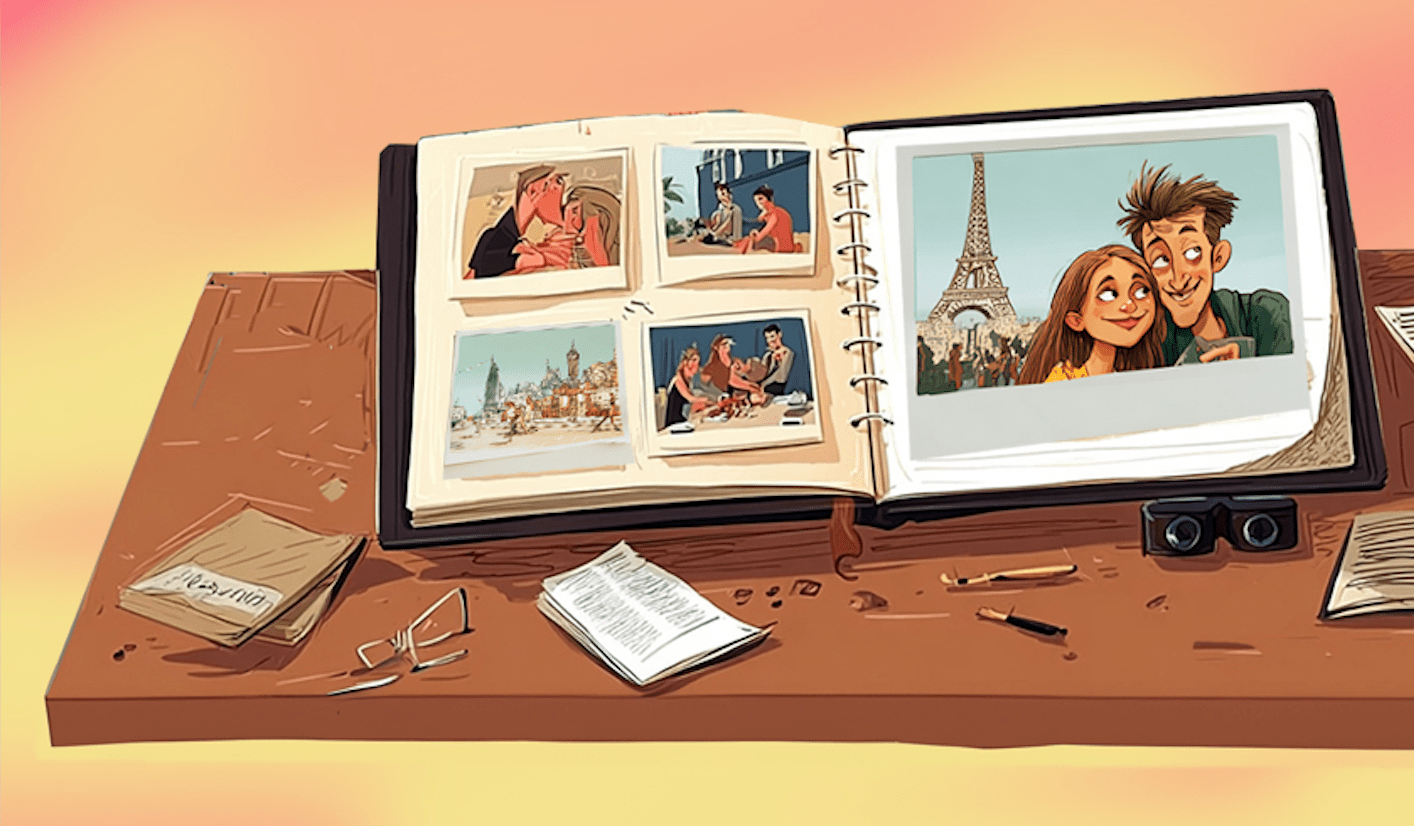
Wir lernen aus der Vergangenheit. Wir erinnern uns. Die Zeit tut wenig, aber das pausenlos: sie vergeht. Das bedeutet Glück im Unglück und Unglück im Glück. Das kann uns bittersüße Nostalgie oder, wenn es schlimm kommt, gallebitteres Trauma bescheren.
Zu meinen Eindrücken gehört auch, dass ich mir ausmale, wer ich nicht bin und was ich nicht kenne. Nie war ich so anspruchsvoll, von der Wirklichkeit mehr zu erwarten als von meiner Fantasie. Das Schlimmste konnte ich mir vorstellen und froh darüber sein, dass es im Allgemeinen nicht eintraf. Beim Schönen ist die Sache schwieriger. Ein größeres Haus, ein kleinerer Bauch? Eigentlich nicht nötig. Mehr Intelligenz, weniger Eitelkeit? Wünschen kann man sich alles, bekommen tut man es oft nicht, und das ist manchmal sogar gut so.
Der allererste Wunsch ist vermutlich: „Oh nein!“ Nur sagen kann man das nicht. Das Licht der Welt – es ist wohl der Urschrecken jedes Neugeborenen. Von da an gebieten Gene und Umwelt über den weiteren Verlauf. Bevor wir unser Schicksal irgendwann mal in die Hand nehmen können, hat unser Schicksal uns in der Hand. Die Eindrücke, die auf uns einwirken, bestimmen unser Wollen, von Anfang an: Was soll so bleiben? Was muss sich ändern? Es ist erwiesen, dass die negativen Eindrücke viel länger im Gedächtnis abgespeichert werden als die positiven. Entwicklungsgeschichtlich einleuchtend: Vom Guten droht keine Gefahr, vom Bösen schon. Trotzdem schade.
2. Selbst einen Eindruck machen:
Drückeberg ist dafür kein guter Geburtsort. Um zu beeindrucken, muss man sich in Stellung bringen: Positur kommt dabei besser an als Pose.
Gut hat es, wer mit seinem Äußeren punkten und prunken kann. Wo Schönheit fehlt, muss das Fitnessstudio oder die Boutique aushelfen.
Als Schüler wollte ich gern normal sein, wurde aber bereits von meinen Eltern darauf vorbereitet, dass ich es nicht bin. Sie brachten mir aus Bayern Kniebund-Lederhosen für den Alltag mit und steckten mich zu Geburtstagsfeiern in einen Matrosenanzug. Daraus, dass ich nicht ausgelacht wurde, lernte ich, dass man sich was trauen kann. Selbstbewusstsein hilft dabei natürlich, und das brachten mir meine Eltern erst recht bei.
In meiner Berufszeit achtete ich darauf, dass meine Garderobe weder unauffällig noch knallig war: Ich balancierte auf dem Strich, der ‚dezent‘ von ‚aufgetakelt‘ trennt. Jetzt trage ich diese fürchterlichen, praktischen Jogginghosen mit Polohemd und Pullover. Ton in Ton: Blau, Grün, Gelb, Rot. Türkis, Violett, Pink, Zyklam – aber nie Rentnerbeige oder Alltagsgrau. (Referenz an Sloterdijk: Ich denke Grau, ich ziehe es bloß nicht an.)1 Die basisdemokratische Gleichbehandlung aller übrigen Farben vermittelt bereits anhand meiner Kleidung den Eindruck von Gesinnungslosigkeit, die sich der Fahne keines Sportvereins und der Flagge keines Staatsgebildes verpflichtet fühlt.
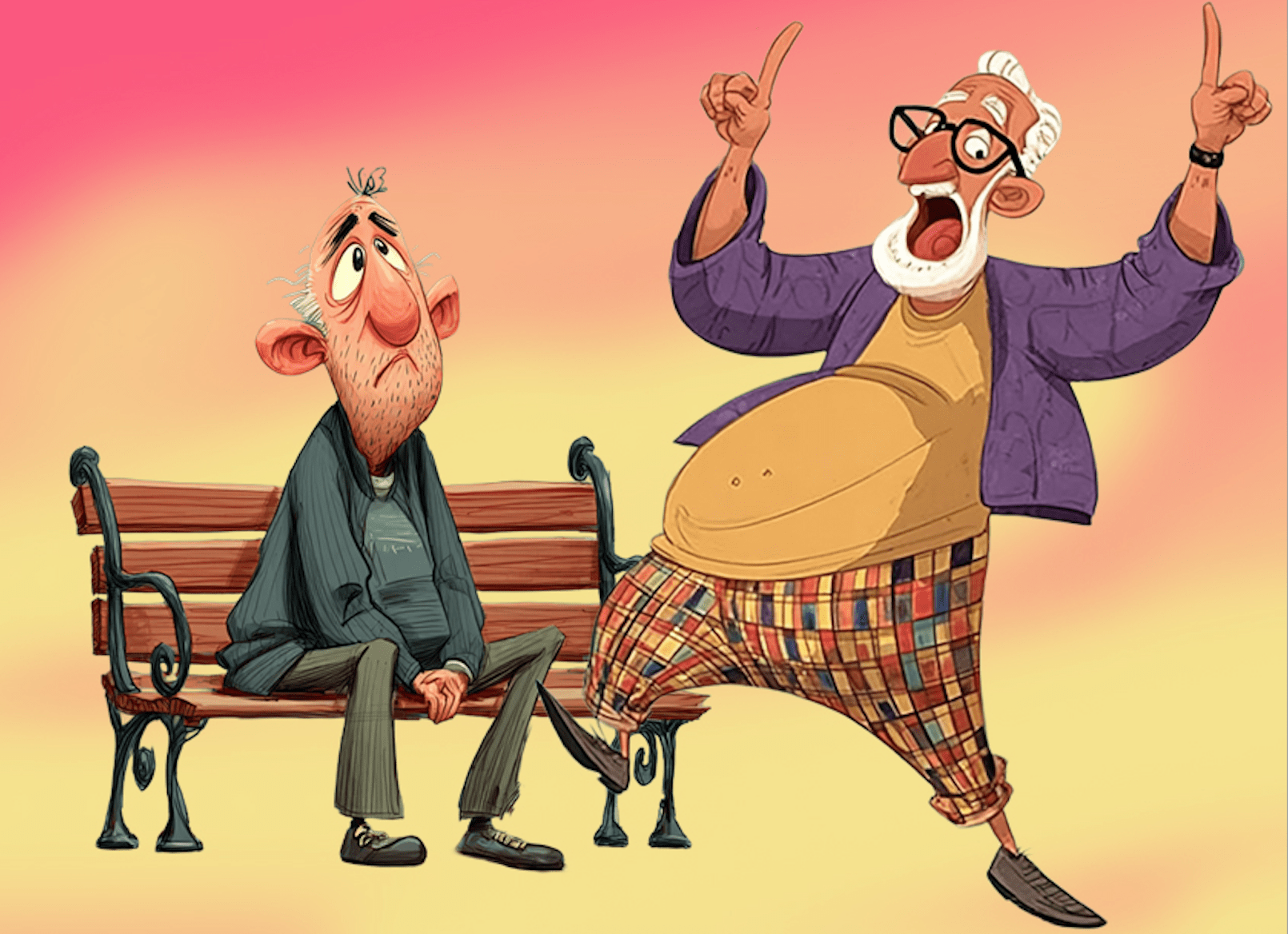
Früher war ‚Angeben‘ meine Lieblingsbeschäftigung, heute ist es ‚Denken‘. Selbstverständlich behaupte ich, es sei umgekehrt. Dass ich früh begonnen habe nachzudenken, klingt gut, und dass ich jetzt vor allem angeben will, geht als einer meiner üblichen Scherze durch. So kommen wir von den äußeren zu den inneren Werten.
Sehr gut angeben lässt es sich mit Wissen. Allerdings muss man dabei sein Publikum unbedingt berücksichtigen: Im Altersheim und auf dem Archäologenkongress geht Taylor Swift womöglich noch als Rarität durch, bei jungen Menschen macht man eher Furore, wenn man weiß, wie der erste Bundeskanzler hieß.
Beim Einschätzen der Klugheit von Politikern unterscheidet man die, die mehr wissen, als sie sagen, von denen, die mehr sagen, als sie wissen.
Aufmerksame Zuhörer bemerken, dass es einen Grabbelkasten für Worthülsen gibt. Jemand, der eigentlich eine völlig unterschiedliche Auffassung hat, sagt an einer Stelle dann plötzlich: „Da bin ich ganz bei Ihnen!“ ‚Schwierigkeiten‘ gibt es überhaupt keine mehr, bloß noch ‚Herausforderungen‘. Und kein Minister hat noch Ausgaben. Sie alle nehmen Geld in die Hand (machen sich also die Finger dreckig).
Was zur Nazi-Zeit die Deutschtümelei war, ist heute die Englischtümelei. Wer Eindruck machen will, muss das berücksichtigen und in Anglizismen schwimmen, ohne baden zu gehen. Ich tadle das nicht, denn mir ist klar, dass jemand, der ein Tablett in Händen hält, ein nachvollziehbareres Selbstwertgefühl bekommt, wenn er „Room Service“ haucht, als wenn er „Stubendienst“ brüllen würde.
Wer wenig denkt, muss, damit man das nicht merkt, mit seinen Äußerungen sparsam umgehen. Sparsamkeit ist etwas anderes als Geiz. Das gilt nicht nur im Gespräch, sondern auch im übrigen Leben. Wer – wie ich – dasselbe Handy zehn Jahre lang benutzt, ist sparsam. Guter Eindruck. Nachteil: hinterwäldlerisch. Wer dasselbe TempoⓇ-Taschentuch zehnmal benutzt, ist geizig. Schlechter Eindruck. Vorteil: fingerfertig.
Wichtig ist es, das Für und Wieder aller Aktionen zu bedenken. Was spricht für eine einmalige Extravaganz, was spricht für eine unendliche, einlullende Repetition? In dieser Predigt: nichts.
Ich will doch keinen schlechten Eindruck machen!
Euer Sonntagsprediger
Hanno Rinke

Quelle: 1 Peter Sloterdijk: ‚Wer noch kein Grau gedacht hat. Eine Farbenlehre‘, Suhrkamp Verlag, 2022
Grafiken: Kl-generiert via Midjourney

Ihr Abschnitt über das Älterwerden, lieber Herr Rinke, hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Ich bin zwar noch ein paar Jahre von Ihrem Erfahrungsstand entfernt, aber Ihr Satz „Nicht alles, was vorbei ist, ist vorbei“ hat mich getroffen. Es stimmt, manches wirkt nach, im Guten wie im Schlechten. Danke für diese Erinnerung.
Das ist ein toller Satz. Für jedes Alter, würde ich sagen 😉
Danke. Ja, manche Dinge blähen sich erst in der Erinnerung auf.
Wie schön, dass Sie es schaffen, über Eitelkeit, Wissen, Mode und Trauma zu schreiben, ohne den moralischen Zeigefinger zu heben. Ihr Ton bleibt immer menschlich, warm, zugewandt. Das ist selten und sehr geschätzt. Lieben Dank!
So fühle ich es auch, selbst, wenn ich fürchte, dass es manchmal etwas sarkastisch rüberkommt.
Das ist wahrscheinlich Geschmacksache. Aber eigentlich ist es doch sowohl an Ihren Texten, wie auch an ihrem Engagement und Dialog in der Kommentarsektion offensichtlich, dass Sie sich für die Menschen und unsere Gesellschaft interessieren.
Neben dem Geschmack betrifft es auch den Ernst: Der eine lacht, der andere weint. Meinen tun sie dasselbe.
Dass dort, wo die Schönheit es gut gemeint hat, auf das Fitnessstudio oder die Boutique verzichtet wird, wäre mir aber neu.
Oft scheint mir das Gegenteil der Fall zu sein. Aber mittlerweile sind wir doch eh alle dem Schönheits- und Fitness- und Wellnesswahn verfallen.
Es wirkt tatsächlich so, als würde gerade dort besonders nachgeholfen, wo schon vieles gut angelegt ist – vielleicht, weil Schönheit heute weniger als Geschenk gilt und mehr als Aufgabe verstanden wird. Der Druck trifft am Ende alle, unabhängig vom Ausgangspunkt. Und genau das macht den „Fitness- und Wellnesswahn“, den Sie erwähnen, so wirkmächtig: Er kennt keine Grenze nach oben. Wer viel hat, will es halten; wer wenig hat, soll optimieren.
Ich schreibe: Dort, wo Schönheit fehlt, m u s s das Studio aushelfen. Dass es vor allem zum Einsatz kommt, um zu steigern, erwähne ich gar nicht erst.
Na klar, die Unterscheidung macht natürlich Sinn.
Die Beschreibung des Alters als Übergang vom „Wie lange“ zum „Wie intensiv“ finde ich ja sehr treffend. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob diese Verschiebung wirklich altersabhängig ist oder ob viele Menschen diesen Fokuswechsel viel früher bräuchten.
Da wir den Zeitpunkt des Endes nicht kennen, bleibt diese Verschiebung eine Charakterfrage und ist ansonsten Spekulation.
Also, der Gedanke an das frühe „Festgelegtwerden“ durch Gene, Umfeld und familiäre Prägungen ist tatsächlich wichtig, denn vieles davon tragen wir ja unbemerkt als Startbedingungen mit uns. Spannend ist aber die Frage, wie viel davon später wieder aufgeweicht werden kann. Ein Teil dieser Freiheit entsteht durch Erfahrung und Reflexion: Wir können Muster erkennen und manchmal umlenken, aber nie völlig loslösen. Auch äußere Bedingungen wie Bildungschancen oder soziale Mobilität setzen Grenzen, an denen der eigene Wille allein nicht ausreicht. Dennoch bleibt ein gewisser Spielraum, der sich im Laufe des Lebens erweitert, weniger durch vollständige Selbstbestimmung als durch ein bewussteres Verhältnis zu den Kräften, die uns geprägt haben.
Allein unser Geburtsort ist doch schon ausschlaggebend.
Viele Muster, die früh entstehen – wie wir Stress verarbeiten, wie wir Nähe suchen, wie wir Unsicherheiten begegnen – begleiten uns durch das Leben. Manche lassen sich verändern, aber oft nur mit erheblichem Aufwand. Die Freiheit wächst, aber sie wächst langsam.
Und gegen Ende schrumpft sie wieder.
Was wir oft Gestaltungsfreiheit nennen, ist vielleicht weniger ein Zustand als ein Prozess. Viele Menschen gewinnen die größte Freiheit erst, wenn sie nicht mehr versuchen, sich vollständig selbst zu definieren, sondern akzeptieren, dass Gestaltung immer in Relation zu inneren und äußeren Bedingungen geschieht.
Das sehe ich an mir.
Die Bemerkung über Worthülsen trifft leider genau ins Schwarze. Sprache wird oft so glatt gebügelt, dass sie nichts mehr riskiert. Vielleicht beeindruckt nicht der, der am meisten weiß, sondern der, der es wagt, klar zu sprechen. (Damit meine ich nicht die ganzen „konservativen“ Redner, die behaupten, man dürfte seine Meinung nicht mehr laut sagen…)
Die Leute haben glaube ich schon Angst gecancelled zu werden. Sagen darf man alles. Als Promi sowieso. Aber es gibt eben auch wenig nuancierte Auseinandersetzung. Positionen müssen schwarz oder weiss sein. Wer etwas sagt, dass unterschiedlich ausgelegt werden kann, riskiert falsch verstanden zu werden. Das ist schon ein Fakt unserer zeit, würde ich meinen.
Ich glaube, es wird bereits böswillig darauf gelauert, Sätze falsch auslegen zu können, um das Geschrei in eigener Richtung zu beginnen. Rechtsradikale, die keine ‚Konservativen‘ sind, pflegen diesen Brauch genauso wie Linksradikale. Adenauer käme nicht mehr durch mit dem Satz: „Was geb ich auf mein Geschwätz von gestern!“, sondern es würde ihm vorgehalten, was er vor siebzehn Jahren gesagt hat, um ihn heute zu diskreditieren.
Das Oxford Wort des Jahres ist ja nicht umsonst „Rage bait“.
Das meint aber doch nochmal etwas anderes.
Es hängt aber doch trotzdem zusammen. Outrage Culture (Empörungskultur) beschreibt ja schließlich das Phänomen, dass heutzutage besonders schnell und intensiv moralische Empörung über vermeintliches Fehlverhalten in der Öffentlichkeit ausgelöst wird. Rage bait Posts in den Sozialen Medien zielen doch genau darauf ab.
„Rage bait“ klingt für mich jedenfalls deutlich aktueller als „KI-Ära“. Aber vielleicht ist auch das nur Englischtümelei.
Zwischen kalter Teilnahmslosigkeit und sprungbereiter Überhitzung möchte der wohltemperierte Mensch manchmal von der Sauna zu Bach wechseln.
Kleidung und Auftreten sind ja immer mit unserer Identität verknüpft. Auch wenn man sich davon frei fühlt, bleibt die Außenwirkung bestehen. Vielleicht ist das nie ganz zu vermeiden und eher eine Art stiller Dialog mit der Umwelt.
Die Außenwirkung lässt sich wohl tatsächlich nicht abschalten. Selbst wer sich von Mode völlig frei glaubt, sendet noch etwas aus, ob er das will oder nicht. Unsere Kleidung ist dann wohl weniger ein Dialog als ein ständiges Signal, das andere nun einmal lesen. Die eigentliche Frage bleibt, ob man dieses Signal nun bewusst setzen will oder es einfach geschehen lässt. In beiden Fällen entsteht Identität, nur eben auf unterschiedliche Weise.
Wer völlig uneitel ist, mag Menschen nicht oder hat sie nicht verstanden.
Oder er hat sich selbst nicht verstanden. Ein Rest Eitelkeit gehört nun einmal zum Menschsein.
Ist Eitelkeit auch selbstgerichtet? Bei Narziss wohl. Wir verbinden sie ja meist mit der Wirkung auf andere.
Man möchte gefallen, klar, aber manchmal gefällt man sich eben auch einfach selbst.
Kritische Selbstgefälligkeit?
Herr Rinke, der Abschnitt über Nostalgie und Trauma macht mich nachdenklich. Beides kommt ja aus denselben Quellen, nur unter anderen Bedingungen. Die Frage ist, ob wir selbst entscheiden können, was davon Oberwasser bekommt, oder ob das eine Illusion von Kontrolle ist.
Ich bemühe mich vielleicht mehr als viele um Kontrolle. Aber in dieser Frage habe ich gegen das Unbewusste keine Chance.
Dass Sie äußere und innere Werte so nonchalant gegeneinanderstellen, hat mir ziemlich gut gefallen. Wir tun nämlich allzu oft so, als seien beide Bereiche sauber getrennt, dabei beeinflussen sie sich ständig. Wer äußere Wirkung komplett abtut, verkennt die Realität; wer sich nur darauf stützt, ebenso. Ihre Balance erscheint mir hier erstaunlich realistisch.
Entscheidend ist wohl weniger die perfekte Balance als das Bewusstsein, dass beides unweigerlich ineinandergreift.
Wer so tut, als wäre die äußere Wirkung unwichtig, macht sich etwas vor
Es gibt Unterschiede: Die einen finden Kim Kardashian hübschen, die anderen Bärbel Bas. Aber das, worauf sich die Mehrheit emotional einigt, wird zum Politikum.
Menschliche Emotionen als Mehrheitsentscheid – läuft 😉
So geht Demokratie. Leider?
Es gibt ja genügend Kräfte, die die Demokratie gerne einschränken oder abschaffen möchten. Nicht nur in den USA…
Autokraten muss man stürzen. Die Demokratie hat die Möglichkeit, sich selbst per Wahl abzuschaffen.
Zum Thema Mode musste ich schmunzeln, aber nicht wegen der Kleidung selbst, sondern wegen der sozialen Erwartung dahinter. Jeder will „normal“ wirken, und genau das führt zu einer Art Uniformität. Ihre frühen Lederhosen erzählen davon auf charmante Weise.
Eine Ehrenrettung: Drag-Queens möchten nicht durchgehend normal wirken.
Nachdem in Berlin gegen die Dragqueen Jurassica Parka wegen des Verdachts auf Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt wird, möchten die anderen für eine Weile wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr auffallen.
Glaube ich nicht! Und wenn doch: Wer im grauen Trainingsanzug läuft, hat die Bezeichnung ‚Drag-Queen‘ verspielt.
Daran glaube ich auch nicht. Die wollen vielleicht nicht unbedingt zu diesem Thema interviewt werden, aber das (Nacht)leben geht doch trotzdem weiter.
Und sonst: Ein Abend Zuhause ist ja auch mal gemütlich.
Ist das auch Englischtümelei, wenn in Neukölln niemand im Café Deutsch spricht?
Nein, das sind einfach Leute, die kein Deutsch sprechen.
Als Provokation ist es eher nicht gemeint, zumal AfD-Jugendliche dort selten ihrenTee trinken.
😆
Beim Lesen dachte ich: Wir unterschätzen ständig, wie sehr Erinnerungen unser Verhalten lenken. Selbst wenn man meint, man habe etwas „abgehakt“, reagiert der Körper oft schneller als der Kopf. Das macht Ihre Beobachtung zur Macht der frühen Eindrücke sehr überzeugend.
So ähnlich sagt mein Osteopath das auch immer.
Nett, wenn Sie trotzdem weiterhin auch meine Beiträge lesen.
Mein Eindruck bleibt ein guter! Lieben Dank, Hanno Rinke.
Das freut mich und stimmt mich zuversichtlich für die kommenden Sonntage.
Ich bin zufällig wieder auf den Blog geraten und freue mich sehr, dass Sie zum Jahresende wieder aktiv sind. Gerade in den ruhigen Tagen (wenn man vom Geschenke-Organisieren absieht), ist es schön neues Futter zum Lesen und Nachdenken zu haben. Super 🙂
Macht mich glücklich! Und Sie werden zum Jahresende nochmal eine Extra-Portion Lesestoff bekommen.
Oh, das ist ja mal eine Ankündigung!
Wie immer lesenswert, Ihre Sonntagspredigt. Diese unsägliche Floskel „Da bin ich ganz bei Ihnen.“, bewirkt selbst als Zitat, dass sich meine Nackenhaare aufstellen. Es gibt wohl kaum eine Worthülse, die bei mir so viel Abneigung erzeugt. Ich habe niemanden eingeladen und die Anwesenheit meiner Lieben, reicht mir vollends aus. Alle anderen dürfen bleiben, wo sie sind oder gerne auch, wo der Pfeffer wächst.
Eine gute Woche, wünsche ich Ihnen.
Meinen herzlichen Dank. Pfeffer möchte ich als Würze nicht missen. Einigen potenziellen Erntehelfern würde ich den Einsatz vor Ort gern schmackhaft machen.
Was das Thema „Angeben“ betrifft: Ich fand die Ehrlichkeit erfrischend. Die meisten tun so, als wären sie immer rein zufällig klug, witzig oder gut informiert. Dabei steckt in fast jeder Darstellung ein bisschen Theater. Sie sagen es nur offener. Ein sympathischer Kontrollverlust.
Ein bisschen Theater gehört eben dazu. Wer so tut, als sei er völlig frei davon, spielt nur eine andere Rolle, nämlich die durchschaubarere.
Man muss nur unterscheiden, wann man auf der Bühne steht und wann man im Parkett sitzt.
Wenn ein Minister schon wieder „Geld in die Hand nimmt“, sehe ich mittlerweile reflexhaft vor mir, wie er mit schmutzigen Fingern aus der Portokasse wühlt.
Dass Sie beim „Geld in die Hand nehmen“ sofort an schmutzige Finger denken, zeigt genau das eigentliche Problem: Nicht die Phrase ist schuld, sondern der Vertrauensverlust dahinter. Man glaubt den Politikern schlicht nicht mehr, und deshalb klingt inzwischen jede ihrer Formulierungen hohl, egal wie sie sie verpacken.
Das Vertrauen in die Politik ist heute ohne Frage stark erodiert. Viele Entscheidungen wirken widersprüchlich, Versprechen werden nicht eingelöst, Kurswechsel oft nur halbherzig erklärt. Kein Wunder, dass Bürger:innen skeptisch reagieren und kaum noch an die Aufrichtigkeit politischer Aussagen glauben. Glaubwürdigkeit ist längst kein Selbstverständnis mehr, sondern etwas, das fast vollständig verloren gegangen scheint. Und derzeit ist deshalb auch kaum abzusehen, wie sie wieder zurückgewonnen werden könnte.
Es ist ja auch nicht so, dass die Leute plötzlich misstrauisch geworden wären. Man hat ihnen schlicht zu oft gezeigt, dass Worte schneller gewechselt werden als Maßnahmen. Politik wirkt dadurch wie ein dauernder PR-Betrieb – und der hat naturgemäß wenig Glaubwürdigkeitsreserven.
Es heißt, Robert Habeck habe einen ehrlichen Politik-Stil versucht. Er sieht sich – dem Vernehmen nach – als gescheitert an.
Und Merz? Ist das besonders ehrlich? Oder spielt er den Unsympathen nur?
Also, man darf auch nicht zu viel verlangen! Früher hat Merz die Mundwinkel in Talk-Shows immer so griesgrämig runtergezogen. Das hat ihm sein Medien-Berater-Team abgewöhnt. Zu Umsetzungen in der Sache reicht es halt nicht. Wer charakterfest ist, geht wohl nicht mehr in die Politik.
Poliertes Gesicht, aber matte Haltung 😆
Ich finde Philipp Amthors Gesicht polierter.
Spannend an dieser Predigt finde ich den Hinweis auf die frühen Prägungen. Vieles, was später wie bewusste Entscheidung wirkt, ist längst im Hintergrund programmiert. Der Text rührt damit an eine Frage, die wir sicher gerne ausblenden würden: Wie frei sind wir eigentlich in unseren Selbstentwürfen?
Tja, das ist möglicherweise eines der Themen, denen man ungern nachgeht, weil es dann die eigene Autonomie bröckeln lässt.
Es ist schon irritierend zu wissen, wie sehr Hormone unser Fühlen – und damit unser Bewusstsein – bestimmen.
Stimmt. Und wie Fran Lebowitz so schön sagt: Wenn Menschen ‚Ich denke…‘ sagen, meinen sie meist nur ‚Ich fühle…‘ – echte Gedanken kommen da erstaunlich selten vor. (Sinngemäß)
Ja. Das Problem ist nur, Ihr „n u r“. Das Fühlen bestimmt (leider?) das Denken. Auch bei Philosophen und Intellektuellen. Das wertende Nur müsste hinterfragt werden. Die KI wird vermutlich Entscheidungen treffen, ohne zu fühlen. Wird das Leben dann besser?
Ah, das sind interessante Zusammenhänge! Ich glaube, das ‚nur‘ im Lebowitz-Zitat meinte, dass viele Menschen ihre spontanen Gefühle sofort für Gedanken halten, nicht als Abwertung des Fühlens selbst. Aber klar, beides greift eng ineinander; Gedanken ohne Gefühl gibt’s kaum. Die Idee, dass man viel schneller redet, als man wirklich denkt bzw. dass heutzutage viel geredet wird ohne überhaupt zu denken, da ist sicher was dran.
Das Fühlen ist ohne Zusammenhang weder ab- noch aufzuwerten. Es kann halt sowohl in den Himmel als auch in die Hölle führen.
Und trotzdem: „Wichtig ist es, das Für und Wieder aller Aktionen zu bedenken.“
Meine Lektorin wollte mir das Wieder korrigieren, aber ich traue meinen Lesenden zu, dass sie die Abwandlung des gegnerichen ‚Wider‘ wegen des anderen Wortsinns genießen.
Der Hinweis, dass negative Eindrücke sich länger festbeißen als die positiven, hat mich echt erwischt. Das wirkt in Ihrem Text ja fast nebenbei erwähnt, hat aber enormes Gewicht. Wenn unser Gedächtnis permanent zugunsten des Schrecklichen sortiert, überrascht es fast, dass der Mensch trotzdem Optimismus hervorbringt.
Die Formulierung passt gut zu dem, was man aus der Psychologie zum „Negativity Bias“ kennt: Negative Eindrücke werden einfach intensiver wahrgenommen, stärker gespeichert und länger behalten als positive … Und das sicher evolutionär bedingt, weil Gefahren wichtiger waren als schöne Erlebnisse.
Meine nebenbei erwähnten Tatsachen sind im Allgemeinen wichtiger als das vergnügliche Gelaber…
Das vergnügliche Gelaber sichert am Ende den guten Eindruck 😉