Liebe Einzelne, liebe Gemeinde!
Das Jahr geht zu Ende und diese Staffel meines Blogs auch. Wer mich sehr lieb hat, kann sich mein neues Buch vornehmen. Ob Sie mich danach weiterhin lieben, bleibt Ihnen, meiner freundlichen Leserin, und Ihnen, meinem freundlichen Leser, selbst überlassen. Vorher aber gibt es auch hier nochmal die volle Dröhnung vor einem vorläufigen Abschied. Vom Umfang her und gedanklich habe ich jedenfalls alles in diesen Text hineingelegt, was mir zu Gebote steht.
Ich grüße Sie herzlich und steige andächtig von meiner Kanzel.
Euer selbstbewusster, selbstverlorener
Hanno Rinke
Im Dezember 2025
Am letzten Montag im Oktober | Am ersten Mittwoch im November | Einige Tage später | Halbzeit, Mittwoch, 12. November | Donnerstag, 13. November | Sonntag, 16. November | Montag, 17. November | Dienstag, 18. November | Mittwoch, 19. November | Sonntag, 23. November | Donnerstag, 27. November | Mittwoch, 3. Dezember | Schlussbemerkung | zu den Kommentaren |
Am letzten Montag im Oktober
Nun bin ich also in etwas, das als Ortsbezeichnung mit einem Doppelnamen absonderlich klingt und als Einrichtung absonderlich ist. Und passieren tut hier von Anfang an: nichts. Am Wochenende gab es naturgemäß darüber hinaus noch eine gehörige Portion ‚Weniger‘ zusätzlich. Eigentümlicherweise hatte ich damit gerechnet, dass mich Anstrengungen erwarten: Tag für Tag schlaucht mich vormittags und nachmittags eine brutale Physiotherapie, und in den Pausen dazwischen strömen beruhigende Infusionen, die mir supermännliche Kräfte verleihen, in meine Adern. Aber so läuft das hier nicht.
Um Viertel vor sieben ist Wecken, das macht aber nichts. Ich antworte, jähes Entsetzen unterdrückend, mit Aufbruch in der Stimme: „Guten Morgen!“, und schlafe weiter bis elf Uhr. Manchmal kommt auch eine Frau und fragt, ob ich in den Raum kommen möchte, in dem Essen ausgeteilt wird. Ich möchte nicht. Von Zeit zu Zeit wird mir dann etwas in Styropor gebracht, das sich, wenn es mir gelingt, den anspruchsvollen Laschenverschluss zu überlisten, vor allem als ‚viel‘ herausstellt. Frittiertes, deftige Panaden und fettstückenreiche Sülze machen deutlich, dass man sich hier nicht wie in einem Krankenhaus, sondern wie in einem gutbürgerlichen Lokal fühlen soll. Dabei komme ich mir aber leider eher vor wie das Salz ohne die Suppe. Ich kann nicht würzen und werde nicht gewürzt. Würde es sich um Sex handeln, hieße es: Keuschheit.
Mittwochs, wurde mir berichtet, wird ein Karren den Gang entlanggefahren, von dem man sich im Bedarfsfall mit frischen Handtüchern und Bettbezügen eindecken kann. Ja, es wird sehr auf Selbstständigkeit geachtet. Das spart Reinigungskräfte und erzieht dazu, Bett und Bad reinlich zu halten, falls man Sauberkeit liebt. Da ich hier an einem Mittwoch eingetroffen bin, stellte sich mir dieses Problem nicht so bald, denn ich stehe solch guten Absichten wegen meiner körperlichen Behinderung etwas hilflos gegenüber. Das Zusammenfalten von Wäsche gelingt meinen Händen nicht so recht. Deshalb trage ich jeweils heute die Sachen von vorgestern und morgen die von gestern am Leib, damit der Kleiderbaum auf dieser Art Sessel neben meinem Bett nicht in den Himmel wächst. Eines der Handtücher aus dem Bad nutze ich als Überwurf, um die mitgenommenen Kleidungsstücke, die ich mich hüte, ‚Klamotten‘ zu nennen, weniger sichtbar zu machen. Schönheit muss sein. All das hat aber bisher leider nicht dazu geführt, dass ich behänder geworden wäre. Im Gegenteil. Ich nehme den Gehwagen sogar mit aufs Klo.
Also, gleich am Donnerstag passierte doch etwas. Die dafür vorgesehene Person konnte sich davon überzeugen, dass ich nicht gelogen hatte. Erst lachte sie noch, aber dann flutschte ihr meine Vene doch weg, wie versprochen. Einige Einstiche später wurde ich verpflastert, und gut war’s.
Später am Vormittag fand dann etwas statt, das ‚Visite‘ heißt. Es ist aber nicht wie im Film, wo der Oberarzt mit den Assistenten und Schwestern ins Zimmer tritt und launige Späßchen macht. Nein, die Patienten sitzen draußen vor der Tür und machen die Visite selber, wenn sie reingerufen werden. Links sitzt der Professor, an den man sich zu wenden hat, rechts sitzen fünfzehn aufmerksam Schweigende. Man kommt sich vor wie die Leiche in der Anatomiestunde.
Am Freitag gab es bereits die nächste Abwechslung. Ein riesiges weihnachtsrotes Paket kam an. Silke, meine Vertraute seit 1971, hat es geschickt. Ein Hausmeister brachte es, und als er später nochmal kam, bat ich ihn, es für mich zu öffnen, weil ich mir das wegen der kunstvollen Verklebung nicht zutraute. Er hob den Deckel, lüpfte das Seidenpapier, lugte hinein und sagte: „Fressalien!“ Alles andere sah er ja nicht. Als er zum dritten Mal kam, war mir das nicht ganz geheuer, und mir wurde klar, dass er ein Pfleger war. Der einzige Mann hier zwischen Ärztinnen und Putzfrauen und vom Aussehen her genauso nichtssagend wie diese doofe Wiese vor meiner Terrassentür. Die Tüllgardine mildert den bedeutungslosen Anblick etwas ab. Der Pfleger konnte mir zumindest dabei helfen, die Nagelschere aus ihrem Einschweißmaterial zu fingern. Ohne die hätte ich sonst all die anderen Tüten gar nicht aufbekommen. Er auch nicht.
Heute Nachmittag habe ich den ersten Termin, wie immer bei einer Frau. Ich glaube, sie ist Psychologin und wird sicherlich bemüht sein, durch geschicktes Fragen das aus mir herauszukitzeln, was ich in drei Büchern ausführlich beschrieben habe.
Am kommenden Mittwoch bin ich um 13.00 Uhr im Gruppenraum der Station C zur Psychoedukation für Depression eingeteilt. Auf dem zweiten Blatt sind die Gruppenregeln aufgelistet, wobei mir besonders auffällt: Die Themen Sexualität und Suizidalität sind für Einzelsitzungen bestimmt. Gerade die! Was sonst interessiert denn überhaupt? Eigentlich bin ich zu alt für so was, aber ich erhoffe mir zumindest ein bisschen Stoff für meinen Hang zur Satire.
Termine werden einem auf Zetteln übermittelt, und mir wurde gesagt, dass sich Termine überschneiden können, weil die einzelnen Abteilungen nichts voneinander wissen; dann solle man das bitte bei der Pflege melden. Das klingt ja fast noch analoger als der deutsche Staat, aber was mich betrifft, notiere ich mir alles in meinem digitalen Kalender und konnte noch keine Überschneidungen feststellen. Etwas nervig ist, dass das Internet dauernd wegbricht. Ich habe schon sehr viel Übung darin, mit Kennwörtern, Zweitanbietern und ähnlichen Tricks dafür zu sorgen, dass es nach spätestens zwei Stunden wieder klappt.
Meine Mitpatienten habe ich kaum gesehen, bin auch nicht in der Stimmung, sie zu ertragen, aber die Damen vom Personal sind alle sehr freundlich und hilfsbereit, das möchte ich abschließend unbedingt festhalten. Eben hat mir eine sogar unaufgefordert das Essen aufs Zimmer gebracht. Sie haben wohl eingesehen, dass ich nicht in die Kantine zu bewegen bin.
Es riecht ziemlich stark. Ich ziehe die Lasche aus dem Schlitz: Eine riesige Portion Sauerkraut tut sich auf, darauf eine geplatzte Weißwurst und ein Stück Schwein, daneben zwei graue Klöße. Nun greife ich doch zu meiner Essensliste und lese in meiner Rubrik ‚Privatmenü‘: Bayerische Schlemmerplatte mit Haxe, Weißwurst, Sauerkraut und Serviettenknödeln. Das ist die Strafe dafür, dass wir dieses Jahr auf der Rückreise aus Italien erstmals nicht beim ‚Schneiderwirt‘ in Nußdorf am Inn eingekehrt sind. Ich kriege meine Strafen gleich so pünktlich aufgetischt, dass mir die Hölle später mal erspart bleiben sollte. Einfachheitshalber wird die Vergeltung immer gleich hier oben abgewickelt, damit meine Leiche später nicht mehr mit dem Runtertaumeln in den Hades belästigt werden muss.
Fernsehen kann ich nicht. Mein Lautstärke-Niveau stört die Nachbarn. Die Nachtschwester, eine fette Taube mit fabelhaftem Gehör, gab die Beschwerden mahnend an mich weiter. Aber man darf nie die positive Seite vergessen: Früher brauchte ich immer Ohropax, weil mich alle Geräusche störten. Heute werde ich selbst auf meinen Lärm hingewiesen. Ein gutes Buch tut es auch. Ist ja wirklich viel angemessener. Und sonst schreibe ich eben. Mit links.
Am ersten Mittwoch im November
Nun gab es doch endlich die erste Überschneidung: Mein Mittagessen kam genau, als ich zur Psychoedukation für Depression musste: eine Art Volkshochschulveranstaltung, von einer stämmigen Frau in verwaschenem T-Shirt geleitet. Was an die fast ständig im Wechsel begriffenen Blätter des Flipcharts gekliert worden war, konnte ich nicht lesen, und was Erhellendes dazu gesprochen wurde, verstand ich kaum. Ich bin ja nicht nur lahm, sondern auch taub und blind. Immerhin brauchte ich mich nicht vorzustellen: „Ich bin der Hanno, 79 Jahre alt und Rentner.“ Trotzdem redete ich ab und zu, weil ich dann wenigstens hörte, was gesagt wurde, und die Zeit dabei auch etwas flotter verging. Ich nahm aber wahr, dass sich die anderen fremden Leute dort duzten. Eine Schicksalsgemeinschaft sehr, sehr unaufdringlich zurechtgemachter Menschen ab 35.
Niederziehend: Ihre gesagten Wörter bildeten sich mir nicht mehr zu Worten; die einzelnen Laute ergaben kein entzifferbares Ganzes. In meinem eigenen Hirn klappt es noch ganz gut. Ich weiß außerdem, was Wörter ausmachen. Da bin ich empfindlich. ‚Alkoholiker‘ erlebe ich als unerhörte Beleidigung. ‚Suffkopp‘ lasse ich geschmeichelt gelten. Geziertes missfällt mir oft. ‚Neger‘ finde ich einfach geiler als ‚Schwarzer‘. Jemand, der Tabletts zwischen Küche und Kunde hin- und herträgt, arbeitet natürlich ‚in der Gastronomie‘, aber man kann auch ‚Kellner‘ sagen. Sicher, ‚bildungsfern‘ klingt hübscher, aber meistens reicht ‚doof‘. Schnörkeleien werden leicht durchschaut, es sei denn, das Gegenüber ist besonders bildungsfern.
Erst am Ende meines Aufenthalts bekomme ich meine Diagnose zu lesen: Gott sei Dank! Ich hätte sonst vor Entrüstung mit Sauerkraut geschmissen.
Schwere depressive Symptomatik mit gedrückter Stimmungslage, Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Morgentief, Ängste, Freudlosigkeit, erhöhte Ermüdbarkeit, Grübeln und neg. Gedankenkreise, sozialer Rückzug, reduzierte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne ohne konkrete suizidale Pläne.
Erstaunlich eigentlich, dieser Mangel an Selbstmord-Initiative. Stimmt schon: Manchmal – wenn auch nicht jetzt – wünsche ich mir, dass es mich nicht gäbe. Aber weil ich weiß, wie unerfüllbar dieser Wunsch ist, flüchte ich mich, wenn es sein muss, lieber in Träume. Da kann man nichts verkehrt machen. Sind sie schön, genießt man sie, sind sie übel, freut man sich, wenn man aufwacht. Die Wirklichkeit ist ernüchternd genug: An diesem undenkwürdigen Mittwoch, fand ich, zurück in meinem Zimmer, den Durchschlag des Zettels mit meiner – na ja – Unterschrift dafür, was der Professor alles gegen mich abrechnen darf und dass ich einverstanden bin, auch ‚seinen Stellvertreter/seine Stellvertreterin‘ zu akzeptieren. Bisher sind alle drei meinem in funktional-nüchternem Grau gehaltenen Aufenthaltsraum ferngeblieben. Allerdings: Eine Wand ist blau. Dunkelblau. Schlägt das nicht aufs Gemüt? Macht nichts. Im Bett habe ich ja die Augen geschlossen oder den Blick auf ein Buch gerichtet. Die Wand kümmert mich kaum, und an meinem Lager heruntergucken, das tue ich sowieso nicht so gern.
Der Wäschekarren hatte wohl keine Bimmel wie früher die Scherenschleifer im Hinterhof, jedenfalls habe ich ihn verpasst, hätte mich aber ja sowieso nicht mit meinen zwei linkischen Fingerhaltern bedienen können. Da werde ich wohl mit den beiden Handtüchern und dem – sinnvollerweise gelben – Bettlaken noch einige weitere Wochen lang vorliebnehmen müssen.
So viel für heute. Zu lesen habe ich nichts mehr. Es wird mir nichts anderes übrigbleiben, als zu schreiben, was hiermit geschehen ist.
Einige Tage später
Jetzt habe ich auch noch gegen Renitenz anzukämpfen. Als ich um 19.00 Uhr beim Pillen-Abholen ganz höflich bat, mir bitte meine übliche Schwarzbrotstulle zu schmieren – Käse hätte ich noch von gestern im Kühlschrank –, da sagt die doch zu mir: „Sie können sich zu der Frau setzen, die auch einen Rollator hat.“ Diese verhutzelte Greisin mit ihrem Null-Acht-Fuffzehn-Gestell ist mir, als ich mit Silkes elegantem schwarzen Spazierwagen unterwegs war, tatsächlich mal auf dem Flur begegnet. Vielleicht ist sie furchtbar nett. Über ihre – meiner eigenen womöglich weit überlegene – Fingerfertigkeit sagt das allerdings nichts aus. Ja, auch ich habe früher Chopin gespielt, auch ich habe später in meiner einsamen Küche anzufangen versucht, Butter mit dem Messer auf einer Brotscheibe zu verteilen, habe dann aber doch entnervt die flache Hand zu Hilfe genommen, die anschließend natürlich unter den Warmwasserhahn musste. Schmierfink! Küchenrolle reicht da nicht. Nun werde ich den Käse also pur essen, in Abwandlung des schönen Spruchs: In der allergrößten Not – schmeckt die Wurscht auch ohne Brot. Das wird doch wohl für eingeschweißte Scheiben von ‚FRISCHPACK – der Appetitmacher‘ auch gelten.
Es ist ja weder Dünkel noch Ungeselligkeit, dass ich nicht mit den anderen esse: Es sind meine Tischmanieren. Schon meine Eltern beklagten sie immer. Die sollten mich jetzt mal sehen! Dass man schlechtes Benehmen sehr viel leichter übernimmt als gutes, war mir schon klar, als ich noch nicht wusste, was Moral ist. Ich gebe mir ja Mühe, ein bisschen jedenfalls, aber wenn ständig alles von der Gabel rutscht, dann ist es doch gut, Finger zu haben, die links sogar gezielt greifen können. Auch ein Stück Fleisch lässt sich bei intakten Zähnen genauso gut abbeißen wie kleinschneiden. Bloß mit der Kleidung ist das so eine Sache.
Der raffinierteste Störenfried, den es gibt, ist der Fleck. Mit Servietten und Handtüchern kann ich mich abdecken, Papier noch zu Hilfe nehmen: Er findet immer eine Stelle, an der er auftrumpfen kann. Wenn ich zum Spinat Rosa trage, ist das verheerend, aber auch Tomatensoße kleckert unschön auf Himmelblau. Da ist Grau schon praktisch, das muss ich den Leuten hier lassen, obwohl die es doch gar nicht nötig haben. Die können sogar ihr Besteck vom Teller zum Mund balancieren, sah ich mal, als ich zu dem, was hier Mittagszeit ist, mit meinem Karren an der Glastür, die zur Kantine führt, vorbeirollte.

Auch Verabredungen mit dem akademischen Personal werden nur in Notfällen – und dann wie immer ohne Rücksicht auf etwaige andere Termine – von den Zuständigen selbst vorgenommen. Man muss sich bewerben. Dazu dienen Listen, die vor dem Kabuff der Diensthabenden aushängen. Ich, der ich früher schneller etwas aufgeschrieben als gedacht habe, benötige für mein Kreuz eine Hilfskraft, damit mein Eintrag auch ja nicht verrutscht. Die Liste bietet Termine im Zehn-Minuten-Takt an. Die stundenlangen Erörterungen mit meinem Hausarzt während einer Behandlung kannst du vergessen! Es kommt mir eher so vor wie bei der Bahn. Früher: Abfahrt – 14.32 Uhr. Heute: Auf Gleis sechs fährt der Schleich-Express aus Düsseldorf ein. Verspätung: zwei Stunden und siebenunddreißig Minuten.
Halbzeit, Mittwoch, 12. November
Wenn das jetzt meine ‚bessere Hälfte‘ war, verlange ich die Scheidung. Dabei: Alle sind superfreundlich. Ich will gar nicht meckern. Um das etwas in Misskredit geratene Gendern zu vermeiden, wird hier immer von der ‚Pflege‘ gesprochen. Zwar gibt es nur einen Mann, aber man kann so den Unterschied zwischen der ‚Pflegerin‘ und dem ‚Schwesterich‘ vermeiden. Der Mangel an bestimmtem Artikel hat mich in Institutionen wie dieser immer etwas irritiert. Sie ist ‚auf Station‘. Er ist ‚auf Klo‘. Dass mir das auffällt, muss wohl an meiner schweren depressiven Symptomatik liegen. Ich bemühe mich, so wenig Aufhebens wie möglich von mir zu machen. Wasser, das man ja viel trinken soll, hole ich mir trotzdem nicht selbst und schütze dafür die Wackeligkeit meines Laufgestells vor: „Wenn die Flasche runterfällt, dann wird es schlimm(er für Sie, weil Sie das dann alles zusammenkehren und wegfegen müssen).“ Das in Klammern sage ich nicht, sondern denke es bloß, wodurch es den schadenfrohen Beigeschmack verliert. Missgeschicke gibt es sowieso genug. Immer kann ich mir ausmalen, dass alles noch schlimmer werden wird, als es ist. Die Auswahl überlasse ich dem Schicksal.
Dass das Kabel meines Handys abgebrochen ist, war bestimmt meine eigene Schuld. Die selten durch den Raum irrlichternde Reinigungskraft hätte sich nie unterstanden, meinen Nachttisch zu verrücken, schon gar nicht so heftig, dass dabei irgendetwas hätte umfallen oder anstoßen können. Das muss ich mir selbst eingebröckelt haben. Die Unerreichbarkeit macht mich irgendwie richtig froh. Anderes stört mich zumindest nicht. Der Dreck zum Beispiel. Ist mir völlig egal. Den Bettbezug und die Handtücher kann man nach meinem Fortgang nur wegwerfen. Ich glaube nicht, dass Waschen da noch nutzt.
Der Hausmeister-Pfleger hat mich zuvorkommenderweise gestern sogar nass rasiert. Es tat ziemlich weh, aber ich bin – dem Spiegel zufolge – wohl nicht blutig und trage heute einen von Alexander frisch gewaschenen Anzug. Alexander ist ein Engel, ohne langweilig zu sein. Geht das? Offenbar. Ihm verdanke ich frisch gewaschene Unterhosen, ein Keilkissen, selbstgemachte Pralinen und den Kontakt zur Welt außerhalb meiner Möglichkeiten. Nur mit den Kopfhörern will es nicht klappen. Die Schnur zwischen meinem TV-Gerät an der Wand und meinen Hörvorrichtungen für die Ohren ist zu kurz. Auch schnurlos ist bisher keine Option. Bluetooth macht nicht mit. Vielleicht kann mich irgendwann mal der seit Tagen angeforderte Haustechniker blauzähnig machen. Geduld macht keinen Spaß, ist aber hilfreich.
Donnerstag, 13. November
In den vergangenen Tagen habe ich das Wort ‚Entspannung‘ überstrapaziert. Heute wurde ich so etwas wie ‚lebendig‘. Gleich beim Wecken war mir so nach Bühne. Ich ging also gut präpariert zur ‚Visite‘ genannten Autopsie.
Da soll der sezierbereite Leichnam ja berichten, wie er sich fühlt, damit die Studenten sehen, an welcher Stelle sie ansetzen müssen. Natürlich versuche ich Leiche, das durch Munterkeit zu konterkarieren. Obwohl – ich freue mich über jede Missempfindung, die ich bekomme; denn dann weiß ich: Das hat jetzt nichts mit meinem Alkoholkonsum zu tun, der sonst als Antwort auf physische Beschwerden infrage käme. Hier ja nun nicht. Ich referierte über meine ungewohnte Hartschissigkeit. (Im Beisein von Medizinern darf man das.) Abends lasse ich mir schon seit Tagen beim Tabletten-Abholen einen Saft verabreichen – so süß wie Barbies Unterwäsche. Der Professor war wie immer nicht zugegen, und die Vertretung dozierte: „Wir nehmen eine Stuhlprobe. Dann sehen wir weiter.“ Das hatte ich nun davon! Essen und Exkremente: So ist das hier. Im Rausgehen wandte ich mich noch mal zum Auditorium und sagte: „Tut mir leid, dass ich nichts Besseres zu berichten habe.“ Ich hoffte, es klang treuherzig.
Mein Publikum ist nicht leicht abzuschätzen. Intelligent und langweilig gibt es oft. Dumm und interessant ist selten, dumm und langweilig üblich. Kann Selbstzufriedenheit ein Ziel sein? Eher nicht. Wenn man nichts mehr erreichen will, sondern nur genießen, was man sowieso hat, dann wird man mit jedem Tag ärmer.
Ich lese den ‚Spiegel‘, zwei Wochen nach seinem Erscheinen. Sehr hilfreich. Die ganzen Mutmaßungen kann man gleich überspringen und zum Wesentlichen kommen. Dann zählt nicht mehr die Information, sondern nur noch deren Darstellung, und die interessiert mich bei ewig gültigen Werten wie Albernheit und Tiefsinn mehr als beim Tagesgeschehen, das ich schon vom Fernsehen her kenne und beurteile.
Ich lese über die angeblich jetzt so beliebte Angela Merkel. Komisch, bisher hörte ich immer nur, was die alles falsch gemacht hat. Auch gestern bei ‚Lanz‘. Der Techniker war da. Die Kopfhörer funktionieren jetzt. Wahnsinn! Ich kann bis eins fernsehen, auch mal länger.
Nachdem ich ausgeschaltet habe, geht es erst richtig los: Ich denke.
Gegen den Klimawandel würde ich keinen Cent ausgeben, allerdings mehr Geld in mehr und schnellere E-Auto-Tankstellen stecken. Das idiotische, ideologische Abschalten der Kernkraftwerke lässt sich wohl nicht rückgängig machen. Eltern, die fürchten, ihre Kinder würden ihnen später vorwerfen, dass sie nichts gegen den Klimawandel getan hätten, werden vielleicht stattdessen den Vorwurf zu hören bekommen, sie hätten im Übereifer das Verkehrte getan. Ach, später!
Amerika wird von Washington aus regiert: Grönland bis Feuerland; Asien von Peking aus; seinen Wurmfortsatz Europa bekommt Moskau und kann entscheiden, ob es die kulturelle Administration eventuell von Sankt Petersburg nach Paris verlegt. Die Touristen aus Chinesisch-Afrika und Amerikanisch-Australien können dann da wie dort die Überbleibsel der Vergangenheit begutachten: die Ruinen von Athen (Beethoven, Platon) und die Ruinen (Gedächtniskirche, Mauer) von Berlin (Knef, Zweiter Weltkrieg).
Gespür für das Wesentliche fällt nicht vom Himmel, ist aber wichtig. Hitler dachte zuerst, sein Talent sei es, Landschaften zu malen. Die Wiener Kunstakademiker glaubten ihm nicht. Dann entdeckte er seine Gabe, Leute zu beeinflussen. Die Massen glaubten ihm. Eine Idee zu haben, ist erfreulich; sie umzusetzen, war schon zu Lenins analogen Zeiten nicht einfach, heute geht das sowieso nur noch digital. Ohne Algorithmus kein Anklang. Was bleibt? Hitler, Stalin, Putin – irgendwann stirbt ja doch jeder, und die, die vorher dringend etwas hinterlassen wollen, sind die Schlimmsten.
Eigentlich ist es hier doch wie vorher in Meran, wie ab Dezember dann wieder in Hamburg. Manchmal geistere ich noch durchs Haus. Meistens hocke ich in meiner Studierstube oder liege gleich vollends im Bett. Sollte ich mich ausgeschlossen fühlen? Ausgeschlossen! Alle beziehen mich doch ein, so gut es geht. Es geht eben nicht so gut.
Früher waren Freunde einfach da. Das fand ich nicht bemerkenswert, es war selbstverständlich. Und jetzt? Das Theater bleibt interessant, zumindest unter dem Einfluss von Psychopharmaka: Einige Darsteller verschwinden, für immer oder bis zum nächsten Auftritt; neue Darsteller kommen aus den Kulissen, geplant oder durch Zufall. Mal stehe ich vor dem Souffleurkasten, mal sitze ich im Publikum. Mal stehe ich vor dem Sektausschank am Büfett, mal vor dem Pissbecken in der Herrentoilette. Mal spreize ich mich auf, mal werde ich abgeschminkt. Der AUS-Weg ist der Weg ins Aus. Notausgang.
Totsein wird nicht wehtun. Wenn ich tot bin, werde ich nichts vermissen. Bis auf das Gefühl, da zu sein.
Sonntag, 16. November
Der Dame von der Pflege gestehe ich, warum ich mein Zimmer nicht verlasse: „Ich habe Durchfall.“ Von Barbies Sirupschlüpfer? Wahre Ausreden sind die schönsten. „Sie verlieren Wasser“, schulmeistert sie. „Wie sollte ich? Ich trinke doch keins“, denke ich und sage nichts (eine Weisheit, die mir nur selten gelingt). Aber ich nehme mir ihre Worte zu Herzen und trinke ab jetzt gegen meine Durstlosigkeit an.
Das Schlimmste passiert gleich als Erstes am Tag, damit ich länger etwas davon habe: Mein Laptop streikt. Kann er das? Ja. Er verlangt ein Passwort. Ganz plötzlich. Einfach so. Nach dreimaligem Versuch will er mir helfen: ‚Ihre Straße!‘, schreibt er. Ich werde gern gesiezt, von Fremden sowieso, auch bei Amazon mag ich nicht, dass mich der Chatbot beim Vornamen nennt. Bei meinem Hausarzt fühle ich mich dagegen geschmeichelt. (Er ist älter als ich.) In der Werbung hasse ich dieses ranschmeißerische ‚Hol Dir Dein …‘, was bedeutet, ich soll zahlen, um etwas zu kaufen, das ich nicht brauche. So geht Kapitalismus! Sozialismus bedeutet, dass ich bekomme, was ich brauche, aber nicht das, was ich möchte. Hier bekomme ich weder noch, weil ich mein Kennwort nicht kenne.
Ich wohne in der Bernadottestraße, ein – wie ich finde – sehr honoriger Name. Meinen Laptop kann ich damit nicht überzeugen. Ich krame tiefer. In Berlin wohnte ich in der Wissmannstraße. Wissmann hat zwar nicht die Nofretete vom Nil weggeklaut, offenbar aber anderes Unheil in Afrika angerichtet, jedenfalls wurde ihm die Erlaubnis entzogen, dass im Grunewald etwas nach ihm heißen darf. Machtausübung durch Sprache. Ein alter Hut. Altes muss weg. Das ist Fortschritt und Strafe zugleich. Dementsprechend unbeeindruckt (hartschissig?) reagierte mein Laptop auf den Kolonisationsnamen. Den neuen Namen (irgendeines ehrenwerten Schwarzen) traute ich dem Computer schon deshalb nicht zu, weil ich mir sicher war, ihn nicht eingegeben zu haben. Dass nun mein Handy und mein Internet nicht funktionierten, ja, nicht mal mein eigenes Geschreibsel auf dem Bildschirm zu lesen und zu vervollständigen war, das brachte mich einem selbst durch flotte Pillen wenig beeinflussbaren Tobsuchtsanfall gefährlich nahe. Die immer beste Lösung: ‚alles ausschalten!‘ erweichte den Laptop schließlich beim dritten Versuch. Ohne weitere Fragen sprang er an. Ich vermied es, ihm Vorhaltungen zu machen. Man darf sein Gegenüber nur verärgern, wenn man es nicht mehr braucht.
Mein Körper, dem hier so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, hatte, um sich zusätzlich interessant zu machen, neben unerwünschten Bakterien im Kot auch Eiweiß im Urin zu bieten. Was da womit bekämpft wurde, war mir nicht ganz klar. Ich wusste nur, dass ich, um wieder vernünftiger gehen zu können, die in der hiesigen Nahrung nicht direkt vorherrschenden Proteine brauchte. Für den Rückbau meiner Wade hätte ich mir deshalb zusätzliche Proteine im Essen durchaus gewünscht. Im Urin empfand ich sie eher als störend, obwohl ich ihnen hoch anrechnete, dass sie nicht wehtaten. Auch die Diarrhö wäre ich gern losgeworden. Dieses ständige Aufs-Klo-Hetzen schlägt einem doch ab Mittag aufs Gemüt. Ich bat um Konsultation des diensthabenden Arztes.
Nach etwa einer Stunde wurde ich ins Dienstzimmer gerufen, in dem eine mittelalte Putzfrau auf Anweisungen wartete. Es musste wohl ein etwas schlimmeres Malheur passiert sein, dass Aufwischarbeiten sogar am Sonntag nötig waren. Ich wartete. Sie wartete. Nein, das ist jetzt keine Pointe, wirklich nicht. Kein Gag, ich war überrumpelt. Weißer Mantel muss ja nicht sein, aber geblümte Kittelschürze – da kommen so festgefahrene Menschen wie ich einfach nicht auf ein Medizinstudium. Trotzdem war ihr Auftritt ein voller Erfolg: Mir wurde das Antibiotikum gestrichen. Das war immer das ausladendste Geschütz im Mund gewesen. Zum Wegschlucken gänzlich ungeeignet.
Hier unterbreche ich; denn der nette Pfleger, der kein Hausmeister ist, brachte mir gerade etwas, das ich schon kannte, ein bisschen jedenfalls. Ich habe mir angewöhnt, dem vielseitigen Automaten im Speisesaal einen Espresso zu entlocken. Er kann noch weitaus mehr, aber mir reicht das. Ich platziere eines der Saftgläser unter die Alu-Abdeckung (ab dem zweiten Mal sogar auf der richtigen Seite, sodass der Kaffee ins Glas tröpfelt anstatt auf das Resopal), und dann stelle ich am Piktogramm von vier auf fünf Bohnen. Wenn auf der Tafel das Angebot verschwindet und stattdessen grafisch vier volle und eine leere Bohne erscheinen, drücke ich wieder, dieses Mal mit Macht auf die fünfte Bohne, damit die Maschine den Sud noch kräftiger liefert, und beim „Bitteschön“ nehme ich dem Apparat das stabile Glas weg und fülle mit etwas Alstertaler Tafelwasser auf, möglichst ohne Sprudel. So ganz, ganz bitter schmeckt mir nichts. Selbst Fernet Branca hat einen Hauch von Milde. Am sympathischsten ist mir der Apparat, wenn er mich liebenswürdig ermuntert: „Bitte nehmen Sie Ihre Hände vom Display!“ Ich kann ihm einfach nicht böse sein.
Jemand legt Puzzle an einem der Esstische. „Oh, das habe ich früher auch gern gemacht“, sage ich eifrig. In meiner Erinnerung entstehen romantische Landschaften auf der Tischtennisplatte. Ganze Sommerferientage verbrachte ich beim Zusammensetzen der Bilder. Die Sonne stand hoch über den Apfelbäumen und verschwand gegen sieben hinter der Nachbarvilla. Gegen Ende den Puzzle-Himmel zusammenzufummeln, das blieb immer schwierig. Ein paar Wolken waren hilfreich, um die letzten Teile ins Gemälde einzufügen. Die Vorlage auf dem Tisch des Patienten zeigt eine großflächige Ansammlung von Kapseln, offensichtlich Tabletten. Er müht sich an der schwierigen Aufgabe, die Einzelteile zusammenzusetzen.
„Wie kommen Sie denn auf dieses Motiv?“, frage ich ihn erstaunt.
„Wir duzen uns hier!“
Ach ja, ich weiß.
Am Süßstoffbehälter muss man drehen, er ist eine Art Mühle. Wie lange man drehen muss, damit überhaupt etwas herauskommt, und wie kurz, damit einem die Brocken nicht erst im Mund schmelzen, habe ich noch nicht herausgefunden.
Das kalte Wasser ist nötig, weil ich den Kaffee sofort trinken muss. Einmal habe ich ihn auf dem Gehwagen transportieren wollen, kam mit leerem Glas an meiner Zimmertür an und genierte mich ehrpusselig, das Getränk auf dem Flur vom Sitz zu lecken. Also trinke ich vor Ort und trage dann mein leeres Glas artig in die Küche. Dort machte sich gerade der Hausmeister/Pfleger zu schaffen. Er hatte rattengraue Würste in daumendicke Scheiben geschnitten und hantierte mit kurzen, halbrunden Nudeln herum, während Schmalz in der Pfanne schmolz. Ich sagte: „Oh!“ Etwas Intelligenteres fiel mir nicht ein. Er versprach mir, nachher eine Kostprobe vorbeizubringen. Ich bedankte mich schnell, solange das Erwartungsvolle noch echt klang.
Jetzt kam er also damit. Halb sechs. Abendbrot. Wenn er dran ist, gibt es immer etwas Besonderes. Er gibt sich wirklich Mühe! Der einzige Mann. Darum kann ich ab jetzt auch das mokante ‚Hausmeister‘ weglassen: Zu Verwechslungen kann es nicht kommen. Wenn er Spätdienst hat, bringt er mir meine Käsestulle zum Treppchen geschichtet, mit drei Gurkenscheiben und einem Dreieck Paprika: ein Kunstwerk.
Heute allerdings wurde es ernst. In einer Glasschüssel befanden sich nun die Rattenwurst und die Suppennudeln, zusammengehalten von heißem Schmelzkäse. Ich habe mich – aufs Ganze gesehen – in meinem Leben doch alles Mögliche getraut, aber das ging zu weit. Kaum war er aus dem Raum, hangelte ich mich ohne Gehwagen ins Bad und war, wie eigentlich immer, sehr dankbar dafür, mein eigenes Klo am Zimmer zu haben. Dass es in fremden deutschen Bädern keine Bidets gibt wie bei meinen beiden Zuhauses in Hamburg und in Italien, ist schmerzlich, besonders hintenrum, aber längst Gewohnheit. Ein anderes Problem: Die Pampe war dermaßen zusammengekäst, dass sie in einem Rutsch in die Schüssel klatschte: die Kloschüssel. Die Essschüssel war wie leergefegt. Unangerührt eben. Das ging natürlich gar nicht. Zu ehrlich! Gott sei Dank hatte ich – with compliments of the Anstalt – eine Wochenendtüte erhalten, darin Gummibärchen und Erdnüsse. Ich zerkaute ein paar Erdnüsse und spuckte sie in die Schüssel: von Käsenudelwurstresten nicht zu unterscheiden!
Wäre gar nicht nötig gewesen. Es wurde viertel nach sieben, und ich musste meine Abendtabletten abholen, ohne vorher aufgesucht worden zu sein. Als mir die Schwester den Blutdruck maß, kam er gerade rein. „War sehr gut!“, sagte ich. Ob es gelogen war, konnte ich ja nicht beurteilen.
„Oh, ich hab noch was! Wollen Sie noch ein bisschen?“
Ich war froh, dass das Blutdruckmessen gerade vorbei war.
„Ach, nein danke. Hat toll geschmeckt, aber ich kann nicht so viel essen.“ Der zweite Teil stimmte sogar. Meine Chips- und Schokoladenbestände sind fast alle. Ich habe nichts mehr. Da muss ich eben fasten.
Montag, 17. November
Eben kam eine ältliche Person in mein Zimmer und sagte, ich solle zum Essen in den Speiseraum gehen und nicht immer allein essen. Die Gemeinschaft sei doch so wichtig. Ich kannte sie noch nicht. Sie mich auch nicht. Bis jetzt. Sie sollte mich kennenlernen. Dass ich, wenn ich was nicht mag, gleich wütend werde, ist neu an mir. Gefällt mir. Trotzdem: Beherrschtheit vorgaukeln. Wortreich erläuterte ich ihr (wie vorhin schon hier), dass ich seit meinem Schlaganfall so essbehindert sei, dass ich Nahrung nicht mehr in Gesellschaft zu mir nehmen könne, ich äße für andere unzumutbar. Während ich so redete, dachte ich: Ich will mit diesen ganzen Leuten hier so wenig wie möglich zu tun haben, eigentlich gar nichts. Bin ich etwa menschenscheu geworden oder womöglich wirklich depressiv? Hoffentlich doch bloß arrogant. Ich weiß ja, der Stimmungsumschwung kommt, dann werde ich wieder netter. Auch mir selbst gegenüber.
Wenig später kam dann stattdessen das Tablett, von einer mir Bekannten getragen. Gestern war mir versprochen worden, in Zukunft bekäme ich nur noch halbe Portionen. Also, wenn so das Ergebnis aussah … Neben Unmengen von Reis türmte sich ein Schlammberg, mit Maiskörnern durchsetzt wie mit Eiterpickeln. Nach vier Löffeln musste ich schleunigst aufs Klo rennen. Das wäre eine viel glaubwürdigere Ausrede gewesen: „Ich kann nicht im Speiseraum essen. Ich schaffe es nicht von da bis zum Abort.“ Ganz plausibel, aber zu spät. Übrigens, der Toilettenpapierhalter ist etwas ungeschickt befestigt. Nur dreimal ist es mir in der ganzen Zeit gelungen, mich hinzusetzen, ohne dass die Klorolle weitschweifig in die entgegengesetzte Ecke kullerte.
Dienstag, 18. November
Endlich gab es mal wieder einen Termin. Die Psychologin stand auf dem Programm. Meine digitale Buchführung ist noch nicht richtig eingespielt, trotz so weniger Daten. Die Seelenexpertin kam zwar eine halbe Stunde früher als erwartet, hörte dann aber nicht weniger interessiert dabei zu, was aus meinem Mund kam, als ich mir selber. Plötzlich ging die Tür auf, und die Psychologin kam herein. Es war kein Déjà-vu. Die beiden Damen sahen sich nicht ähnlicher als Melania Trump und Mutter Teresa. Die eine betreut den Flur meines Hauses, die andere sitzt in der Hauptgeschäftsstelle, irgendwo auf dem weitläufigen Gelände. Zwei einander überschneidende Termine. Zu solcher Bedeutung hatte ich es inzwischen gebracht! Gleich aber die Ernüchterung. Wenn das zwei unterschiedliche Lebewesen waren: Was hatte ich bei den vorigen Treffen der einen gesagt, und was der anderen? Da ich zum Lügen zu vergesslich bin, brauchte ich mir um Falschaussagen keine Sorgen zu machen. Aber ein und derselben Person innerhalb kurzer Zeit zweimal das Gleiche aufzutischen, das ist völlig uninteressant. Schlimmer als dement. Oder ist es dement? Dann lieber erfinderisch schwindeln. Erst stand die Frage ‚Wer ist wer?‘ im Raum, dann beide Psychologinnen, dann setzte sich die schon Dagewesene wieder, die Neue ging, die Frage blieb stehen, und wie ich die Putzverhältnisse hier kennengelernt habe, steht sie dort immer noch. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Wenn mir das nun mit Freud und C. G. Jung passiert wäre …
Die beiden Studierten tun es von Berufs wegen, der Rest aus Pflichtschuldigkeit: Sie alle wollen mich ständig überreden, nicht zu trinken. Alkohol, meine ich. Sie befehlen es nicht, sie wollen es mir schmackhaft machen, aber ihre eher pädagogisch bemühten als verführerischen Künste verfangen bei mir nicht. Der Reiz, Nüchternheiten zu sammeln, ist nicht größer als die Verlockung, Bierdeckel oder Würfelzucker unterschiedlicher Marken zu horten. (Hab’ ich als Kind beides getan. Später waren es Kotztüten ausgefallener Fluggesellschaften für Silke. Inzwischen bin ich mir selbst ausgefallen genug und lasse solche Schubladenfüller weg.)
Die Psychologinnen erinnern mich an eine Mutter, wie meine nie war:
„Du musst es nicht tun, aber wenn du jetzt deinen Spinat aufisst, dann lese ich dir heute Abend ein Märchen vor.“
„Du liest mir doch sowieso ein Märchen vor.“
„Ja, aber dann lese ich dir ein schönes vor, ein ganz schönes Märchen …“
„Ich möchte aber lieber ein ganz hässliches hören!“
Und so weiter.
Um mich aufzuspielen, würde ich gern sagen: „Abends betrunken sein, das kann ja jeder, aber morgens schon betrunken sein, das ist geil!“ Aber im Allgemeinen ist die Vorstellung von etwas so befriedigend, dass man auf die Durchführung verzichten kann, besonders bei preisgünstigen Reisen und provozierenden Redensarten. Eine Zeit lang habe ich Wein und Bier gar nicht zu den alkoholischen Getränken gezählt, die reichten alphabetisch nur von Aquavit bis Zuckerrohrschnaps. Da war man früher eben versoffen, das war lustig, heute ist man ganz seriös ‚alkoholkrank‘. Das ist zu ernst, um darüber nicht zu lachen. Worte bedeuten viel. Mir vor allem. Bin ich lebenskrank?
Das Essen hier empfinde ich inzwischen als gut. Bloß wenn ich gerade am Schreiben bin, wird mir – Zufall oder Schicksal? – etwas Seltsames neben meinen Laptop gestellt, wie zum Schabernack. Doch sonst: appetitanregend gewürzt, in der Zusammenstellung kreativ erdacht. Besonders hervorheben möchte ich den punktgenau gedünsteten, meeresseligen Lachs und die Scampi, wie frisch aus der Lagune. Zur Maispoularde gab es Teriyaki-Gemüse. Da musste ich meinen Blick erst mal von der Speisekarte auf die Google-Eintragung schweifen lassen, um zu erfassen, was mir geboten wurde.
Ich denke schon an mein nächstes Buch: Alle Arten von Krebs
Quellenangaben: https://www.essen-und-trinken.de/krustentiere, IGK-Verlag: ‚Krebs fürchtet Pflanzen und giert nach Zucker‘, Jan-Dirk Fauteck/Imre Kusztrich
Mein Körper giert nur noch selten. Manchmal verlangt er nach Essen, vor allem nach 22.00 Uhr (Die abendlichen Psycho-Pillen? Der Drang wird mit Kartoffelchips kaltgestellt!). Mein Geist verlangt nach Denken, schon etwas eher am Tag. Als weitere Parallele fällt mir auf: Die Zunge findet nach dem Essen im Mund immer etwas, woran sie sich stören kann, und dem Verstand geht es beim Denken mit dem Hirn genauso.
Was mich ein bisschen nervös macht – ich würde es nicht gleich so aufbauschen und ‚wahnsinnig‘ nennen –, das ist der Umstand, dass mir, der ich eine wirklich umfassende musikalische Ausbildung genossen (oder jedenfalls bekommen) habe, ständig zwei Melodien ungebeten, und das auch noch gleichzeitig, durch dieses mein Hirn flattern.
‚Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier‘ und ‚Süßer die Glocken nie klingen‘. Warum nicht?, frage ich mich automatisch simultan zu meinen ungebetenen Eingebungen. Der Theologe und Pädagoge Friedrich Wilhelm Kritzinger (1816–1890), der Direktor der Lehrerinnenbildungsanstalt in Droyßig (wo ist das?), hat dieses Weihnachtslied erdacht, das ich als Kind immer uminterpretierte in: „Hallo Süßer! Warum bimmeln diese Scheißglocken denn nicht endlich?!“, und heute weiß ich, dass die Waikiki Brewing Company für einheimische Hula-Hulas und auswärtige Touristen Bier herstellt. (Als ich 1988 selbst vor Ort war, hat mich das Honolulu-Bier noch immer nicht so sehr beschäftigt, wie es bereits 1963 Paul Kuhn laut Lied zum Anliegen geworden war. Ich trank es. Schluss.)
Wenn ich das Licht ausgemacht habe, beginnt meine Nachtreise. Einschlafen steht dabei nicht auf dem Programm. Was dann? Durch mein Blut fließt hoffentlich genügend hormonbeeinflussendes Naschwerk, um mich gelassen zu halten. Gelassenheit wünsche ich mir so sehr! Aber wenn ich dadurch langweilig würde, könnte ich auf diesen Kick wohl verzichten. Außerdem fände ich es unsportlich, mir solche Gelassenheit nicht aus eigener Einsicht, sondern aus verordneten Substanzen zu beschaffen. Herrlich: Wenn ich mich ins Gestrüpp bedrohlicher Gedanken verirre und die Fassung zu verlieren drohe, kann ich läuten. Hier. Nur hier. Die Glocken klingen nicht so süß wie der Barbie-Tran, aber sie informieren die Nachtwache zuverlässig. Das empfinde ich als den Sinn meines Hierseins. Das Dasein bietet solchen Komfort nicht.
In meinem Alter ist es angemessen, seine Versäumnisse Revue passieren zu lassen und sich im Zuschauerraum zu grämen über das, was auf der Bühne nicht stattgefunden hat. Drei – natürlich flamboyante – Beispiele sollen reichen. Meine Nächte, meine Träume.

1.) Im November 1975 lernte ich Roland in Berlin kennen. Im Januar zog er zu mir nach Hamburg. Er hatte den mutigen Entschluss zu fassen, ich hatte die hasenfüßigen Kommentare abzuwimmeln. Als West-Berliner besaß Roland keinen Pass, brauchte aber einen. Für Israel. Damals schaffte ich das analog, was ich heute wohl auch digital schaffen würde. Niederlagen sind nicht so meins. Nach Eingaben und Telefongesprächen – was sind schon Behörden und Botschaften gegen einen verliebten Studienabbrecher? – bekam Roland seinen Pass und ich meinen Willen. Kennengelernt hatte ich Roland während der Aufnahmen mit einem Dirigenten des damaligen Jahrhunderts (er hieß Karajan), aber in Israel hatte ich zu tun wegen eines anderen Dirigenten, der gleichzeitig noch komponieren konnte (er hieß Bernstein). 1978 gab es die nächsten Aufnahmen mit dem Israel Philharmonic Orchestra, und selbstverständlich schleuste ich Roland wieder mit ein. So trunken und so klar haben die Orangenblüten nie wieder geduftet wie damals in Israel. Wir fuhren zu den Golanhöhen, nach Jericho, Hebron und Gaza. Es wirkte alles etwas runtergekommen, aber schön pittoresk. Die politischen Konflikte nahm ich gar nicht wahr. Eingebettet in meine Vorstellungen von Folklore sah ich nur den verwahrlosten Osten (Westjordanland) und die Sandwiches am Hilton-Pool in Tel Aviv.
Bernstein nahm Mendelssohn auf. Ich mag Mendelssohn. Wer ihn nicht schätzt, gerät bei mir sofort unter Antisemitismusverdacht, obwohl ich weiß, dass die Musikgeschichte Glorreicheres als ihn zu bieten hat. Trotzdem, angenehm anzuhören. Viel gefälliger als islamisches Gejaule. Diese beiden Themen: ‚internationale Musik‘ und ‚Juden‘ muss ich sofort völlig übergangslos beenden, sonst schreibe ich ohne abzusetzen weitere hundert Seiten.
Als krönenden Abschluss der Reise hatte ich für Roland und mich einen Aufenthalt in Eilat am Roten Meer geplant, aber das Orchester spielte nicht mit. Die Interpretation war so unzureichend, dass Nachaufnahmen fällig wurden. Als Produzent musste ich dabeibleiben. Das Flugticket nach Eilat verfiel, meine Laune erst recht, nur Roland blieb heiter (eigentlich nicht eine seiner hervorstechendsten Eigenschaften). Die Mendelssohn-Aufnahme ist längst aus dem Katalog gestrichen, aber meine Erinnerung an etwas mit Roland Nicht-Erlebtes wird nie verglühen.
2.) Für Gedanken und Gefühle ist Geografie ein Klacks. Der Geist kommt mit geringeren Bewegungen aus als der träge Körper. Schön, wenn man pfiffig genug ist, das unterscheiden und wählen zu können! Cairns, Australien. Temperatur: November bis April 34 Grad Celsius laut Wikipedia.
September 1985. Am drittletzten Abend habe ich den atemberaubenden Restaurantbesitzer endlich so weit. Er kocht, glaube ich, nicht, aber ich koche. Leidenschaft wäre zu viel gesagt, aber großer Appetit, das ist es. Der Ort ist nicht orientalisch-, sondern kolonialstil-weiß (Ist der Orient nicht eher bunt?). Alles wirkt auf mich so untouristisch, wie es nicht ist. Na und? Wo in der Welt bekäme ich sonst neben (australischem) Chablis auch die Besichtigung einer Schmetterlingsfarm und das Schippern durch einen Krokodilfluss angeboten? Je exotischer die Kundenbeschubse daherkommt, desto lieber fällt man auf sie rein.
„Vormittags bin ich immer am Strand“, informierte er mich überflüssigerweise. Ich hatte ihn längst dort gesehen. Übermorgen, wenn das Lokal geschlossen hätte, wäre es doch eine gute Idee, mich dort mittags zu treffen. Ich beantwortete sein weiches australisches Englisch mit meinem britisch und kalifornisch geschulten: einem Kopfnicken.
Am nächsten Tag stand der Ausflug auf eine verträumte, entlegene Insel bevor, so winzig, dass sie in der Nordsee ‚Hallig‘ geheißen hätte. Warum man da hinmusste, weiß ich nicht. Die Kaffeeplantage und erst recht die Krokodilmäuler waren bestimmt eindrucksvoller gewesen, als dieses Eiland es sein konnte. Aber wenn man unterwegs ist, muss dieses ‚Unterwegs‘ mit Unbekanntem so vollgestopft werden wie die bekannte Weihnachtsgans mit Äpfeln, Pflaumen und Maronen.
Das Boot konnte nur fünfhundert Meter vor der Küste ankern. Darf man zu diesem Gestade mit türkisblauen Miniwellen, die wie im Halbschlaf an mattweißem Sand verschwinden, überhaupt ‚Küste‘ sagen? Man darf alles. Bis man dafür eingesperrt wird. Mich traf das Los – für ‚Ereilen‘ war es zu langsam –, durch ein Korallenriff schwimmen zu müssen, bevor ich ans – nicht mal durch eine Imbissbude entstellte – Land traf. Nachdem ich interessiert festgestellt hatte, dass es nichts zu sehen gab, schwamm ich zurück.
Etwas später tat mir der Fuß weh. Auch das Knie ein bisschen. Die Versuche meines Geistes, seinen dazugehörigen Körper zu überreden, stillzuhalten – ich sei bloß hysterisch –, wurden leiblicherseits nicht ernst genommen. Die Vermieter des hübschen Hauses am Meer, in dem ich so wundervolle Tage verbracht hatte, gaben meinem Körper recht. Sie schickten mich zum Arzt, der mir seinerseits ein paar Spritzen gab. „Wenn Sie länger geblieben wären, hätte ich Ihnen gesagt: Legen Sie die Beine eine Woche lang hoch, dann ist es vorbei. Aber wenn Sie übermorgen abreisen, dann können Sie die Beine nur morgen hochlegen und brauchen jetzt ein Gegengift.“
Da lag ich dann also, die Beine hoch (sowieso nicht meine Lieblingsstellung), dachte an die Palmen, unter denen wir hingegossen im heißen Sand schwiegen, ganz miteinander beschäftigt, vom säuselnden Wind spielerisch geneckt, und blinzelte glücklich gegen das laue Licht. Ein Gefühl wie Orgasmus, nur schöner.
Am nächsten Tag erreichten wir das Flugzeug nur mit knapper Not. Der Tank war fast leer und die Tankstellen um sechs Uhr noch geschlossen. Ohne den Anschluss in Sydney hätte es für Hongkong schlecht ausgesehen, uns empfangen zu dürfen. Wir? Na ja, ohne meine Mutter habe ich so weite Reisen nie gemacht.
3.) Also, nach Wien traute ich mich auch allein. Wir nahmen Brahms’ Sinfonien auf, die das Männliche in mir mehr ansprechen, als Mendelssohn das tut, aber ich bin da nicht wählerisch und spüre dem Floh, der mich gerade juckt, nicht faunaversessen hinterher.
Wien. Nach dem Konzert im Musikverein war eine verschwiegene Zusammenkunft bei dem russischen Ballett-Star Rudolf Nurejew eingeplant. ‚Strictly confidential, of course‘. Bernsteins Manager drückte mir einen Zettel in die Hand: die heilige, hochgeheime Adresse. Immer auf Eindruck aus, fragte ich mich, ob ich wohl Nurejews Typ sei. Ob er meiner sei, fragte ich mich nicht, da hatte ich in Moskau schon ganz andere Kompromisse gemacht. Dann gab wieder Brahms den Ton an.
Das ganze Schlangestehen vor der Garderobe musste Bernsteins Assistent Charly durchstehen, ich drängte mich nur kurz in Bernsteins Garderobenraum, also ‚Backstage‘, um den Wartenden meine Wichtigkeit zu demonstrieren und dem Dirigenten zu sagen, dass mich sein Tempo im dritten Satz überrascht habe. Einige Jahre später flüsterte unser Aufnahmeleiter während des Konzerts mir zu: „Er will nicht sterben. Deshalb wird er immer langsamer.“
Vergnügt ging ich vom Musikverein zum Hotel Imperial. Die Zimmer sind ziemlich abgewohnt, aber der Name ‚Imperial‘ klingt gut, und die Nähe zum Musikverein muss man der Luxus-Beherbergungsstätte auch hoch anrechnen. In den späteren Jahren ging ich nur noch ins Imperial-Café und wohnte komfortabler, aber ich will nicht abschweifen.
Von meiner Konzertbesucher-Uniform galt es, sich in die ‚Ich bin Verkäufer, nicht Kunde‘-Uniform zu stürzen. Beim Umziehen fiel mir nichts aus der Tasche. Leider! Ich hatte den Zettel mit der Adresse verloren. Entsetzt rannte ich zum Musikvereinshaus zurück. Alles geschlossen, alle weg. Handys gab es noch nicht, das Telefonbuch versagte. So ein Schmerz! Ich sah Nurejew, wie er sich nach mir verzehrte und nie verwinden würde, mich nicht getroffen zu haben. Ich sah, welch unerträglich ausufernden Sex wir miteinander gehabt hätten. 1993 starb er an Aids. Natürlich hätte er mich angesteckt. Komisch, wie froh ich bin, dass ich noch lebe.
Mittwoch, 19. November
Ist es Mut, Bosheit, Neugier? Ich bin einfach schon wach, bevor die muntere Weckstimme ruft. Die Arglosigkeit im Tonfall stimmt mich milde. Ich werde fünf vor acht die morgendliche Runde beehren.
Sie dient dazu, den Tag zu strukturieren, hatte ich im ‚Einzelgespräch‘ erfahren. Wie die Psychologin das gesagt hatte, klang es ein bisschen so, als ob ein Augur dem anderen zutuschelt, seine Krähe sei heute linksrum geflogen. Aber nein. Sie nehmen hier alle Patienten gleich ernst. Das ist notwendig und bewundernswert, aber es schließt mich aus. Natürlich falle ich auf: durch meine farbige Kleidung und erst recht durch meine permanente Abwesenheit. Wenn ich mich dazusetze, werde ich mir nicht ‚missachtet‘ vorkommen. Als ‚nicht dazugehörig‘ bin ich mir so oft vorgekommen! Meine Eltern wollten immer sowohl außergewöhnlich als auch dazugehörig sein. Es wäre mir ein Vergnügen gewesen, ihnen das zu sagen, und sie hätten mir auch sofort zugestimmt. Es ist mir bloß nicht eingefallen. Damals. Um auch das, wie ja alles immer, dramatisch sorgfältig einzuordnen: Was wir zu wissen glauben, bedeutet etwas, aber wann wir die Worte finden, es auszusprechen, ist noch bedeutsamer.
Als ich um 13.00 Uhr (hier Nachmittag) zur ‚Quatschrunde‘ (meine despektierliche Bezeichnung) ging, mir meiner hochmütigen Unvoreingenommenheit sicher, hat mich das Problem der Anwesenden doch erschreckt: ihr Unvermögen, sich zu beschäftigen. Zum einen ist es das Wissen: Ich muss das jetzt tun, aber ich bringe mich nicht dazu. Zum anderen ist es die Frage: Womit kriege ich die Zeit rum? Beides ist mir geläufig.
Ich liebe Termine. Ohne Termine erledige ich null. Aber wenn mich die Deadline fordert, lässt mir mein Pflichtbewusstsein keine Ruhe.
Als Kind habe ich unsere Wirtschafterin Maria gefragt: „Was soll ich machen?“ Bis auf „Geh spielen!“ wusste sie auch nichts. Dann habe ich meinen Kopf auf Marias Schoß gelegt und gebettelt: „Tröste mich!“ Das wusste ich nicht mehr. Sie hat es mir später erzählt.
Alles Probleme, die ich nicht mehr habe. Auch die Langeweile, eine Grundstimmung, mit der sich Heidegger gründlich auseinandergesetzt hat, ist eine Empfindung, die mich nur noch in Gegenwart fader Menschen belästigt, nie mehr, wenn ich allein bin. Selbstbeschäftigung und genüssliche Untätigkeit stehen mir zu Gebote. Die Schwierigkeiten, ja, schlimmen Zustände, in denen sich diese Menschen hier befinden, berühren mich. Ich habe ein Gefühl dafür, wie furchtbar das sein muss. Unfähigkeit, Selbstvorwürfe, Hoffnungslosigkeit.
Sich überflüssig vorkommen. Die Mitarbeiter dieser Station haben eine wichtige Aufgabe: Sie sollen den Patienten das Gefühl nehmen, überflüssig zu sein. Gebraucht zu werden, ist ein wichtiger Antrieb. Ich beginne, einiges zu verstehen.
Dann muss ich doch in mich hineinlächeln. Jeder von uns bekommt ein Blatt Papier: ‚Liste angenehmer Aktivitäten‘. Die ersten zehn schreibe ich mal auf.
1. Ein spannendes Buch lesen
2. Eine Patience legen
3. Kindern beim Spielen zusehen
4. Kreuzworträtsel lösen
5. In einem Chor singen
6. Ein gemütliches Bad nehmen
7. Einen Tanzkurs machen
8. Brettspiele spielen
9. Kuchen oder Plätzchen backen
10. Wandern oder spazieren gehen
Ein weiteres Blatt Papier wird verteilt, zum Ausfüllen diesmal:
1. Was plane ich?
2. Was will ich erproben?
3. Was dabei könnte schwierig wer
Meine Nächsten, die ich liebe wie mich selbst, werde ich hier wohl nicht finden. Wenn überhaupt irgendwo. Eigentlich liebe ich mich auch gar nicht, ich will es mir bloß nett machen. Verachten tue ich mich dafür trotzdem nicht. Dazu habe ich einfach keine Lust. ‚Barmherzigkeit‘ und ‚Gnade‘ sind so schöne Wörter. Traurig, dass ich sie nicht mit Inhalt füllen kann.
Gedanken lasse ich mir nicht einfach durch den Kopf gehen; ich liebkose sie. Nicht denken zu können, stelle ich mir ärgerlich vor. Wäre nicht denken zu müssen womöglich eine Gnade? ‚Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihr‘, steht bei Matthäus 5.1 Jeder Kommentar dazu von mir wäre zu billig, um angemessen zu sein.
Mein Geist kommt mir noch beweglich vor, mein Körper so gar nicht. Ach, Gott! Nicht nur das Dasein, sondern das Das-Sein, was man sein will: es sich erträumen, erobern, erleben – oder aufgeben und genüsslich verkommen. Verlust aushalten, Überflüssigkeiten auch. Besser, etwas zu haben, was man nicht braucht, als etwas zu brauchen, was man nicht hat. Klingt naseweis. Gegenstände – auch Gedanken und Gefühle: überflüssig.
Etwas zu brauchen, was man nicht hat, tut weh. Etwas zu haben, was man nicht braucht, auch. Meistens. Man kann es wegwerfen, einstauben lassen, verhökern oder glorifizieren. Eigentlich ist es schön, Dinge los zu sein, und für Verpflichtungen gilt das erst recht: Keine Krawatte mehr nötig im Amt und im Restaurant; kein Gürtel mehr, weil Hemd über der Hose modern ist. Rutschende Hose ist ‚Loose Fit‘, ganz rutschende Hose allerdings legt Sportmangel, Fresssucht, Unterwäsche oder die Beschaffenheit des Geschlechtsteils frei. Und doch! All meine vielen schönen Krawatten von früher und die teuren Gürtel! Als ich ein Junge war, hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich an einem Sonntag die Kirche geschwänzt hatte, und habe mich geschämt, wenn ich es beichtete, allerdings mehr vor dem Pfarrer als vor Gott, der das ja bereits wusste. Jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen mehr, also vielleicht gar keins. Wie befreiend ist das denn? – Einstellungssache. Wenn ich mich im feinen Anzug auf eine Party begebe, auf der alle anderen in Rock und Bluse ablachen, oder wenn ich im T-Shirt in eine Party hereinschneie, auf der alle in Abendgarderobe Konversation pflegen, kann mir das peinlich sein. Oder es macht mir nichts aus. Nackt mag ich nicht. Finde ich indiskret. Verkleidet mag ich auch nicht. Finde ich zu gewollt. Passend und dermaßen richtig angezogen, dass es gar nicht auffällt, das fällt mir auf. Ich falle immer auf, wenn ich – einfarbig, aber sehr farbig – meine bleiernen Runden drehe. Gehwagen, Rollator, Rentner-Mercedes. Wenn meine geliebten, bereits Toten mich so sehen könnten: Ob sie Mitleid hätten? Schrecklich.
Mache ich noch den Eindruck, den ich machen will, oder ist mir das Gefühl dafür, wie ich wirke, abhandengekommen wie das Gefühl für die Bewegungen meiner rechten Gesichtshälfte?
Mein Kalender ist leer bis in den Dezember. Mein Kopf ist voll bis über den Rand hinaus. Schlafe ich? Träume ich? Ich schwimme weiter in dieser Unbekümmertheit, die ich wach höchstens denken, aber nicht durchhalten kann. Ich streife durch Leben, die ich nie geführt habe. Mir kommt das Geschehen auf ganz unaufdringliche Art bedeutend vor, im Nachhinein betrachtet. Langes Glück ist schwer auszuhalten. Ist Steigerung schon Glück?
Der schönste Augenblick ist zwei erheblichen Beeinträchtigungen ausgesetzt. Erstens: Man erkennt ihn nicht, hinterher aber doch. Zweitens: Man weiß gleich, dass er vorübergehen wird.
Ich stelle es mir befreiend vor, da rauszukommen, aber wie? Gar nicht. Ich lebe im Hausarrest meines Denkens: Diese Gefangenhaltung lässt Unterschiede in den einzelnen Stuben und Themen zu, aber sie gewährt mir nie die Freiheit der Gedankenlosigkeit, einer Freiheit, über die ich mich schäme, sie mir überhaupt zu wünschen.
Wenn ich betrunken genug bin, um Pornografie als Wirklichkeit zu nehmen, ist die Welt am schönsten. Am zweitschönsten ist sie, wenn ich Appetit habe und weiß, gleich gibt es etwas Gutes zu essen, und am drittschönsten ist die Welt, wenn ich daliege, ohne etwas zu wollen. Natürlich lasse ich mir so etwas nur selten durchgehen. Meistens zwinge ich mich dazu, eine Idee zu haben, sie verwirklichen zu wollen, und diesen Zustand bereits als das höchste Glück zu definieren. Dabei weiß ich doch: Man muss bis zum Äußersten gehen, um das Innerste zu erreichen. Wenn ich mich trotzdem mit mir selbst darauf verständigt habe, dass mir meine Wünsche wichtiger sind als deren Erfüllung, dann betrüge ich mich natürlich am angenehmsten, wenn ich mir das, hilflos-berechnend, erlaube. Erreichen tue ich damit zwar nichts, aber das muss ich aushalten. Also doch schon Gelassenheit? Gottgesandt …
Nein, nein, ich glaube nicht – aber ich hoffe.
Sonntag, 23. November
Mit dem heutigen Tag beginnen wieder meine Sonntagspredigten im Blog. Ich habe alle durchformuliert mit dieser Konsequenz, die ich im Schriftlichen gut hinbekomme. Es gibt den ‚Einstieg‘, den ‚Einsatz‘, den ‚Eindruck‘, den ‚Einfall‘, die ‚Einsicht‘, alle veröffentlicht, wenn dieser Text als ‚Ausstieg‘ zu lesen sein wird. Einfahrt, Einstein und Einbahnstraße habe ich mir verkniffen.
Aber Sonntag ist nicht nur Predigt-, sondern auch ‚Tatort‘-Tag. Wie jeder normale Mensch sehe ich gern drei bis vier Krimis pro Abend, aber ausschließlich öffentlich-rechtlich. Zahlen muss ich dafür sowieso, und die Werbung bei den Privaten halte ich nicht aus. Halte ich sie doch aus, ist der Film so schlecht, dass ich ihn mir und dem Regisseur bzw. der Regisseuse schenken kann. So degeneriert, mich auf die Reklame hinzufreuen, während die Ermittelnden ermitteln, so runtergekommen bin nicht mal ich.
Die nächsten drei Absätze bestehen aus Spoilern und sollten von Hobbydetektiven übersprungen werden. Für Drangebliebene kommt jetzt meine todsichere Beweisführung: Den Täter zu früh zu entlarven, beeinträchtigt zwar die Spannung, sorgt aber am Ende für Wohlgefühl. Lag man dann doch ausnahmsweise falsch, kann man die weggebliebene Spannung leider nicht nachträglich zurückholen.
Früher rauchten Inspektoren unablässig. Wer heute noch raucht, lässt sich leicht als Täter einordnen. Auch Alkohol, besonders Champagner am Morgen, gilt als Zeichen von Bösartigkeit, ausgenommen das Glas Rotwein (wegen der Farbe im Fernsehen) für den erschöpften Kommissar am Abend zu Hause. Die Kommissarin trinkt Bier aus der Flasche, um ihre Bodenständigkeit zu betonen. Verliebt sich die ermittelnde Person, dann höchstens in die Täterperson. Klar, sonst müsste das Objekt der Begierde ja in den nächsten Folgen wieder mitwirken, was dramaturgisch und finanziell für die Produktionsfirma nicht wünschenswert ist.
Wenn die Verdachtsperson zum Geständnis gedrängt wird, muss man auf die Uhr sehen. Sind es noch mehr als fünfzehn Minuten bis zum Schluss – unschuldig! Ausnahme: Es gibt eine Geisel, die demnächst stirbt, wenn sie nicht gefunden wird. In diesem Fall kann der oder die Schuldige schon zu Beginn feststehen, raten muss dann nur noch, wer den Anfang verpasst hat. Hilfreich für die fernsehende Person ist es, so geübt zu sein, dass man die Darstellenden bei Namen und Bekanntheitsgrad kennt. Der oder die Prominenteste ist immer Täter(in). Sonst hätte der oder die Schauspielende die Rolle gar nicht angenommen. Erst scheißfreundlich tun und nachher stammeln dürfen: „Es war ein Unfall!“, so geht Dramaturgie, und vor allem gilt es als dankbare Aufgabe für eingespielte Mimen. Da sowieso nur noch alte Leute im fortgeschrittenen Rentenalter linear fernsehen, weil alle anderen streamen, schadet es nicht, die Dutzendware mehrfach zu gucken: ist immer wieder fast wie neu. Ob anschließend Caren Miosga oder der nächste Krimi, diesmal im ZDF, geguckt wird, entscheidet der/die Fernsehende von Fall zu Fall, je nachdem, wer im Interview zur Strecke gebracht werden soll. Wer allerdings seine Schlaftabletten schon während der ‚Tagesschau‘ geschluckt hat, dem wird diese Entscheidung womöglich auf pharmazeutischem Wege abgenommen.
Donnerstag, 27. November
Jetzt habe ich doch noch einen Termin. Ich habe mich bei der Ärztin eingetragen, um zu erfahren, was meine Blutentnahme, meine Urinabsonderung und mein Kackepröbchen ergeben haben. Sie sieht kurz in ihre Kartei und sagt sehr zusammenfassend: „Alles in Ordnung!“
Ich erkundige mich, ob das Absetzen des Antibiotikums irgendwelche Auswirkungen gezeitigt habe. Sie ist verdutzt. Gar nichts eingetragen. Hat die Sonntagsputzfrau wohl verabsäumt. Na, wird schon in Ordnung sein. In meinem Rausschieben höre ich ihr routiniertes „Schönes Wochenende!“. Ich finde das etwas verfrüht. Es erinnert mich daran, dass während meiner Lehrlingszeit in der Buchhaltung die Angestellten ab elf Uhr auf dem Klo nicht ‚Guten Tag‘ oder gar nichts sagten, sondern ‚Mahlzeit!‘.
Was ich wirklich schätze: Lichterschmuck am Haus, auf den Fluren und in den Gemeinschaftsräumen gibt es erst seit dem ersten Advent. In den Straßen und Läden ist das anders. Kaufen die Leute mehr Quatsch, wenn er ihnen länger angedient wird? Ich blieb in meiner Klause verschont davon, christkindische Auswüchse ab Anfang November ertragen zu müssen. Es würde mir, glaube ich, nichts ausmachen, bis an mein Lebensende hierzubleiben. Ich dürfte es bloß nicht wissen.
Mittwoch, 3. Dezember
Ich befehle mir, die Unruhe, mit der ich zum zweiten Mal schon vor der allgemeinen Weckorgie aufwache, von Angst in Vorfreude umzudeuten, und schlafe nach dem üblichen – verlogen munteren – Schlachtruf ‚Guten Mor-geenn‘ tatsächlich nochmal ein.
Nun werde ich abgeholt. Jasper bringt mich nach Hause. Ich bin mehr gespannt darauf, als dass ich mich freue. „Das Leben geht weiter“, heißt es resignierend. „Nein!“, sage ich mir. „Ein neues Leben fängt an.“
Dem Sonnenaufgang zuzuschauen ist weihevoller, als in die Mittagssonne zu blinzeln. Vielleicht ist es mit der Abendsonne ja ähnlich. Na, das wüsste ich dann aber schon. Was ich bisher erlebt habe, das muss reichen. Zufrieden werde ich nicht mehr werden, aber vielleicht bin ich trotzdem glücklich. Weniger zu wollen, habe ich nie gewollt, und will es auch jetzt nicht. Aber ich trainiere daran herum. Die wohlige Düsternis dieser Tage hilft mir dabei. Mit Schrecken erinnere ich mich an das fordernde Hell des Sommers. Gut, dass die grelle Pest für dieses Jahr vorbei ist. Was armselig erscheinen mag, ist Reichtum, wenn er das Einzige ist, was bleibt – und bleibt – und bleibt.
Der Aufenthalt hier an diesem Ort mit Bindestrich, den ich nun verlasse, hat mir ganz gewiss gutgetan; völlig anders, als ich es erwartet hatte, aber Überraschungen sind ja belebend – bei schönen Dingen. Bei schlimmen ist die Planung besser. Jaja. So wie dieses laufen alle meine überflüssigen Selbstgespräche ab.
‚Hör auf! Schluss jetzt mit solch dämlichen Allerweltsweisheiten!‘
‚Planung ist sowieso immer besser!!‘
‚Halt die Klappe!!!‘
Schlussbemerkung
Da das Thema Sex hier aus naheliegenden Gründen bis auf ein paar flüchtige Reminiszenzen aus meinem früheren Leben nicht zur Geltung kommt, blieben ja überwiegend die Einnahmen (Tabletten, Lebensmittel) und die Ausscheidungen (Tabletten, Lebensmittel) übrig: als Gesprächsstoff für meine Leidensgenossen auf dem Flur und als Schreibstoff im Zimmer für mich. Sie bildeten den kleinsten gemeinsamen Nenner, der uns einte, selbst wenn sich die Pillen und die Portionen unterschieden und ich meine Gedanken hier jetzt triebhafter zur Begutachtung ausbreite, als andere das täten.
Ich mache aus jedem Elefanten eine Mücke und verstecke ihn auf diese Weise in scheinbar unbedeutenden Nebensächlichkeiten, die doch mehr noch als die paar wenigen überwältigenden Ereignisse, die uns betreffen, den Glanz und das Elend unseres Hierseins auf dieser ‚seltenen Erde‘ widerspiegeln. Das zu erfassen, zu erlernen und zu ertragen ist vielleicht der Sinn des menschlichen Daseins.
Amen.

Quellen: 1Die Bibel. Bergpredigt: Seligpreisungen. Die rechte Gesetzeserfüllung, Kap. 5–7
Grafiken: Kl-generiert via Midjourney | Video: H. R. Privatarchiv/Produktion: ALEKS & SHANTU

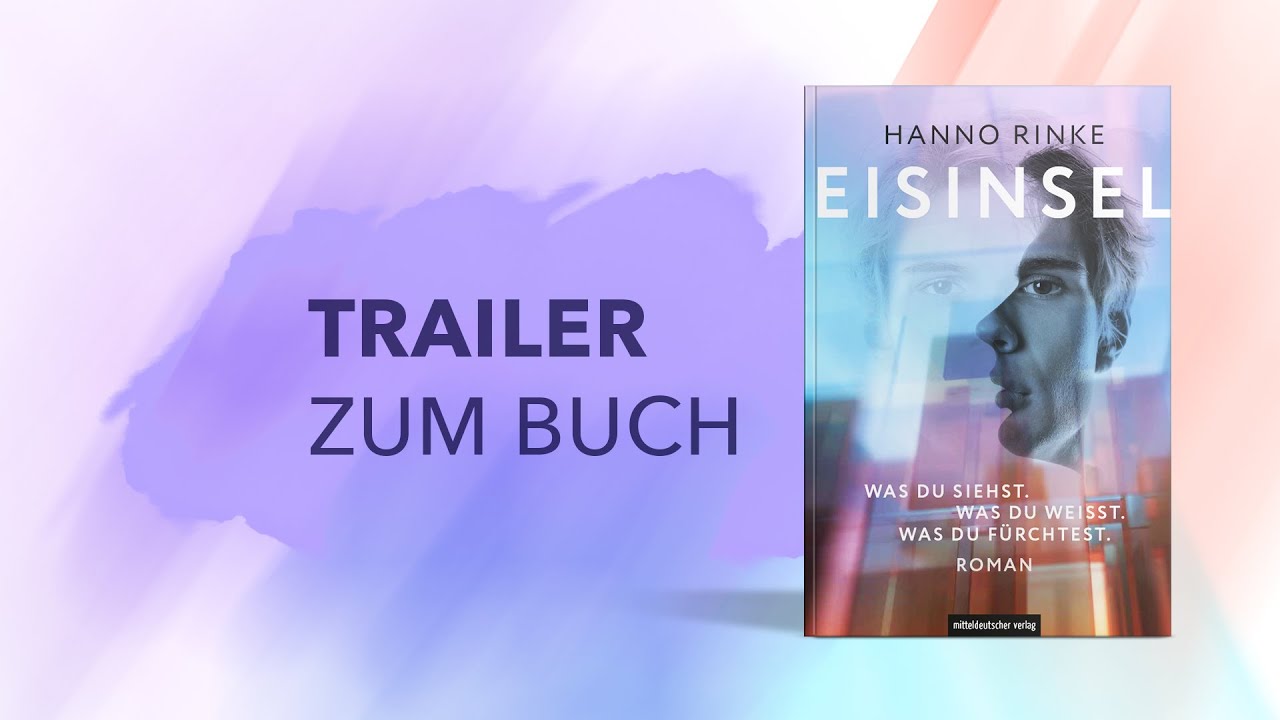
Oh, einen schönen letzten Sonntag in diesem Jahr, Herr Rinke. Durch die letzte Predigt arbeite ich mich später am Nachmittag im Zug. Aber ich danke schonmal für die vielen Nebensächlichkeiten.
Viel Vergnügen!
Ist das oben („Schwere depressive Symptomatik mit gedrückter Stimmungslage, Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Morgentief, Ängste, Freudlosigkeit, erhöhte Ermüdbarkeit, Grübeln und neg. Gedankenkreise, sozialer Rückzug, reduzierte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne ohne konkrete suizidale Pläne.“) wirklich eine echte Diagnose? Das passt so gar nicht zu dem Bild was ich Ihren Texten bisher entnehmen konnte.
Solch eine ehrliche Erwähnung und Beschreibung der depressiven Symptomatik, ganz ohne Pathos, ist ziemlich ungewöhnlich. Es tut nicht weh zu lesen, aber es bleibt ohne Frage hängen. Nicht wegen Dramatik, sondern wegen Wahrhaftigkeit.
Ich erinnere mich an einen älteren Text auf Ihrem Blog, ich bin nicht ganz sicher aus welcher Reihe, wo es bereits einen ähnlich ehrlichen Einblick in das Rinksche Leben und Schreiben gab…
Ich wünsche bereits alles Gute für das kommende Jahr!
Die Diagnose habe ich wörtlich abgeschrieben, glaube ihr aber nicht. Dafür habe ich meinen Drang nach alkoholischen Getränken etwas aufgebauscht.
Es gibt wohl kein besseres Beispiel für die deutsche Bürokratie: „Termine werden einem auf Zetteln übermittelt, und mir wurde gesagt, dass sich Termine überschneiden können, weil die einzelnen Abteilungen nichts voneinander wissen; dann solle man das bitte bei der Pflege melden.“
Komisch, dass das kein von mir erfundener Witz ist, sondern die Wahrheit.
In der Tat unglaublich!
Hauptsache, die Medikamente werden nicht vertauscht.
Schreiben nicht als Rückzug, sondern als Fortsetzung. Schreiben als eine Form von Gehen: ein Schritt nach dem anderen, ohne genau zu wissen, wohin. Vielleicht entsteht im Schreiben kein Sinn, aber ein Rhythmus. Etwas, das trägt, während sich die Dinge neu ordnen. Eine interessante Perspektive.
Mir ist klar, dass das kein Vorbild für jeden von uns sein kann.
Vielen Dank, Herr Rinke.
+1
So ehrlich, wie ich bin: Das ist wohl meine beste Predigt diesen Jahres, nicht bloß die längste.
Was diese Sonntagspredigt so besonders macht, ist seine Unverblümtheit: Es geht nicht um große Theorien, sondern um das direkte Erleben, das ganz banale Hin- und Her zwischen Körper, Alltag und Denken, das viele von uns kennen, aber selten so unverstellt lesen. Es geht um Hanno Rinke, aber es geht auch um uns alle. Was für ein schöner (?), oder zumindest bereichernder Text zwischen den Feiertagen.
Danke. So habe ich es gemeint.
Das Aufstehen im Text (so beiläufig beschrieben, aber so vielschichtig) ist mir in Erinnerung geblieben. Ein kleiner Wechsel im Raum, und schon beginnt etwas wie ein Tag, eine Haltung, eine Entscheidung.
Man muss nur darauf achten: dann passiert es.
Zwischen Selbstbewusstsein und Selbstverlust pendeln wir wohl alle ständig hin und her. Mal klar und gesammelt, mal zerstreut und unsicher. Vielleicht ist auch diese Bewegung kein Mangel, sondern ein Teil dieses Menschseins.
Es so zu sehen, hilft. Nichts ist einfach. Vieles möglich.
Da kann man ja fast nichts hinzufügen.
Schön, dass Sie es trotzdem getan haben!
Ich habe den Text nicht als pessimistisch gelesen, eher als müde auf eine produktive Art. Dieses Müdesein vom ständigen Positionieren, Erklären, Reagieren. Es klingt nach jemandem, der sich erlaubt, kurz stehen zu bleiben und nicht sofort weiterzurennen. Das wirkt fast schon radikal in einer Welt, die Dauerbewegung verlangt.
Pessimistisch bin ich auch nicht und wenn ich schreibe, nicht mal müde. Ich freue mich, wenn meine Gedanken den Alltäglichkeiten lustige Seiten abgewinnen können.
Geduld macht keinen Spaß, das Alter auch nicht.
So spaßig fand ich die Jugend auch nicht und hüte mich davor, sie zu verklären.
…eher im Gegenteil. Vieles war Unsicherheit, Überforderung, ein ständiges Vergleichen mit anderen, die angeblich schon wussten, wer sie sind. Freiheit fühlte sich oft weniger nach Leichtigkeit an als nach Orientierungslosigkeit. Vielleicht verklärt man die Jugend nur deshalb, weil man im Rückblick vergisst, wie anstrengend es war, dauernd werden zu müssen, statt einfach sein zu dürfen.
Die Adenauer-Zeit war für Aufmerksame nicht so bleiern, wie sie heute oft dargestellt wird, und die Willy-Brandt-Zeit hatte riesige Probleme, die, wenn von ihm die Rede ist, oft ausgeblendet werden. Ich hatte Schwierigkeiten durch die Religion, andere durch ihr Elternhaus. Aber wer Nostalgie mag, soll ruhig von der ‚heiteren‘ Vergangenheit schwärmen. Tut ja keinem weh.
Schwärmen und verklären schadet ja auch nicht. Es empfiehlt sich trotzdem die Gegenwart nicht völlig zu ignorieren.
… nicht mal die Zukunft sollte man ignorieren. Für mich und meine Umgebung sehe ich sie recht rose, für die Welt eher gräulich.
Grau bis schwarz. Soll man an einen Frieden in der Ukraine glauben? Ich traue weder Trump noch Putin.
Wenn es einen Frieden gibt, dann einen Diktat-Frieden mit anschließender Guerilla-Tätigkeit. Das kennen die Russen ja schon aus Afghanistan, wo sie davor ausgerückt sind. Die Ukrainer sind aber moderner ausgestattet, als es die Taliban waren. Da wird man sich in Moskau noch wundern.
„Dumm und langweilig“ scheint tatsächlich die Regel zu sein 🫢
Eine meiner seltenen Übertreibungen.
– Der oder die Prominenteste ist immer Täter(in). Sonst hätte der oder die Schauspielende die Rolle gar nicht angenommen.
😆
Erfahrung trägt mehr zur Komik bei als kindliche Unwissenheit.
Ich habe mich an mehreren Stellen wiedererkannt, auch wenn meine Geschichte anders aussieht. Ich danke.
Gern. Den Wiedererkennungswert schätze ich sehr hoch ein. Dafür schreibe ich.
Verklärt man Angela Merkel so leicht weil Friedrich Merz so schlecht ist?
Man kann Merz vieles vorwerfen, aber ganz so eindimensional, wie er oft dargestellt wird, ist er nicht. Er steht zumindest klar für Positionen, die man greifen kann, statt sich hinter wohlklingenden Unschärfen zu verstecken. Das wirkt in einer politischen Landschaft, die oft auf Ausweichen und Moderation um jeden Preis setzt, fast schon wohltuend.
Außerdem bringt er wirtschaftliche Kompetenz mit, die nicht nur aus Schlagworten besteht. Dass er unangenehme Themen offen anspricht, sorgt zwar für Reibung, verhindert aber auch die Illusion, Politik ließe sich ohne Konflikte machen. Nicht jede Zuspitzung ist Populismus, manchmal ist sie schlicht Klartext.
Und schließlich zwingt Merz seine Gegner dazu, Argumente zu liefern statt moralischer Abkürzungen. Man muss ihn nicht mögen oder wählen, um anzuerkennen, dass er Debatten schärft. In Zeiten großer Verunsicherung ist das nicht das Schlechteste.
Nun ja. Debatten schärfen tun viele.
Merz macht deutlich eine bessere Außenpolitik als sein Vorgänger. Gewählt werden muss er allerdings von Inländern. Die nicht genügend zu hofieren, hat die Demokraten in den USA jetzt schon zweimal den Sieg gekostet.
Außenpolitische Kompetenz ersetzt jedenfalls keine emotionale und soziale Bindung nach innen.
Wenn Wähler klug wären, würde ich der Demokratie noch mehr vertrauen.
Wenn Wähler klug wären, wenn Politiker ehrlicher und weniger machtversessen wären, wenn die Business-Elite menschlicher wäre…
Das Paradis kommt hinterher. Für die Guten!
Ich mag Merz nicht und traue ihm auch nicht. Wer es momentan besser machen könnte ist allerdings ebenfalls schwer zu sagen.
Das müsste dann ja auch eine Wahl entscheiden, der sich kein vernünftiger Mensch stellt.
Mein Take-away: Auch in schwierigen Phasen oder beim Ausstieg aus alten Mustern bleibt die Möglichkeit, Freude und Zufriedenheit zu erleben. Das vermittelt Mut und Zuversicht.
Das ist mir wichtig. Ein gestaltetes Leben wartet nicht auf Glücksmomente von außen, sondern besteht in der Überwindung von Schwierigkeiten: mit Humor, der lächelnd hinnimmt, oder durch Einsicht, die zum Handeln drängt.
Anders geht es ja gar nicht. Man muss alles so nehmen wie es kommt und versuchen das Beste daraus zu machen.
Nehmen, wie es kommt, klingt ein bisschen nach Abfalleimen. Gut, dass man Kartoffelschalen und Ungerechtigkeiten nicht (mehr?) widerspruchslos schlucken muss.
Das ist vielleicht Ansichtssache. Aber man kann ja nicht haben, was es nicht gibt. „Nehmen wie es kommt“ kann auch eine sehr aktive Haltung sein. Nur ohne Illusionen.
Das ist nie berühmte Unterscheidung: das Unabänderliche gelassen hinnehmen und das Veränderungsmögliche anpacken.
Wenn man es bisher nicht gemeistert hat, kommt das gleich wieder auf die Liste mit den guten Vorsätzen.
Mit guten Vorsätzen sei der Weg zur Hölle gepflastert, heißt es. Der Mensch ist nun mal weniger gut, als er glaubt.
Wie man wieder gut erkennen kann: Man muss nicht alles dramatisch inszenieren, um Erkenntnisse über sich selbst zu gewinnen – gerade die leisen Beobachtungen bleiben nachhaltig.
So leise finde ich den Text gar nicht.
Jaja. Ich liebe beides: leise Beobachtungen und Krawall.
Auch das passt zum Jahreswechsel.
Und so gut wie immer …
„Ein neues Leben fängt an“ klingt toll und passt wie angegossen zum Übergang ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke. Ich mir auch, und Ihnen erst recht!
Ich vergaß fast, dass Ihrem Schreiben diese spannende Tätigkeit bei der Deutschen Grammophon vorausgegangen ist… Wer so viele „Große“ aus der Nähe gesehen hat, muss sie weder kleinreden noch aufblasen. Aber interessante Geschichten sind das allemal.
Ja, es war interessant. Ich musste mich darauf einstellen, aber auch durchsetzen.
Das Jahr geht zu Ende, und wie jedes Mal frage ich mich: Wo ist die Zeit bloß geblieben? Ich wünsche trotzdem einen guten Rutsch!
Rutsch ist toll! Aber ich gleite lieber…
Ich habe einige Videos vom Berliner Glatteis in den letzten Tagen gesehen. Da wurde viel „Gleiten“ versucht, aber meistens ist doch im „Rutschen“ geendet.
Wie im wahren Leben.
Womit kriege ich die Zeit rum um das, was jetzt zu tun ist, nicht tun zu müssen? Das ist in der Regel meine Frage. Zumindest Zuhause. Während der offiziellen Arbeitszeit ist so eine Überlegung ja meistens schwierig.
Da hilft vermutlich vordergründig, sich zu belügen, aber ich empfehle es nicht. Besser mit Anlauf rein ins Meer des Missvergnügens. Wenn man erst mal drin ist, ist es auch nicht mehr so kalt.
Haha. Das Bild vom „Meer des Missvergnügens“ gefällt mir sehr … vor allem, weil es stimmt. Das Drumherum ist oft schlimmer als das Drinsein. Das Zögern, Ausweichen, Verhandeln mit sich selbst kostet meist mehr Energie als der Sprung. Und manchmal stellt man überrascht fest: Es trägt einen sogar.
Besser als das dünne Eis der Saumseligkeit.
Was für ein Batzen von einer Predigt! Ich habe eine Weile gebraucht um mich da durch zu arbeiten. Mit Sicherheit nicht nur eine Ihrer längsten, sondern auch Ihrer besten Sonntagstexte. Auf in ein neues Jahr.
Schön, dass Sie das auch so sehen! Ich danke Ihnen und freue mich.
Auch (oder gerade) weil das Jahr und diese Blogstaffel nun schon wieder zu Ende gehen, wünsche ich alles Gute. Dass es genügend Gründe für neue Texte gibt, geht ja aus dem aktuellen hervor. Dass das kommende Jahr langweiliger wird, ist auch nicht abzusehen. Bis bald, Herr Rinke. Wir lesen uns sicher bald wieder.
Sehr gern! Die Dinge passieren sowieso. Was man daraus macht, hängt vom Talent und vom eigenen Willen ab. Als aufmerksamer Zuschauer sehe ich vielleicht mehr als ein unmittelbar Beteiligter, der darauf achten muss, dass ihm das Gesträuch nicht über den Kopf wächst.
Einen guten Rutsch und bis zur nächsten Predigt
‚Zwischen den Tagen‘ ist ja immer. Aber jetzt sagt man es besonders oft. Also: einen guten Übergang für alle, die das lesen!
Ich stehe zu meiner elitäten Gesinnung, indem ich zugebe, dass ich ein Glas Champner einer Packung Bango Macho Knallkörper vorziehe. Schlange stehen würde ich für beides nicht.
Wann kommt denn nun endlich das Böllerverbot? Die Mehrheit ist doch längst dafür.
Dafür haben wir eine ‚repräsentative‘ Demokratie, damit es im Eizelfall nicht mehr nach dem Willen des Volkes geht…
Ist gerutscht.
Einschlafen steht bei mir in den letzten Tagen erstaunlich wenig auf dem Programm. Dabei dachte ich, dass ich mich zwischen den Tagen mal komplett ausruhen würde.
Bis zum 5. gibt es ja auch noch ein paar ruhigere Tage, nicht?! Guten Rutsch allerseits.
Zu den Dingen, die besonders schlecht gelingen, wenn man sie sich fest vornimmt, gehört das Einschlafen. Wer schlafend nach 2026 hinübergleiten möchte, sollte sich statt Böllern Ohropax besorgen.
Ich habe den Text nicht am Stück gelesen, sondern in Etappen. Und jedes Mal war da ein Satz, der hängen blieb und später wiederkam, irgendwo zwischen Abwasch und Abendspaziergang. Für mich ein Zeichen, dass er mehr tut, als nur gelesen zu werden. Ich danke.
Ich dachte auch gleich, man klappt den Text am Ende zu und merkt: Er ist noch nicht fertig mit einem.
Das geht sogar mir selbst so. Wobei ich mich zwischen Abwasch und Abendspaziergang ganz wohl fühle, wenn auch nicht auf die Dauer.
Die Passage über Gewöhnung als größte Macht hat etwas Unheimliches. Nicht das Böse, nicht das Verbotene, sondern das Abflauen. Dass selbst Freiheit, Lust und Glück stumpf werden können, fühlt sich unangenehm realistisch an. Der Gedanke, dass nicht Strafe, sondern Routine das Paradies entwertet, bleibt besonders hängen.
Wenn man das weiß, kann man aber dagegen anarbeiten.
Guten Rutsch, Herr Rinke! 🥳
In diesem Jahr mal wieder unter Menschen: nicht Zuhause, sondern im Lokal. Bin neugierig, wie ich das finden werde.
Das klingt gut. Ich wünsche ebenfalls einen guten Rutsch ins Jahr 2026 und viel Erfolg mit dem neuen Buch!
Mein Herz gehört denen, die jetzt allein sind, ohne es zu wollen.
FROHES NEUES JAHR 2026! 🥂
Ein frohes, gesundes, ruhiges, erfolgreiches neues Jahr allerseits
Fromme Wünsche! Ich schließe mich – leicht skeptisch im Politischen, hoffnungsvoll im Privaten – Ihnen an.
So, ich habe mich in den letzten Tagen nun genug entspannt. Dieses Dauer-Runterfahren macht ja auch irgendwann matt. Fürs neue Jahr kann nun wieder etwas mehr Lebendigkeit kommen. Es kann von mir aus losgehen…
Die bald einsetzenden Reaktionen auf mein neues Buch sind mir Lebendigkeit genug.
Obwohl ich den Text gerne gelesen habe, sind die Beschreibungen aus der Klinik doch schwer. Ich hoffe auf ein schöneres 2026. Im Privaten, wie auch für Gesellschaft und Politik.
Ich versuche dem Klinik-Alltag doch komische Seiten abzugewinnen. Leichter geht’s nicht.
Diese Aufstellung „1. Was plane ich? 2. Was will ich erproben? 3. Was dabei könnte schwierig werden“ passt ja perfekt zum Start ins neue Jahr
Aber auch: Was kann man überhaupt planen in so einer unberechenbaren Zeit?
Planlos durchs Leben geht aber auch nicht.
Dann kommt man nur sehr selten weit.
… und wenn doch, womöglich in die verkehrte Richtung.