
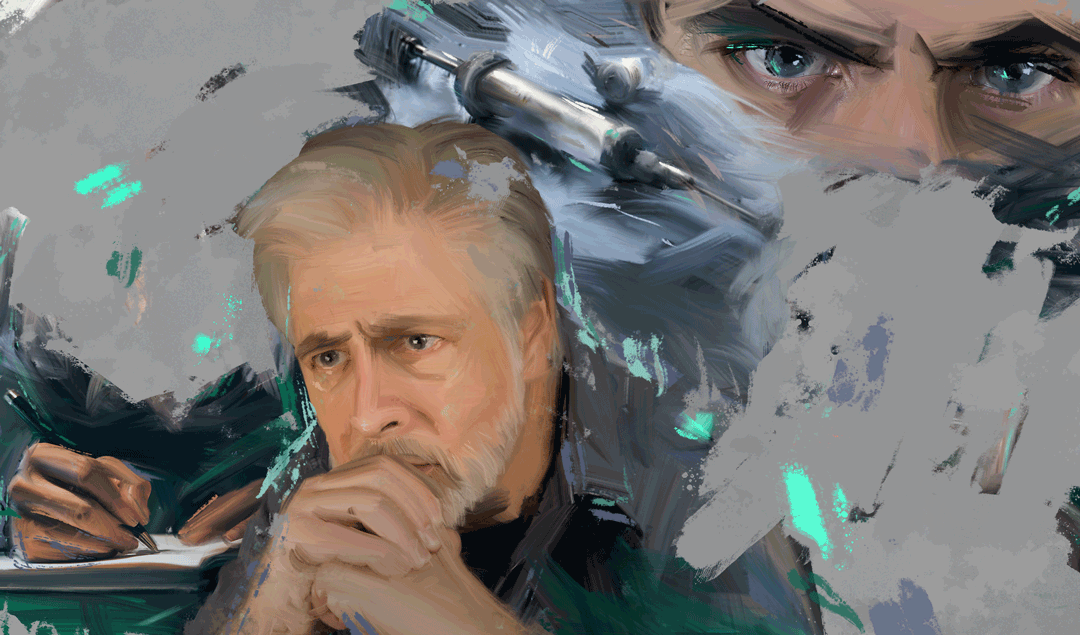
Von Minute zu Minute wurde ich unruhiger. Ich quälte mich mit sinnlosen Vorwürfen und malte mir Claudias Zustand in den schrecklichsten Farben aus. Wie unter einem Zwang irrte ich durch das Zimmer, aufgerieben zwischen den stummen Wänden und meinem dröhnenden Kopf. Jedes Mal, wenn ein Geräusch von der Straße hineindrang, sprang ich atemlos ans Fenster. Schließlich fiel ich erschöpft in einen Sessel und geriet in einen ruhelosen, wirren Halbschlaf.
Das Schnappen der Haustür schreckte mich auf. Ich lief zur Tür und stürzte in die Diele. Claudia wurde von einem Pfleger aus dem Krankenhaus gehalten. Ich kannte ihn flüchtig.
––Claudia zuckte zusammen. „Vater! Was hast du?“ Sie war schmal und blass.
––„Wie geht es dir?“, fragte ich.
––„Sie hat etwas genommen“, sagte der Pfleger. „Am besten geht sie gleich ins Bett.“
––Sie stützte sich mit einer Hand am Treppengeländer ab. „Ich bin ein bisschen schwach. Aber es geht schon. Ich bin furchtbar müde. Gute Nacht!“ Ihre Bewegungen waren unsicher. Ihre Stimme war seltsam. Wie betrunken hörte sie sich an. Sie stieg langsam die Treppe hinauf.
––Der Pfleger hob die Hand zu einem unbeholfenen Gruß und ging rückwärts aus der Tür. Ich fragte ihn nichts. Ich wusste nicht, wie; ich wusste nicht, was. Ich wusste gar nichts. ‚Was für einen traurigen Gang sie hat‘, dachte ich, als Claudia hinter der Biegung verschwand.
Natürlich hätte ich ihr nachlaufen müssen, ihren Namen rufen, mit ihr sprechen, bloß irgendetwas sagen, alles Weitere hätte sich von selbst ergeben. Wir hätten einander erkannt und umarmt. Aber ich war wie erstarrt. Ich war gelähmt. Fehlte mir der Mut oder die Liebe? War es Unbeholfenheit oder die Erleichterung, sie wieder in meiner Nähe zu wissen? Ich ließ sie allein in ihrem Schmerz und blieb selbst allein. Ich fühlte mich leer und enttäuscht über ihre Verschlossenheit. Im eigenen Haus war ich ein Fremder. Im eigenen Haus und überall.
Ich kam kaum zur Ruhe in dieser Nacht. Ich zählte die Stille und stellte mich schlafend. Der dichte Nebel schien alle Geräusche abzufangen. Meinen Gedanken blieb keine Zuflucht. Ich warf mich hin und her im Bett und konnte nicht entkommen. Dabei sehnte ich mich so sehr nach einer Gnadenfrist: der Leere des Schlafes vor dem nächsten Morgen mit seinen jagenden Gedanken, vor dem Tag, der Entscheidungen verlangte, und dem Abend, der Verzweiflung bringen musste. Gegen halb acht gab ich es endlich auf und machte mich fertig. Ich war zerschlagen und übernächtigt, aber trotzdem grell wach, von einem schmerzlichen Bewusstsein durchdrungen, ohne dabei klare Gedanken zu fassen. Als ich die Treppe hinabstieg, um ins Esszimmer zu gehen, hätte ich nicht mehr sagen können, ob ich mich rasiert hatte oder nicht.
Claudia saß schon beim Frühstück, genauer gesagt, sie saß vor einem in zwei Hälften zerteilten Brötchen, und starrte mit einem schmerzlich dumpfen Blick auf die beiden ungleichen Teile, die ein willkürlicher Schnitt getrennt hatte. Als sie mich sah, schrak sie auf und begann, mit ein paar flüchtigen Bewegungen Butter auf dem Brötchen zu verteilen.
––„Na, fühlst du dich heute besser?“, fragte ich. Das Lauernde in meiner Frage schien ihr entgangen zu sein.
––„Es wird schon gehen“, antwortete sie gleichgültig.
––„Du siehst blass aus! Willst du nicht lieber im Bett bleiben?“
––„Es wird schon gehen“, wiederholte sie in unverändertem Tonfall und griff nach der Zeitung, um anzudeuten, dass sie nicht bereit sei, das Gespräch fortzusetzen.
––Ich setzte mich ihr gegenüber und beobachtete, wie sie lustlos an dem Brötchen kaute, während sie versuchte, einen Artikel zu lesen.
––Plötzlich ließ sie die Zeitung mit einer widerwilligen Bewegung sinken. „Was hast du?“, fragte sie, „warum starrst du mich an?“
––Ich senkte den Kopf und hörte, wie sie nach der Kaffeekanne griff und mir die Tasse vollgoss.
––„Entschuldige, ich bin nicht ganz bei mir heute Morgen! Ich habe schon eine Tablette genommen. In einer halben Stunde ist es vorbei.“ Sie trank mit einem kurzen Schluck ihre Tasse leer, faltete hastig die Zeitung zusammen und stand auf. Im Vorbeigehen streifte sie meine Schulter mit einer flüchtigen Bewegung. „Bis heute Abend! Und denk daran, dass du dich noch bei Landers bedanken wolltest!“
––Ich drehte mich um. „Claudia!“
––„Ja?“ Sie blieb in der Tür stehen.
––„Claudia … gestern Abend …“ Ich machte eine kurze Pause.
––„Hat es nicht Zeit, bis ich zurückkomme? Ich muss mich jetzt wirklich beeilen. Entschuldige!“ Sie schloss die Tür und lief mit ein paar schnellen Schritten durch die Diele. Die Haushälterin sagte irgendetwas zu ihr.
––„Ja, gut. Machen Sie es damit!“, antwortete Claudia. Sie rief noch einmal laut: „Bis heute Abend“, dann fiel die Tür hinter ihr ins Schloss.
––Ich sah auf meinen Teller und versuchte, mir sein Muster genau einzuprägen, als wäre das von irgendwelcher Bedeutung. Essen mochte ich nichts. Ich trank meinen Kaffee aus und ging hinüber in die Praxis. Glücklicherweise war Mittwoch und deshalb keine Sprechstunde. Trotzdem gab es eine ganze Menge zu erledigen, was mir nur recht war. Meine Assistentin und ich, wir waren bis zum Mittag beschäftigt. Anschließend hatte ich noch einige Besuche zu machen. – Ein Hausarzt alter Schule.
Die ganze Zeit über täuschte ich mir eine fadenscheinige Gelassenheit vor, indem ich mir sagte, es sei ganz selbstverständlich, dass ich auf Christians Bitte nicht eingehen würde, sondern das tue, was meine Pflicht als Arzt war. Erst danach wollte ich eingehend mit Claudia sprechen.
Als ich von meinen Krankenbesuchen zurückkam, ging ich also, als wäre überhaupt nichts geschehen, in mein Zimmer, um die Arbeit an meiner Studie fortzusetzen. Doch natürlich kam ich nicht dazu. Denn jetzt, wo ich gezwungen war, in Ruhe nachzudenken, stiegen die Zweifel wieder übermächtig in mir empor. Sicher, von Christians Drohung, die Abtreibung aufzudecken und sogar den Verdacht zu nähren, dass ich daran beteiligt sei, durfte ich mich nicht beeinflussen lassen. Das war ohnehin töricht, und er hatte es unüberlegt gesagt, als er kaum noch Herr seiner Sinne war. Auf der anderen Seite waren, falls es wirklich dazu kommen sollte, schon die rein psychischen Schäden für Claudia gar nicht abzusehen. Sie hasste nichts mehr, als wenn persönliche Dinge ans Licht der Öffentlichkeit gezogen wurden. Das dachte ich jedenfalls, weil es die Einstellung meiner Frau gewesen war.
––Christian, nicht mir, hatte sie sich anvertraut.
––Er hatte sie verraten. Wie sehr musste sie das treffen!
––Ob sie tatsächlich das Morphium für ihn stehlen würde? Ob sie Brittas Beispiel vor Augen in ihrer Verantwortungslosigkeit, in ihrer Hörigkeit so weit gehen würde, obwohl sie wissen musste, dass sie dadurch dem Menschen, den sie liebt, nicht hilft, sondern immer mehr schadet?
––‚Claudia versteht mich eben besser als Sie!‘, hatte Christian gesagt. Aber bedeutete Verständnis, bedeutete Liebe, einem Menschen seine Wünsche zu erfüllen, auch wenn man weiß, dass die Erfüllung dieser Wünsche ihn zerstört? Ist Liebe nicht vielmehr ein Lenken zum Guten, zum Bestmöglichen hin? Nein, jedes Aufdrängen des eigenen Willens, alles Besitzen- und Beherrschenwollen nutzt die Zuneigung nur als Vorwand für Selbstsucht und Eigennutz! Vielleicht ist es wirklich ein Kennzeichen der Liebe, den anderen in allem, was er bewusst tut, zu unterstützen, und wenn es die Selbstvernichtung ist. Den Partner so zu lieben, dass man bereit ist, ihn aufzugeben.
––Ich zwang mich, in alle Richtungen zu denken, aber glauben tat ich das nicht. Das waren sowieso keine Gedanken, die mich weiterbringen konnten. Ich hatte lediglich nach Vernunftgründen zu entscheiden, und die Vernunft gebot es, Christian einer genauen Untersuchung zuzuführen. Ich kam mir vor, als schriebe ich einen Bericht für die Krankenkasse. Alles tun, damit die nötigen Maßnahmen getroffen werden konnten, um ihn wieder zu dem zu machen, wogegen er sich so verzweifelt wehrte. Mir war bewusst, dass Claudia mir diese Entscheidung nie würde verzeihen können, selbst wenn sie sie vom Verstand her billigen musste. Aber darum ging es nicht. Ich durfte nicht aus eigennützigen Beweggründen handeln. Nicht, wie ich am besten davonkam, sondern was wirklich das Beste war, musste ich zu ergründen versuchen. – Objektivität, der Vorteil des Außenstehenden, der Vorzug des Alters.
Ob sich Claudia von mir abwenden würde, durfte mich genauso wenig beeinflussen wie die Frage, ob eine unterstellte Abtreibung meinen Ruf so weit untergraben würde, dass dadurch die Durchschlagskraft meiner wissenschaftlichen Erkenntnisse gehemmt werden konnte. Doch was war für Claudia das Beste? Und was war für Christian das Beste? Ihn retten? Was bedeutete das? Vielleicht war der Weg, für den er sich entschieden hatte, jetzt, da er ihn ohnehin eingeschlagen hatte, tatsächlich der beste. Selbst wenn diese Vorstellung dem natürlichen Empfinden widersprach.
––Ich musste vor allem an Claudia denken! Doch sollte ich so handeln, wie sie es von mir erwarten würde, oder so, wie ich glaubte, dass es das Richtige für sie war? Was würde sie denn überhaupt von mir erwarten?
Was ich auch täte, in jedem Fall musste ich Claudia und Christian Schmerzen zufügen. In jedem Fall würde auch ich unter meiner Entscheidung zu leiden haben. – Und in jedem Fall würde ich mir hinterher Vorwürfe machen.
Angenommen, ich würde Christian tatsächlich das Morphium geben, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, es wäre für ihn besser, ein kurzes erfülltes Leben zu führen, von wachsendem Ruhm begleitet, als nach einer mühseligen Entziehungskur in seiner künstlerischen Schaffenskraft gebrochen zu resignieren, müsste ich mir nicht trotzdem sagen, ich habe seinen Erpressungsversuchen nachgegeben und mich durch die uneigennützigen Gründe nur zu betäuben versucht? Würde ich ihn aber, wie es meine Pflicht war, einer Entziehungskur zuführen, konnte nicht auch das leichtfertig sein? Ich würde dann so handeln, wie man es von mir erwartet. Aber würde ich damit nicht schon die Entscheidung von mir abwälzen auf etwas, das man etwa als moralisch einstuft, als ‚gesundes Volksempfinden‘ womöglich? Solche Begriffe haben von jeher meinen Widerwillen erregt, denn sie schläfern die wachen Sinne ein zugunsten einer undurchdachten, mechanischen Handlungsweise, die sich anmaßt, das Recht auf ihrer Seite zu haben, weil sie die meisten Befürworter hat.
––Niemand würde mich tadeln, alle würden mich loben oder es sogar für selbstverständlich halten, dass ich ‚meine Pflicht‘ getan hätte. Aber gerade das machte mich misstrauisch, denn etwas Selbstverständliches gab es in meiner Lage nicht zu tun. – Im Gegenteil, die Vorstellung der allgemeinen Missbilligung, wenn entdeckt würde, dass ich als Arzt einem Süchtigen zu Rauschgift verholfen hatte, war fast ein Triumph für mich: ‚Es ist mir gleich, was ihr denkt! Ihr mögt es für verwerflich halten, aber ich habe so gehandelt, wie es mir in diesem Falle nach reiflicher Überlegung für angemessen erschien.‘
Aber so sicher war ich nicht. Ich wusste nicht, was angemessen war, und damit brach meine lächerliche Eitelkeit zusammen. Wenn ich mich aber zu keiner eigenen Entscheidung durchringen konnte, dann war es besser, sich danach zu richten, was die geltenden moralischen Vorstellungen und das Gesetz von mir forderten, als aus billigem Trotz das genaue Gegenteil dessen zu tun. Ich würde ‚meiner Pflicht genügen‘ und weiterhin ein Vorbild für meine nach Vorbildern hungernden Patienten abgeben, falls mich nicht der Verdacht eines unerlaubten Eingriffs vor ihnen herabsetzte. Aber auch das würden sie genießen, denn es gibt nichts Befriedigenderes, als sich seiner moralischen Überlegenheit einem Menschen gegenüber bewusst zu werden, zu dem man jahrelang – wie ich zugebe, grundlos – aufgeblickt hat.

Titelillustration mit Bildmaterial von Shutterstock: Carolyn Franks (Mann), Pru Studio (Hand mit Stift) und Arkadiusz Fajer (Spritze), iodrakon (Augen), Juta (Frau mit Tasse)

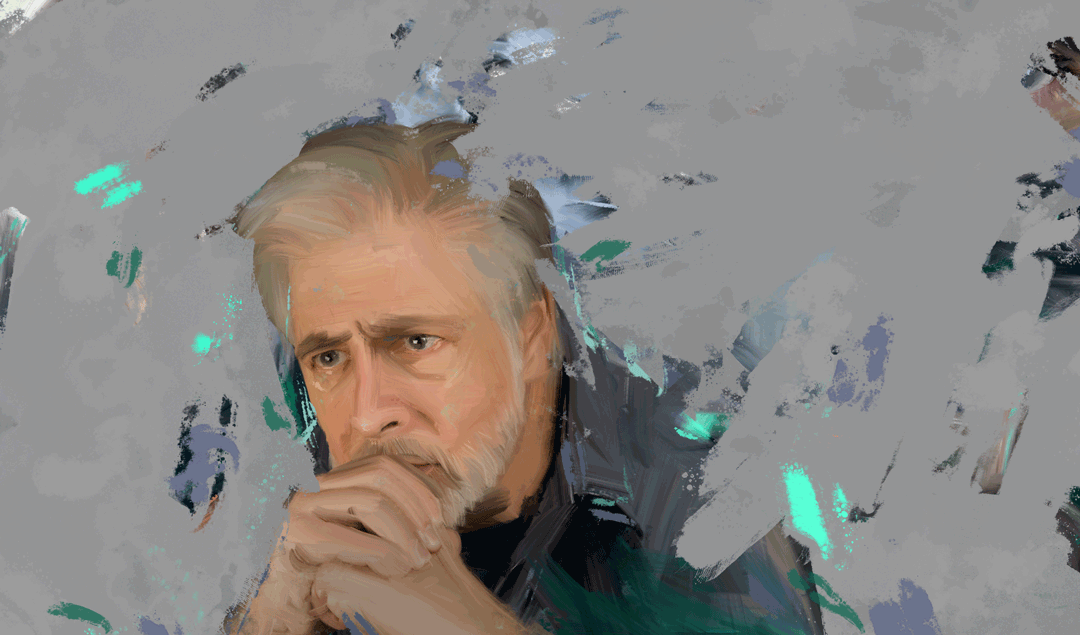
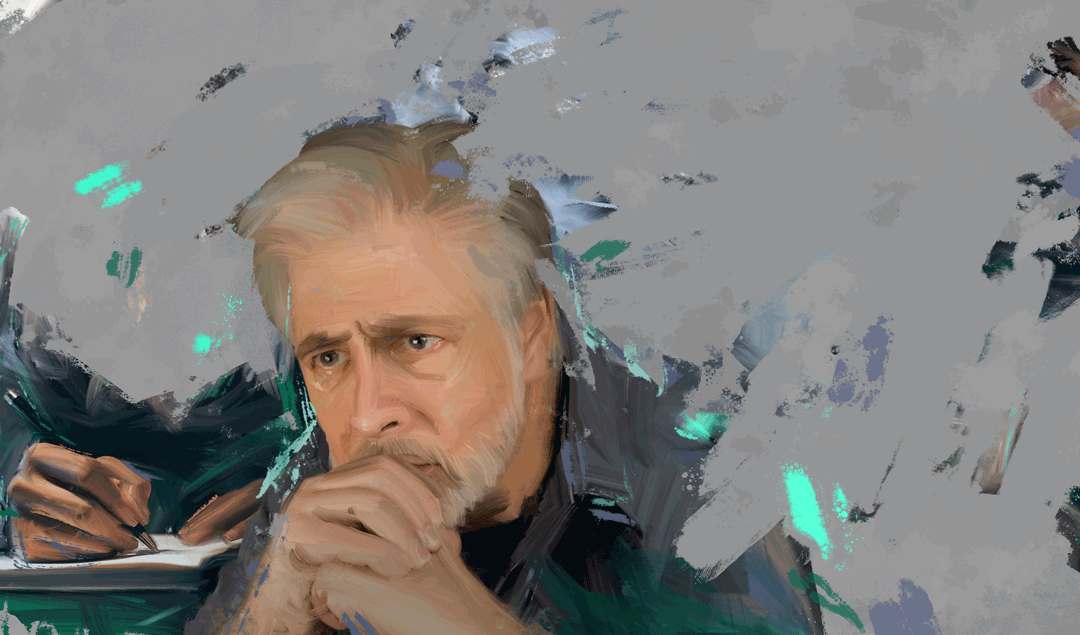
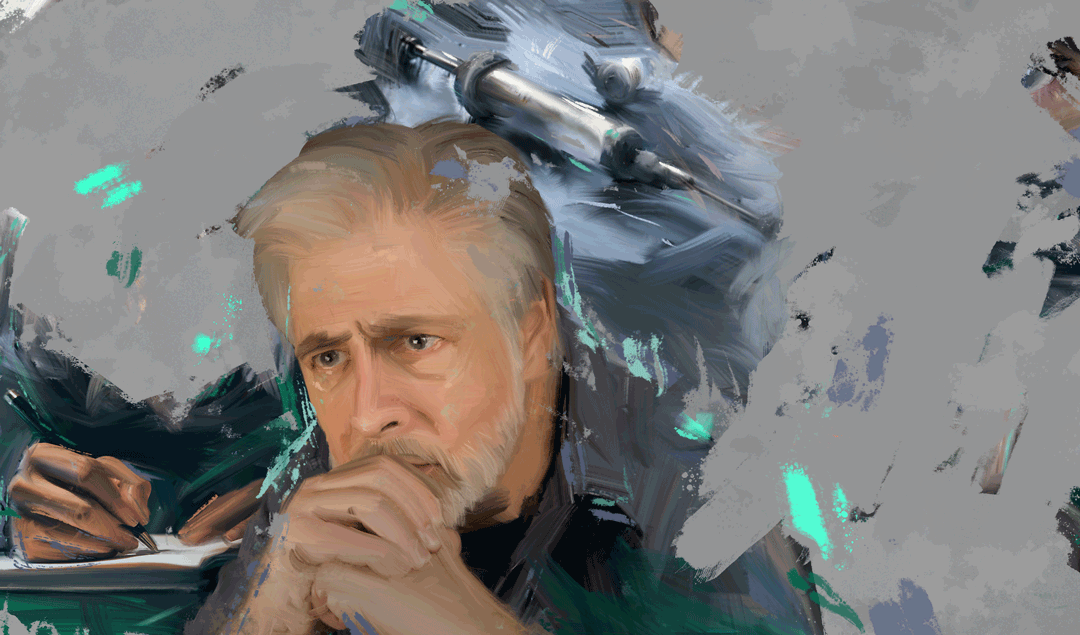
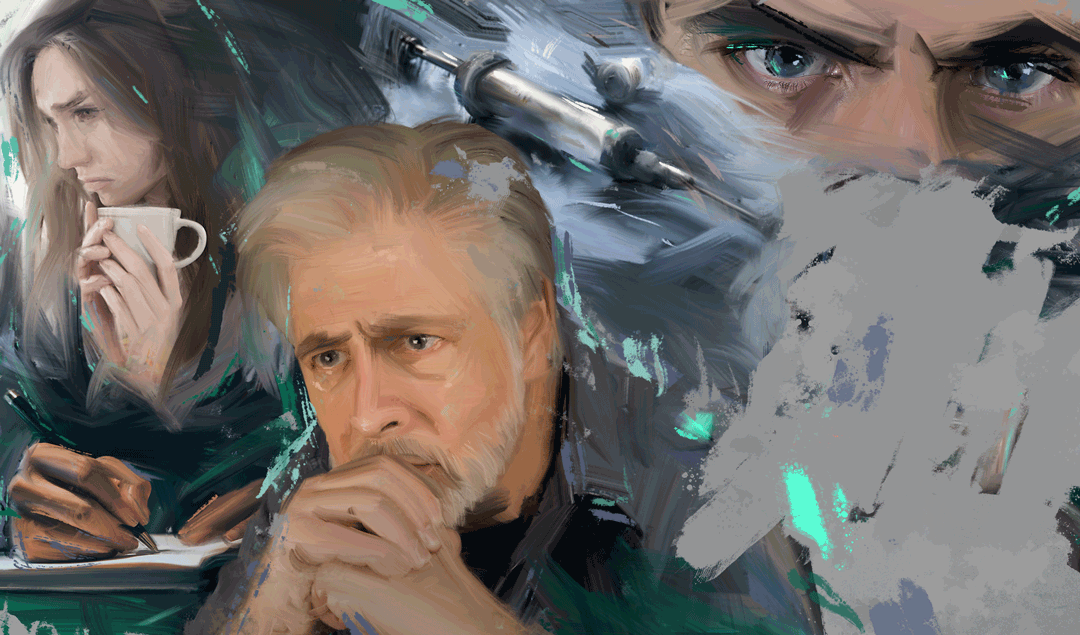
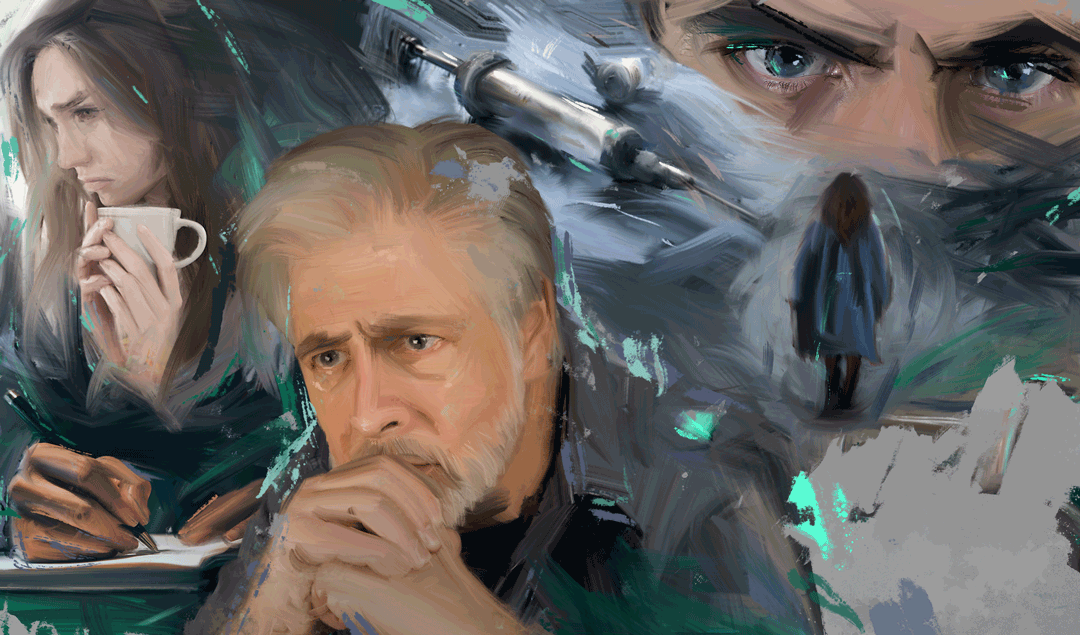
Nun ja, als ob ein „erfülltes Leben“ nur mit Morphium möglich wäre…!
Das ist ja quasi die Argumentation des Süchtigen. Objektiv ist das natürlich etwas anderes. Schlußendlich sieht der Protagonist das ja eben auch so.
Die Gleichung lautet nicht: Morphium = erfülltes Leben, sondern:
Schaffenshemmung + Morphium = Malrausch.
Das muss man nicht gutheißen und es kann tödlich sein, aber es ist eine andere Konstellation.
Nachdenken statt Arbeiten. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Auch wenn ich keine Abhängigkeitsprobleme im näheren Umfeld habe.
Arbeit läuft oft flotter, wenn man vorher nachgedacht hat.
Hahaha, gut beobachtet 😂 In der Regel funktioniert das allerdings nur wenn man auch wirklich über die Arbeit nachdenkt. Wer sich den ganzen Tag in seinen Gedanken verheddert bekommt eher wenig erledigt.
Der Herr Hausarzt sagt es ja bereits selbst: sinnlose Vorwürfe!
Vorwürfe sind dann sinnvoll, wenn sie eine Änderung bewirken.
Bei sich selbst ist das ja leider oft weniger erfolgreich, als wenn jemand von außen neutral analysieren und ggf. vorwerfen kann.
Jemanden in der Selbstzerstörung zu unterstützen kann doch aus wirklich keinerlei Perspektive wahre Liebe sein!? Oder sehe ich da etwas falsch?
Es gibt so viele verschiedene Definitionen von Liebe, da wird man sich sicherlich nicht einig. Aber die meisten Menschen würden wohl versuchen ihre/n Geliebte/n vor dem Schlimmsten zu retten.
Mal (selten) klappt“s, mal wird der Retter mit in den Abgrund gezogen. Das Ärgerliche an der Liebe: sie ist blind.
Sie ist blind und sie lässt uns weit über unsere Grenzen hinaus gehen. Natürlich ist das nicht immer nur zum Guten.
Diese Überlegungen (Was wäre für mich das Beste? Wäre für meine Familie das Beste?) kennen wir in vielleicht etwas abgeschwächter Form doch alle. Oft ist es tatsächlich unmöglich diese verschiedenen Antworten vernünftig zusammenzubringen ohne Schmerzen zu verursachen.
Es geht ja auch nicht unbedingt darum das Unmögliche möglich zu machen. Auf Anteilnahme, Mitempfinden und Hingabe kommt es vielleicht mehr an.
Das sind die positiven Eigenschaften des teilweise sehr fragwürdig ausgelegten Christentums.
Wenn diese Dinge nach wie vor im Mittelpunkt stehen würden, würden möglicherweise auch weniger Menschen aus der Kirche austreten.
Aus Trotz das Gegenteil von dem zu tun, wovon man eigentlich überzeugt ist, das Bedarf schon einer Menge an … tja was ist das … Frustration?
Ich würde sagen das kommt ganz auf die jeweilige Situation drauf an. Manchmal ist man aus Pragmatismus in einer ähnlichen Zwickmühle.
Schon die antike Tragödie handelte von Situationen, in denen es nur die Wahl zwischen zwei Übeln gab ohne einen glücklichen Ausgang.
Diese Leere des Schlafes ist so wunderbar. Leider kenne ich schlaflose vergrübelte Nächte aber fast noch besser. Diese Unruhe wenn man schlafen will aber nicht kann ist manchmal sehr kräftezehrend.
Als junger Mann litt ich auch ab und an unter Insomnia. Irgendwann hat sich das dann von alleine gelegt, aber damals hat es mir immer geholfen vor dem zu Bett gehen zu meditieren. Einfach um schon einmal alles ein wenig herunterzufahren.
Erste Nacht: rückwärts zählen ab zehn. Zweite Nacht: Tablette.
10 reicht bei mir nicht. Die Tablette hilft eher. Ich bin aber generell eigentlich ein ganz guter Schläfer. Zum Glück.
Ab Null natürlich immer wieder bei Zehn anfangen. So oft, bis es …
Wenn ich nicht schlafen kann stehe ich in der Regel auf und beschäftige mich solange bis ich wirklich müde bin. Alles andere macht am Ende ja doch keinen Sinn.
Ich liebe die Leere auch. Wenn das ganze Leben für ein paar Stunden herunterfährt. Toll! 🙂
Ich liebe auch die Träume: Wenn sie schön sind, freut man sich. Wenn sie grässlich sind, freut man sich, wenn man aufwacht. Win – win.
Wahnsinnig spannend, was sich unser Gehirn nachts so alles ausdenkt und zusammenreimt, nicht?
Nie wundere ich mich mehr über mich selbst, als wenn ich aufwache und noch weiß, was ich eben noch (Gott sei Dank nicht wirklich) gemacht habe.25
Hebbel hat gesagt „Der Traum ist der beste Beweis dafür, dass wir nicht so fest in unsere Haut eingeschlossen sind, als es scheint“. Das ist genau das, was mir so sehr an diesem Zustand gefällt.
Da merkt man vor allem recht deutlich wie begrenzt unser Horizont tagsüber ist 😉
Könnten wir Genzenlosigkeit aushalten?