
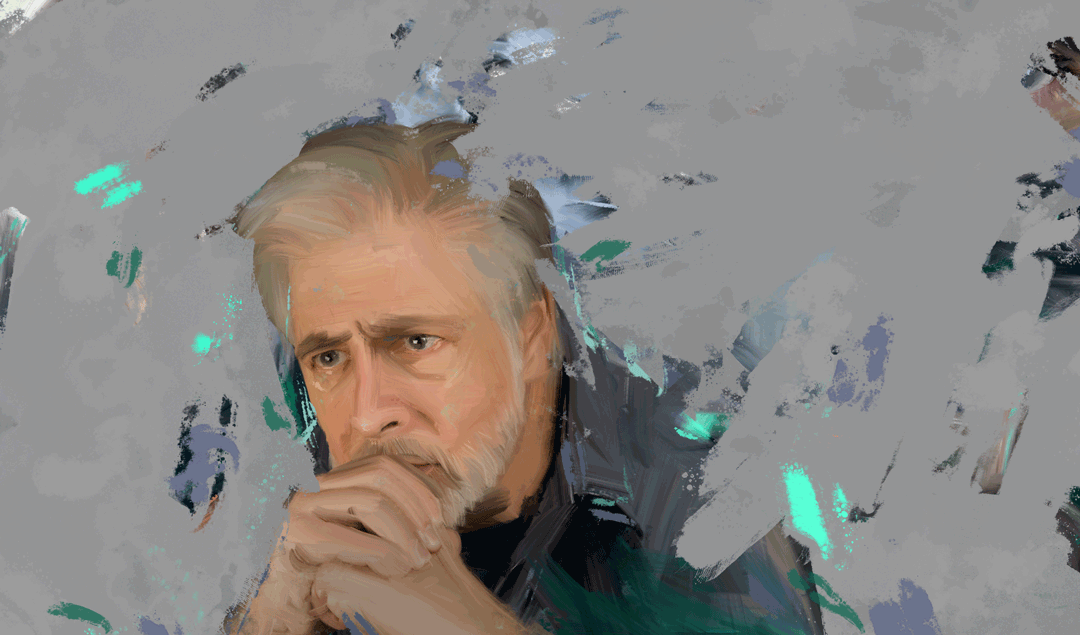
1967
Wenn ich sterbe, dann möchte ich nicht schmerzlos hinübergleiten. Ich möchte nicht einfach einschlafen, und alles wäre vorbei. Wenn ich sterbe, will ich leiden. Der Schmerz soll mich noch einmal durchzucken. Einer überlasteten Stromleitung ähnlich, die ihr Letztes gibt, ehe sie durchbrennt, will ich alle Kraft noch einmal zusammenfassen. Einmal noch will ich mich aufbäumen, ein letztes Mal, bevor mein Körper schlaff und besiegt seinen Kampf aufgibt.
Ich lese viel, fast den ganzen Tag. Abends sehe ich meist fern. Manchmal besuchen uns auch Freunde, die mich mit ihrem teilnehmenden Respekt langweilen. Doch ich tue ihnen unrecht. Wahrscheinlich verehren sie mich wirklich, wenn es auch manchmal so scheint, als pilgerten sie zu mir, um den Sündenbock zu sehen, der für sie leidet. Sie schöpfen aus meinem Schicksal Kraft für Taten, die sie nie begehen werden. Aber sie wissen, dass sie unter ähnlichen Umständen genauso hätten handeln müssen, wie ich es tat.
Es war ein ungewöhnlich sonniger, fast noch warmer November. Die Rosen blühten unbekümmert, und vertrocknete Blätter hingen eigensinnig an den Bäumen, deren Umrisse sich in dem verblassenden Jahr schärfer abzuzeichnen begannen. Doch Altes und Totes zerfällt von selbst, und so rieselte gegen Ende des Monats das Laub als Goldregen von den Ästen, lautlos wie Tränen.
Es war gegen neun Uhr abends. Ich saß noch in meiner Praxis, wo ich mit einer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt war. Seit dem Tod meiner Frau arbeitete ich häufig bis tief in die Nacht. Mein alter Ehrgeiz, der während einer wenig erfreulichen Ehe abgestumpft war, hatte seinen schneidenden Glanz zurückgewonnen. Ich stellte meine Untersuchungen mit der fiebrigen Besessenheit dessen an, dem es mehr auf den persönlichen Erfolg als auf das unantastbare Ergebnis seiner Arbeit ankommt. Leider musste ich später erkennen, dass meine Bemühungen von anzweifelbaren Voraussetzungen ausgegangen waren und deshalb nur von geringem Wert sind.
––Damals war ich mit einer Begeisterung bei der Sache, die vielleicht von einer Begeisterung für mich selbst und meine wiederentdeckten Antriebskräfte herrühren mochte.
Seit jeher hatte ich gehofft, durch besondere Leistungen Anerkennung zu finden. Ich schien auf dem besten Wege dazu, und ich arbeitete völlig selbstständig.
––In meiner Jugend hatte ich einmal geglaubt, dass die Begegnung mit einem bestimmten, für andere vielleicht bedeutungslosen Menschen die aufgestauten Energien in uns freilegen müsse. Ich hatte gehofft auf den Menschen, der Aufgabe und Prüfung für uns wird, den wir aufrichten oder besiegen müssen, der plötzlich jeden Einzelnen von uns von der Menge der Übrigen trennt und in einen Strudel von Zweifeln und Sehnsüchten stürzt, von wo aus wir nie wieder oder gestärkt zurückfinden, den Menschen, an dem wir uns bewähren – oder scheitern.
Diese schwärmerische Auffassung hatte ich inzwischen als unrealistisch verworfen, erleichtert und vielleicht auch ein wenig enttäuscht, dass ich zwar einige Menschen kannte, die mir etwas bedeuteten, aber niemanden, dessen achtlos oder absichtlich gegen mich versprühte Funken ein Feuer in mir entfacht hätten. Mein Plan, die Praxis zugunsten meiner wissenschaftlichen Arbeiten einzuschränken, hatte damals weder Zustimmung noch Ablehnung, nicht einmal Neugier hervorgerufen. Umso hartnäckiger versuchte ich, schnell den Beweis zu erbringen, wie recht ich gehandelt hatte. Es war mir deshalb recht lästig, als Christian Legendorff unangemeldet erschien. Meine Haushälterin musste ihm wohl schon gesagt haben, dass er ungelegen kam, denn er blieb, nachdem er „Guten Abend“ gemurmelt hatte, etwas unbeholfen in der Tür stehen uns sah mich unschlüssig an.
––„Meine Tochter ist leider nicht da!“, sagte ich wenig freundlich und stand langsam auf, um ihn zu begrüßen.
––„Ich wollte auch zu Ihnen und nicht zu Claudia“, sagte er zögernd. Dabei trat er einen Schritt vor und schloss mit der linken Hand die Tür hinter sich, während er mit der rechten nach meiner griff und sie mit gesenktem Kopf kurz, aber fest drückte. Dann zog er seinen Arm fast hastig zurück, verhakte beide Hände ineinander und schob die Schultern nach hinten. In dieser starren Haltung blieb er ein paar Sekunden stehen, hob plötzlich mit einer ruckartigen Bewegung den Kopf und umklammerte mein Gesicht unvermittelt mit einem halb lauernden, halb herausfordernden Blick.
––„Soo …“, sagte ich, überrascht und zugleich peinlich berührt über die Hemmungslosigkeit, mit der dieser Blick mich überrumpeln und gefügig machen wollte. Ich wandte mich um und ging zu meinem Platz zurück. Dabei wies ich mit der Hand zum Sessel auf der anderen Seite des Schreibtisches: „Bitte – setzen Sie sich!“
––Er ließ sich auf einen Stuhl neben der Tür fallen.
––„Wollen Sie sich nicht hierhersetzen?“, fragte ich gereizt. Seine Widerspenstigkeit begann schon bei Kleinigkeiten.
––„Nein, vielen Dank, ich mag diesen Platz lieber“, sagte er bestimmt. „Da vorne komme ich mir vor wie in der Sprechstunde.“
––Ich nahm die Brille ab und verschob den Schirm der Schreibtischlampe so, dass ihn der Lichtkegel traf. „Also, worum geht es?“, fragte ich ergeben, während ich meine Arbeit endgültig beiseiteschob.
––Er antwortete nicht sofort, und während er überlegte, wie er am besten anfangen könnte, betrachtete ich wieder einmal mit Interesse sein ungewöhnliches Gesicht. Es war lang und schmal. Die Partie vom Jochbein über die eingefallenen Wangen bis hin zum ausgeprägten Kinn bildete fast ein Dreieck, das von der schmalen, ebenmäßigen Nase in zwei gleiche Hälften unterteilt wurde. Seine nicht sehr großen, aber tiefblauen Augen glitzerten immer wie in heftiger Erregung. Zwischen den buschigen Brauen und dem wilden Durcheinander der ungebändigten Haare lag, wie um Versöhnung bemüht, die hohe, kaum gewölbte Stirn. Eigenartig unpassend, fast störend wirkte dazu der kleine Mund, dessen volle Lippen die Wildheit des übrigen Gesichts infrage stellten. Der Hals war wie alle anderen Gliedmaßen lang und schmal. Seine Angewohnheit, während des Sprechens jäh die Arme in die Luft zu werfen, ließ mich immer an ein Flammenbündel denken: flackernd und verzehrend.
––Einen typischen Kunstmaler stelle ich mir eher stämmig und robust vor. Aber was weiß ich schon … Jedenfalls war es ihm gerade gelungen, seine erste Ausstellung zusammenzustellen. Mit Erfolg, wie ich hörte.
Zwar hätte ich meiner Tochter lieber einen weniger aufregenden, aber dafür zuverlässigen Mann gewünscht, aber ich war trotzdem froh, dass sie seinetwegen den unangenehmen Burschen aufgegeben hatte, mit dem sie bis vor einem Monat zusammen gewesen war. Meine Tochter ist medizinisch-technische Assistentin. Es hätte nahegelegen, dass sie mir in der Praxis geholfen hätte, aber sie zog aus mir unverständlichen Gründen die Arbeit im Krankenhaus vor. Dort hatte sie Christian durch eine Kollegin kennengelernt, die vor einigen Wochen das Krankenhaus überraschend hatte verlassen müssen. Seither war Christian häufig bei uns zu Gast.
„Ich glaube zu spüren, dass Sie mich recht gerne mögen“, begann er endlich. Seine Gedanken waren weit entfernt. Gleichzeitig schien er sich anzustrengen, eine tiefe innere Unruhe im Griff zu behalten.
––„Welch merkwürdiger Anfang“, dachte ich. „Er wird doch nicht um Claudias Hand anhalten wollen?“
––„Nur das gibt mir den Mut, Sie um das zu bitten, was ich haben muss!“ Seine Stimme bekam allmählich Feuer.
––„Meinen Sie nicht, dass das nach kaum einem Monat etwas verfrüht ist?“, fragte ich abwehrend.
––Er sprang auf und kam mit ein paar hastigen Schritten auf mich zu. „Sie müssen mir helfen!“ Er umklammerte die Schreibtischkante. „Ich bin verzweifelt! Seit einer Stunde gehe ich vor Ihrem Haus auf und ab. Ich wollte es Ihnen ersparen, aber es gibt keinen anderen Ausweg.“ Er sank in den Sessel, den ich ihm vorhin angeboten hatte.
––„Was wollen Sie von mir?“, fragte ich beunruhigt.
––Eine Welle der Abwehr durchschauerte seinen Körper. Er presste die Hände wie haltsuchend gegen die Zähne, aber seine Finger züngelten ruhelos – ein verzweifeltes Bild des Unentrinnbaren.

Titelillustration mit Bildmaterial von Shutterstock: Carolyn Franks (Mann), Pru Studio (Hand mit Stift)

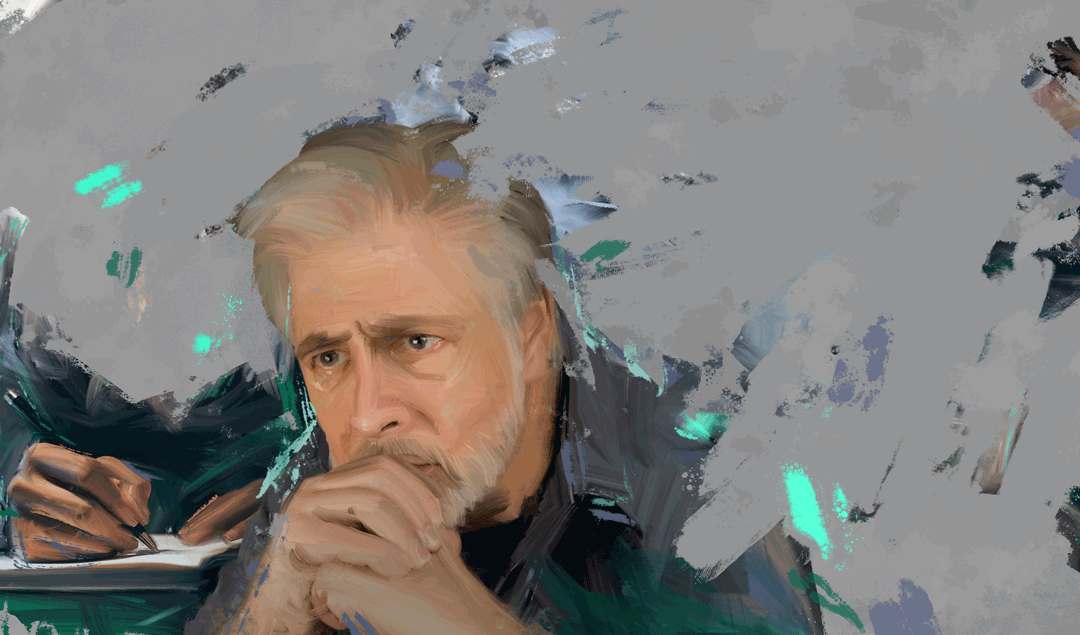
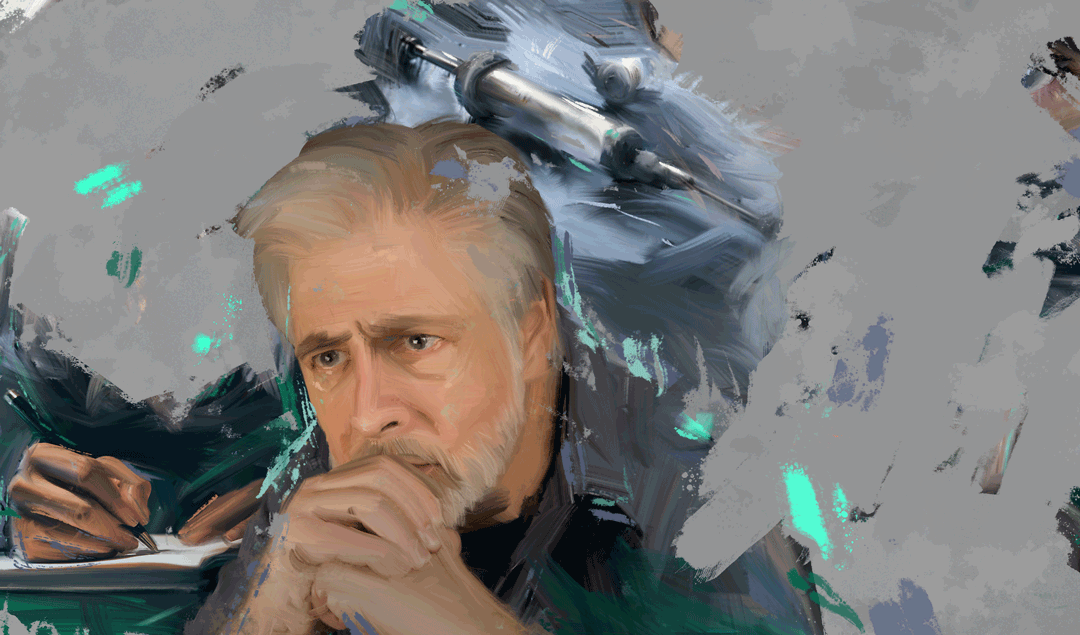
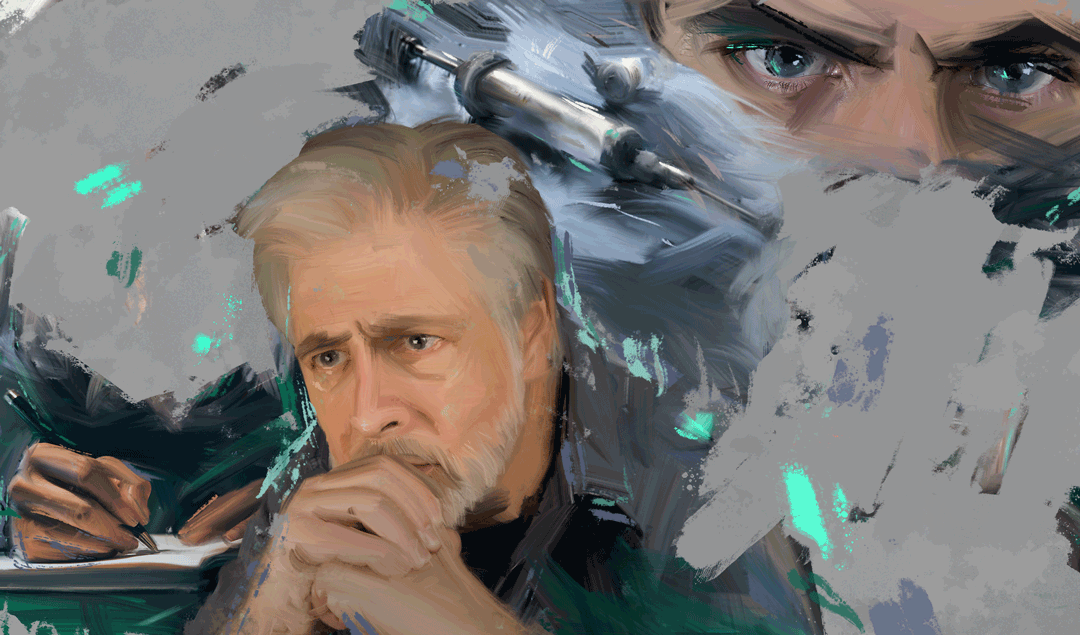
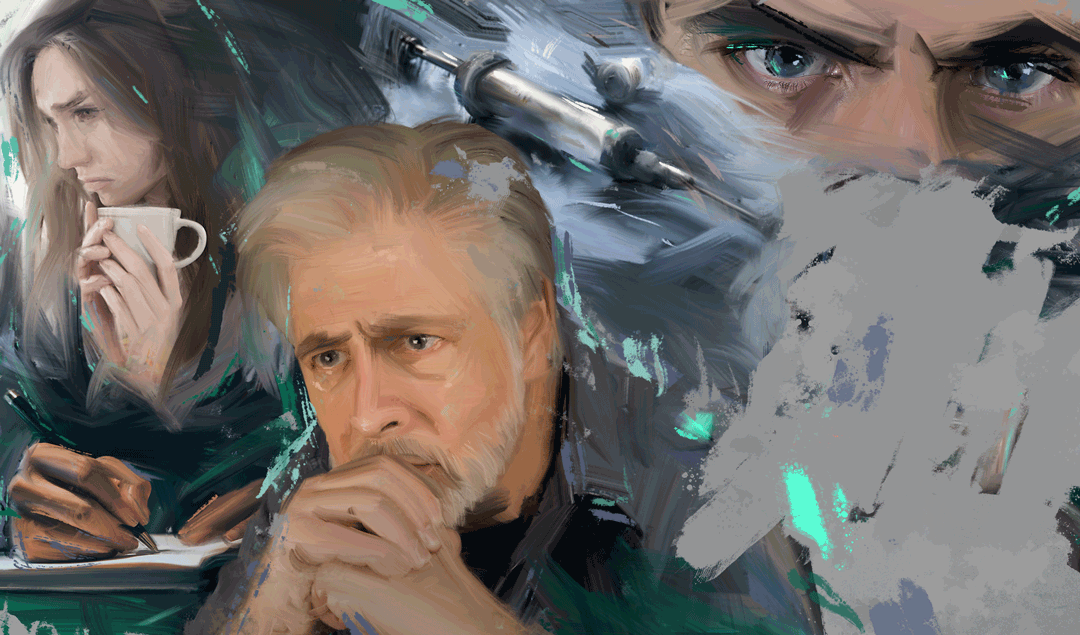
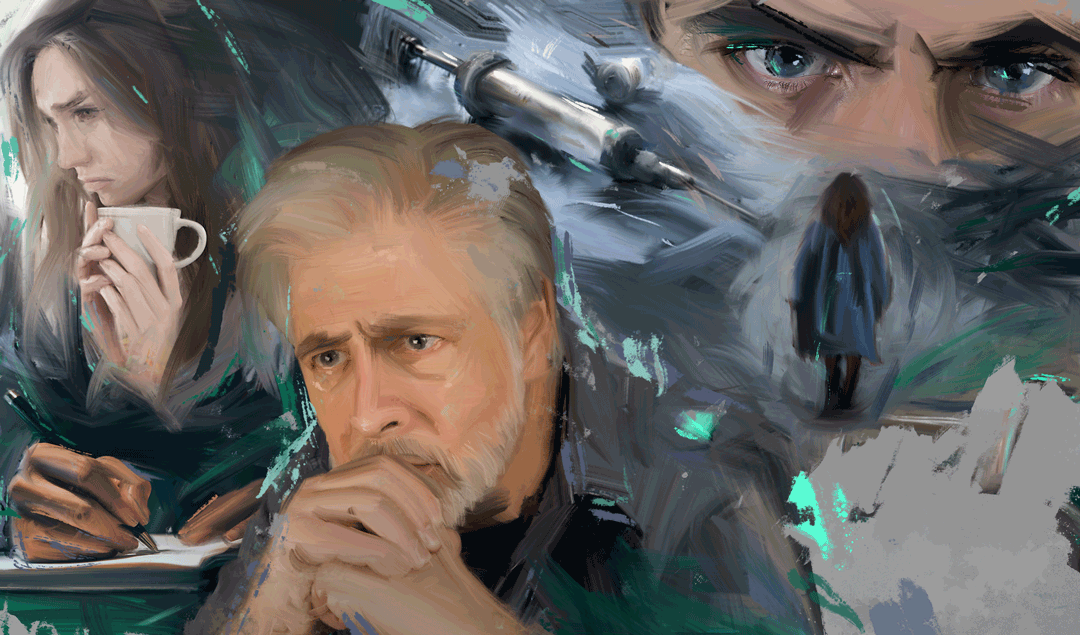
Schmerzen möchte ich wirklich nicht haben wenn ich sterbe. Aber ich habe gerade erst im Spiegel gelesen, dass Aldous Huxley während eines LSD Trips gestorben ist. Also ganz geplant. Dass klingt schon eher interessant;)
Im Ernst? Also ich meine die Huxley-Geschichte ist wahr? Das wusste ich gar nicht.
Ein Horror-Trip kann schlimmer sein als Schmerzen. Wie jemandem, der sich mit Rasierklingen ritzt, ist solch einem Menschen alles recht, um nur wieder etwas oder sich zu spüren.
Hatte ich auch gelesen. Sterbehilfe mit LSD:
https://www.spiegel.de/geschichte/schriftsteller-aldous-huxley-sterbehilfe-mit-lsd-a-d61e7327-d9c2-498c-b582-5b0b812f0414
Dieser Wunsch nach einem letzten Schmerz ist dann wohl der Wunsch nach einem letzten Funken richtigem Leben?
Das kommt darin zum Ausdruck.
Ein Bild des Unentrinnbaren. Ist das schon der erste Absturz!?
Neinnein, es wird vorher schon noch schlimmer.
Hahaha 😉 Beruhigend!
Freunde die langweilen. Das Phänomen kenne ich sogar. Ganz komisch, wenn man sich eigentlich sehen will und dann doch itgendwie nicht zueinander findet.
Ihn langweit ja vor allem deren Mitleid.
In diesem Fall ist es Mitleid, aber dies Art von Langeweile ergibt sich finde ich oft dann, wenn man gerade mal nicht auf der selben „Wellenlänge“ ist. Dann kann man auch mit guten Freunden auf einmal nicht connecten.
Kommt schon vor, dass der eine gerade an seinen nervigen Umzug denkt und der andere an seinen fleckigen Anzug. Sorgen, die man nicht teilt, entfremden. Langeweile ist die Vorstufe der Trennung.
Und los geht es! Diese unruhige, beängstigende Stimmung erinnert mich an die drei Erzählungen vom letzten Jahr. Das scheint fast etwas zu sein, dass Sie an Menschen besonders interessiert!?
Ja. Über ausgeglichene Charaktere reicht ein Satz.
Haha, da haben Sie völlig recht. Über in sich ruhende Zen-Menschen gibt es nicht viel aufregendes zu schreiben. Höchstens einen Lebensratgeber für Leute, die sich inspiriert fühlen.
Praxis ohne Theorie. Fake it until you make it.
Die Theorie ergibt sich oft ja von alleine…
Nachträglich lassen sich wunderbar Theorien aufstellen: warum die AfD in Sachsen stärkste Partei wurde, warum Corona das Umweltbewusstsein stärkt, warum die Welt doch nicht am 30.Mai untergegangen ist. Vorher wären solche Theorien natürlich hilfreicher gewesen. – Aber hier geht es ja um eine Arzt-Praxis…
Da gibt es ja sogar ganze Ideologien, die sich dieses Prinzip zu nutzen machen. Zum Beispiel die Neurohacker um Daniel Schmachtenberger. Da geht es eigentlich konstant um „Sense-making“…
Den Herrn Schmachtenberger kenne ich zwar nicht, aber geht es da nicht eher mehr um einen Lebensstil als um eine Ideologie?!
Schmachtenberger klingt schwäbischer, als er zu sein scheint. Ich versuche gerade, mich mit ihm zu beschäftigen.
Gibt es überhaupt stämmige Kunstmaler? Blöde Frage, aber diese Verbindung hätte ich gar nicht gezogen. In meiner Vorstellung sehen die eher ausgemergelt und wirr/verträumt aus.
Geben tut es ja im Prinzip doch alles. Aber was es in unserer Vorstellung gibt, das ist eine ganz andere Frage.
El Greco denke ich mir lang und schmal, Rubens eher üppig.
Jemand, der die Sixtinische Kapelle ausmalt, muss vielleicht robuster sein als jemand, der Meißner Porzellantässchen bemalt.
Und wahrscheinlich wäre man über die Realität doch wieder überrascht.
Es ist doch immer wieder erstaunlich wie viele wenig erfreuliche Ehen und Beziehungen es immer noch gibt. Sicherheit und Routine scheinen für sehr viele Menschen doch einen größeren Reiz auszumachen als das Abenteuer.
Ich würde sogar sagen für die Großteil der Leute. Es wird ja auch nach wie vor erwartet mit Familie, Eigenheim etc. glücklich zu werden.
Sehen und Lesen möchten die meisten das Ausgefallene, das ihnen nie eingefallen wäre. Leben möchten sie lieber vorhersehbar. Nur wer selber nicht nur den „Abenteuer-Urlaub“ sucht, sondern die echte Bedrohung, der werfe den ersten Stein.
Ja klar, gerade weil das eigene Leben oft so langweilig ist, interessiert man sich (am liebsten aus der Ferne) für das Ausgefallene und Wilde.