
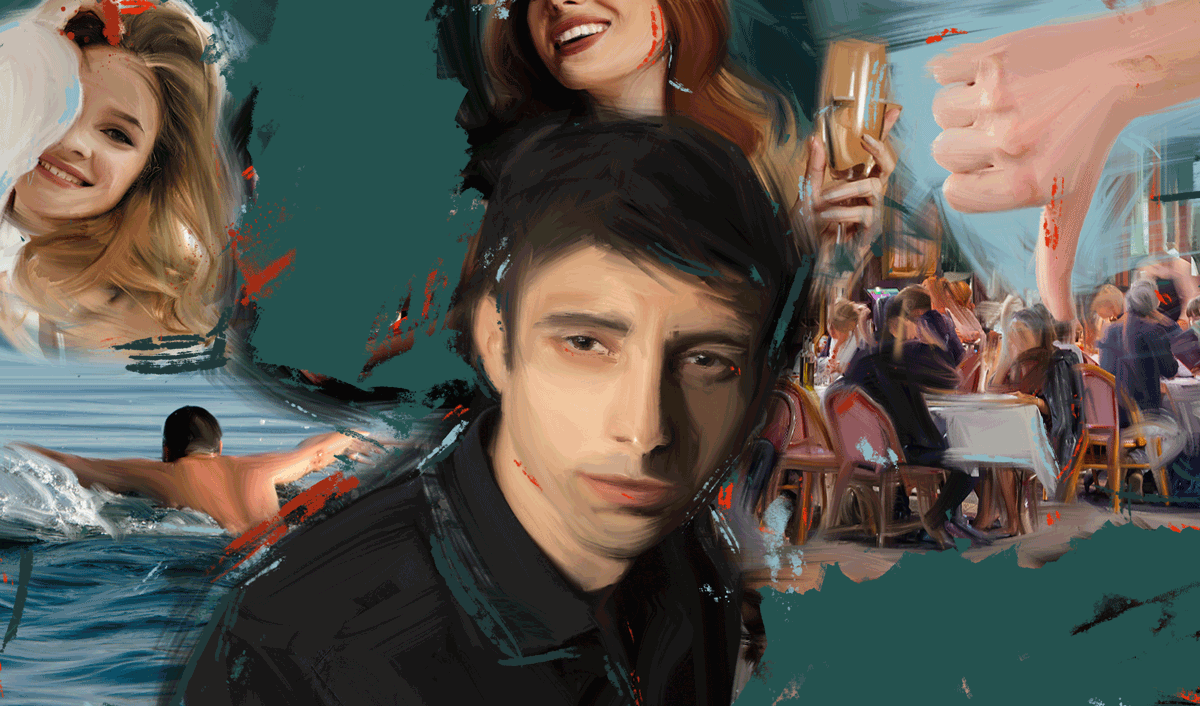
Sabine lebte mit ihrer Freundin Helga zusammen in einer Einzimmer-Wohnung. Wie man das länger als einen Monat aushält, ist mir heute noch unverständlich. Allerdings waren beide geradezu aufreizend verträglich, und zwar in solcher Vollendung, dass ich trotz unermüdlicher Versuche nicht dahinterkam, ob das nun Dummheit oder Anpassungsfähigkeit war. Immerhin blieb mir dadurch die geringe Hoffnung, dass sie sich bis aufs Blut fetzten, wenn sie allein waren. Aber selbst das war nicht wahrscheinlich, denn blaue Flecken oder Kratzwunden konnte man bei keiner von ihnen entdecken, wo auch immer man suchen mochte.
––Sabine war im selben Fremdsprachenkursus wie Marion. Was Helga machte, weiß ich nicht. Ich gebe zu, dass ich sie nie danach gefragt habe. Als wir an diesem Abend zu Sabine gingen, hatte ich geglaubt, wir würden ganz unter uns sein: zwei Flaschen Bier, eine Schachtel Zigaretten und ein beruhigendes Gespräch über Belanglosigkeiten. Stattdessen sah ich mich von Lärm, Qualm und einer Vielzahl unbekannter Gesichter umgeben.
––„Setzt euch irgendwohin!“, sagte Sabine fröhlich. Dann wandte sie sich, ohne ihr Lächeln zu ändern, einem zerzausten jungen Mann zu, blieb aber nur kurz bei ihm und stürzte sich gleich darauf mit demselben Ausdruck beschwingter Heiterkeit auf eine Dreiergruppe, so als könnte sie gerade eben nur fünf Minuten lang lächeln und müsste in dieser Zeit allen Gästen ihr strahlendes Gesicht gezeigt haben – dabei musste sie doch genauso gut wie ich wissen, dass sie diese Mimik ganze Nächte lang beibehalten konnte. Das Erschütternde daran war nur, dass es auch noch echt wirkte.
––„Hat sie dir von diesem Gelage wirklich erst heute Nachmittag erzählt?“, fragte ich unwillig.
––„Ja“, sagte Marion, „Helga hat irgendeine Prüfung bestanden, und da haben sie sich plötzlich entschlossen zu feiern.“
––Helga hatte uns gerade entdeckt und kam mit ausgestreckten Armen auf uns zu: „Hallo! Schön, euch wieder mal zu sehen! Habt ihr schon was zu trinken?“
––„Nein, noch nicht“, sagte ich, „aber zuerst wollen wir dir ja auch gratulieren, damit wir uns den Drink wenigstens verdient haben! Ich freu’ mich wirklich, dass du es geschafft hast.“
––„Danke Christian! Ich bin so glücklich. Und was für eine Angst ich vorher hatte!“ Sie lachte unbekümmert, und es war klar, dass ihr jetzt keine Steine mehr im Weg lagen: Die Fahrt ging mühelos bergab. „Ich habe tagelang nichts essen können und kaum noch geschlafen!“ Sie lachte wieder, und ich begann darüber nachzudenken, ob es mir jemals einfallen könnte, über ausgestandene Ängste zu lachen.
––Erst als jemand Marion zum Tanzen aufforderte, wurde mir die Musik bewusst, und ich ärgerte mich, dass ich dem Eindringling nicht zuvorgekommen war. Hübsche Bilder an den Wänden, niedrige Decke, Kerzenbeleuchtung, bequeme Sitze und genügend Kissen. – „Ich bin ein Idiot“, dachte ich, „was fehlt mir?“
––„Kennen wir uns?“ Sie hatte dunkelbraunes Haar und zu ihrer Augenfarbe passend einen türkisfarbenen Pullover.
––„Nein“, sagte ich, „ich glaube nicht.“
––„Ich heiße Aimee.“ Es klang verheißungsvoll.
––„Du sprichst deinen Namen aus, als ob du ein Geheimnis verbirgst.“
––„Man redet doch meistens, um etwas zu verschweigen“, sagte sie und kauerte sich mit angewinkelten Beinen neben mich.
––Das stimmte zwar nicht, aber es gefiel mir. „Ich heiße Christian.“
––„Christian!“, wiederholte sie begeistert. „Bist du ein Freund von Helga?“
––„Nein, ich kenne Sabine besser.“
––„Ach so!“
––„Hast du dir den Pullover zur Augenfarbe angeschafft oder die Augenfarbe zum Pullover?“
––„Die Augen zum Pullover! Ich habe gefärbte Kontaktlinsen. Ich bin nämlich furchtbar kurzsichtig.“
––„Warum machst du dir solche Mühe, deine Schwächen zu verbergen, wenn du sie doch zugibst?“
––Sie warf beim Lachen den Kopf hoch mit einer ungestümen Bewegung und fegte sich eine Strähne aus dem Gesicht. „Es kommt nicht darauf an, wie etwas ist, sondern wie es wirkt“, sagte sie. „Der Eindruck entscheidet. Ich brauche dir gar nichts vorzumachen. Du kannst dir doch nicht vorstellen, wie ich mit wässrig-blauen Augen aussehe.“
––„Und die Haarfarbe?“, fragte ich misstrauisch.
––„Auch falsch!“, antwortete sie. „In Wirklichkeit habe ich ein schmuddeliges Dunkelblond.“
––„Du hast eine sehr gute Figur“, sagte ich. Ich wollte mich ja nicht einschüchtern lassen.
––Sie hob leicht die Augenbrauen: „Und die ist echt!“ Ihre Finger strichen eine Handvoll Haar in den Nacken. Sie schien die Eleganz ihrer Bewegung zu genießen. Vielleicht hatte sie sie oft genug vor dem Spiegel geprobt, um sich ihrer Wirkung bewusst zu sein.
––„Was machst du?“, fragte Aimee unvermittelt.
––„Ich sitze neben dir.“
––„Geschenkt. Uns sonst?“
––„Bis vor einem Monat habe ich in der Fabrik gearbeitet“, antwortete ich.
––„Aber nur während der Semesterferien“, sagte sie.
––„Ja.“
––„Gibt es keine angenehmeren Möglichkeiten für dich, Geld zu verdienen?“
––„Ich brauche kein Geld zu verdienen.“
––Das schien ihr zu gefallen, denn sie lächelte anerkennend. „Warum arbeitest du dann überhaupt? Arbeit macht doch hässlich!“
––„Das mag sein“, sagte ich, „aber die Hässlichkeit, die durch Nichtstun entsteht, ist noch abstoßender.“
––„Warum machst du dich nicht unabhängig, wenn du schon unbedingt arbeiten willst? Es gibt doch kein angenehmeres Gefühl, als selbstständig zu sein. Mein Vater hat mich immer mit seinem Geld zu erpressen versucht: ‚Wenn du das nicht tust und das nicht lässt, bekommst du keinen Pfennig mehr von mir!‘ Bis es mir schließlich gereicht hat und ich zu ihm gesagt habe: ‚Behalt deine Ansichten und deine Scheine für dich, aber lass mich leben, wie ich will!‘ – ‚Und wovon?‘, fragte er. – ‚Mach dir darüber keine Sorgen! Schwieriger als hier bei dir Geld zu bekommen, wird es woanders auch nicht sein!‘, sagte ich. Oh, ich hatte es so satt! ‚Ja, geh nur‘, schrie mein Vater. ‚Du wirst schon sehen, wie es ist, wenn man nicht weiß, wovon man leben soll. Das wird dir guttun! In spätestens zwei Wochen bist du zurück! Hoffentlich geheilt!‘ Ich zog mit Sack und Pack zu einer Freundin. Die Ärmste war nicht begeistert. Wir fielen uns nach kürzester Zeit furchtbar auf die Nerven. Sie verdiente schon und konnte gut davon leben. Ich hatte drei Semester Pädagogik hinter mir und konnte höchstens Nachhilfestunden geben. Mir blieb in den ersten Wochen gart nichts anderes übrig, als mich von ihr durchfüttern zu lassen. Das war eine schreckliche Zeit! Und meine Eltern jammerten dauernd, ich sollte zurückkommen. Aber das wollte ich unter keinen Umständen. Schließlich fand ich eine Stellung in einem – na ja – Nachtklub. Es war grauenhaft dort. Aber was sollte ich machen? Du kennst das wahrscheinlich gar nicht, wie das ist, wenn man kein Geld hat! Wenn man sich überhaupt nichts kaufen kann und sieht immer nur, was sich die anderen alles leisten. Es verändert den Menschen vollständig. Man wirft alles über Bord und will bloß eins: raus hier. Weg hier. Geld! Nichts anderes kann dich frei machen. Kein Mensch, keine guten Vorsätze. Bloß Geld. In der Bar habe ich ganz gut verdient. Aber ich konnte es nicht lange durchhalten. Tagsüber ging ich noch immer zu meinen Vorlesungen und bis tief in die Nacht hockte ich hinter den Gläsern und sah zu, dass sie voll blieben. Hätte ich auch mehr gemacht? Weiß nicht. Die einen halten die Möse hin, um Geld zu verdienen. Die anderen müssen zum Psychiater, weil einer seinen Schwanz da reingesteckt hat, ohne dass sie vorher ‚bitte‘ gesagt hatten. Reden kann man leicht. Besonders hinterher. Nach sechs Wochen bin ich völlig zusammengeklappt. Glücklicherweise hatte ich in dem Schuppen einen sehr netten Mann kennengelernt. Dem gehörten ein paar Boutiquen. Mit dem war ich ins Gespräch gekommen. Er hat mir angeboten, bei ihm zu arbeiten. Erst mal musste ich mich erholen, dann ging ich zu ihm hin und bekam die Stellung tatsächlich. Ich arbeite ganz selbstständig, es macht riesigen Spaß, der Laden läuft super, und ich verdiene ordentlich. Aber die Zeit vorher, die möcht ich nicht noch mal durchmachen. Dabei – mein Vater hatte recht: Es war wirklich ganz heilsam. Nur nicht so, wie er glaubte: Ich weiß jetzt, erst kommt meine Freiheit, dann kommt lange nichts, und dann kommen die Grundsätze.“
––„Und bist du bei deinem Boutiquebesitzer wirklich unabhängiger?“, fragte ich. Ich wusste, ich würde ihr nicht glauben.
––„O ja“, sagte sie, „er interessiert sich nicht für Frauen. Sehr, sehr praktisch. Ich liebe ihn dafür! Er interessiert sich, glaube ich, noch nicht mal für Männer. Er beschäftigt sich nur mit Krimskrams und mit sich selbst. Das füllt ihn so aus – er hat gar keine Zeit mehr für was anderes.“
––„Und die Finanzen machen Sie?“, fragte ich.
––„Nein, nein!“, sagte sie, „er ist ein glänzender Geschäftsmann, und Geschmack – den hat er. Sonst würden die Läden wohl auch nicht so gut laufen. Er weiß über alles genau Bescheid und hat zu allem eine Meinung. Nur, das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist er. Er sieht so richtig schön degeneriert aus. Ein Glück, dass er nicht geheiratet hat: Für die nächste Generation hätte die Erbmasse bestimmt nicht mehr gereicht!“
––„Du magst Dekadenz“, sagte ich.
––„Ach, einen kleinen Hauch von Tod und Laster finde ich ganz spannend“, gab sie zu.
––„Glaubst du, dass Tod und Laster zusammengehören?“, fragte ich.
––„Ich weiß nicht“, sagte sie, „manchmal.“
––„Denkst du viel über den Tod nach?“
––„Nein“, antwortete sie entschieden. „Ich weiß, dass ich irgendwann sterben muss, aber bedroht fühl’ ich mich davon nicht. Das ist für mich im Augenblick kein Problem. Genauso wenig wie die Kirche. Ich schiebe diese Gedanken nicht von mir weg, sie kommen mir gar nicht erst. Wenn mich etwas anderes als das Leben anfangen wird zu interessieren, dann werde ich mich damit beschäftigen. Und wenn ich morgen vom Dach falle, dann habe ich es eben versäumt, über den Tod nachzudenken, aber dafür habe ich gelebt!“
––„Was verstehst du darunter, zu leben?“
––Sie senkte den Kopf für einen Augenblick und zeigte dabei ein Paar wunderschöner Wimpern, die selbst ich sofort als falsch entlarven konnte. „Eindrücke zu sammeln und zu hinterlassen“, sagte sie. Ihre Finger waren lang und schmal, mit spitzen, gefährlichen Nägeln. „Am liebsten möchte ich alles durchleben, jede Zeit, jedes Schicksal. Geht dir das nicht auch so?“
––„O nein!“, sagte ich, „mir wird mein eigenes Leben schon fast zu viel.“
––Sie sah mich prüfend an, und ich ärgerte mich über meine unbedachten Worte. Ich versuchte zu lächeln, aber ihr Blick veränderte sich nicht. Die dadurch entstehende Pause war quälend.

Titelillustration mit Material von Shutterstock: Nora_n_0_ra (Porträt Mann), Kateryna Tsygankova (Schwimmer), Davizro Photography (Daumen runter), Dean Drobot (Frau mit Champagnerglas), bellena (Café), Look Studio (Frau links), Seprimor (Augen unten rechts)

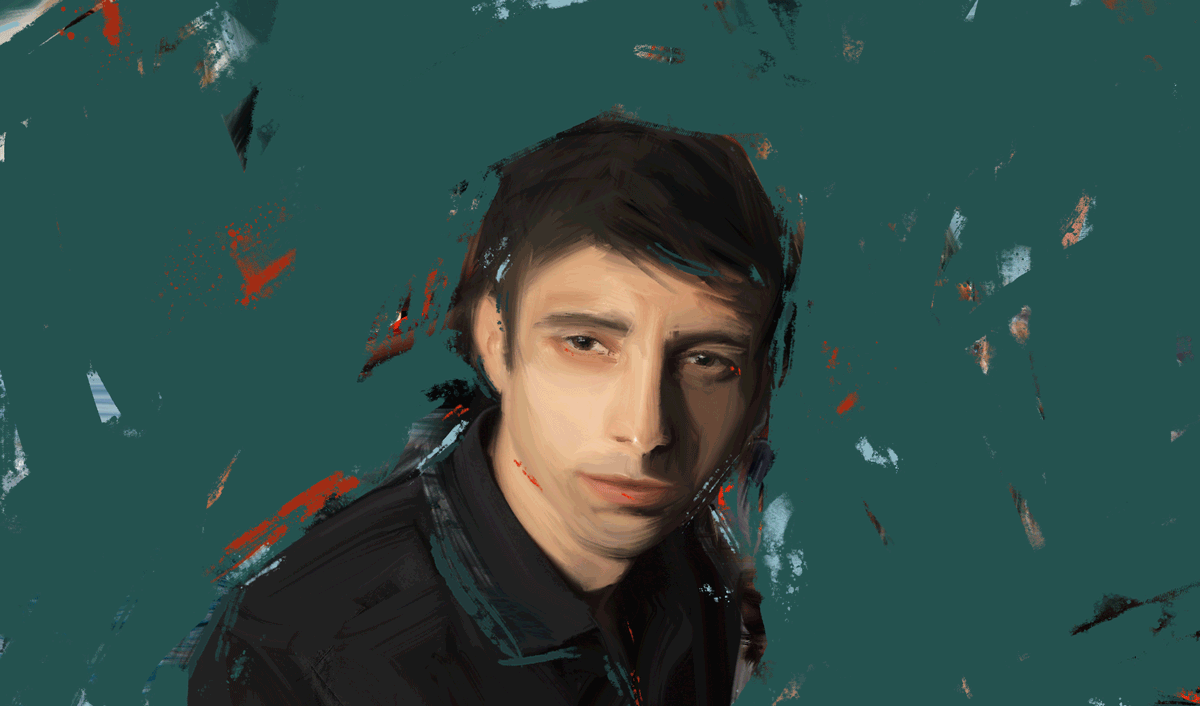

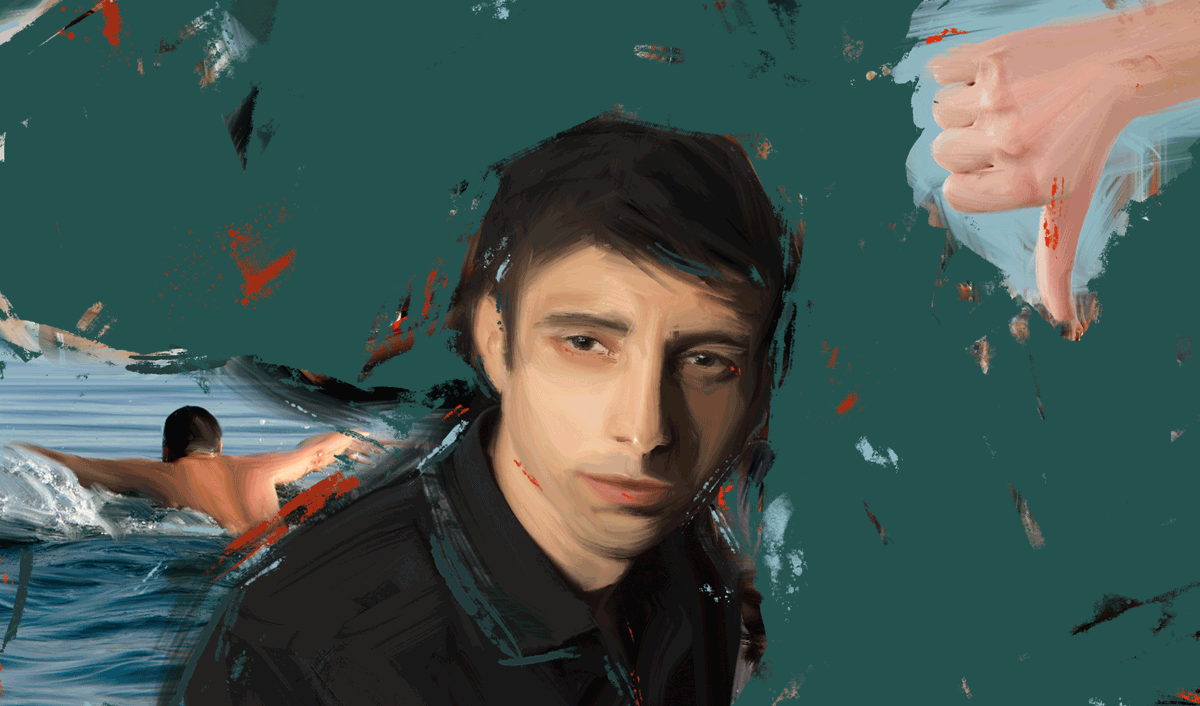
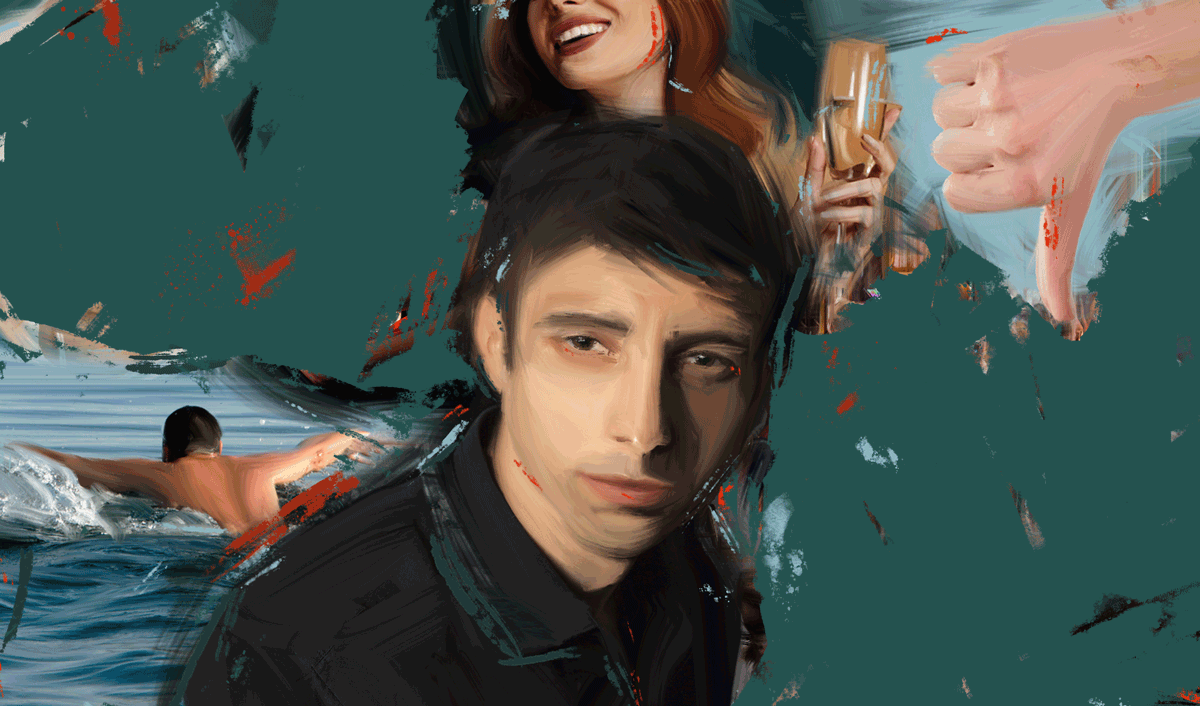
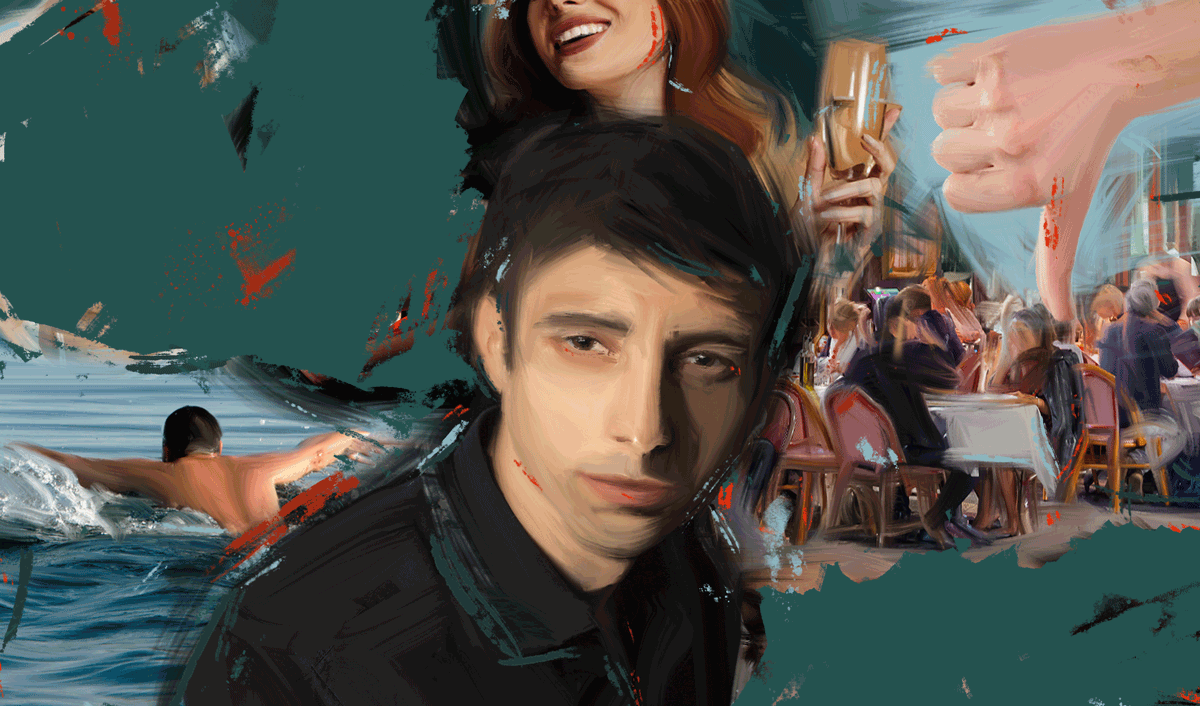
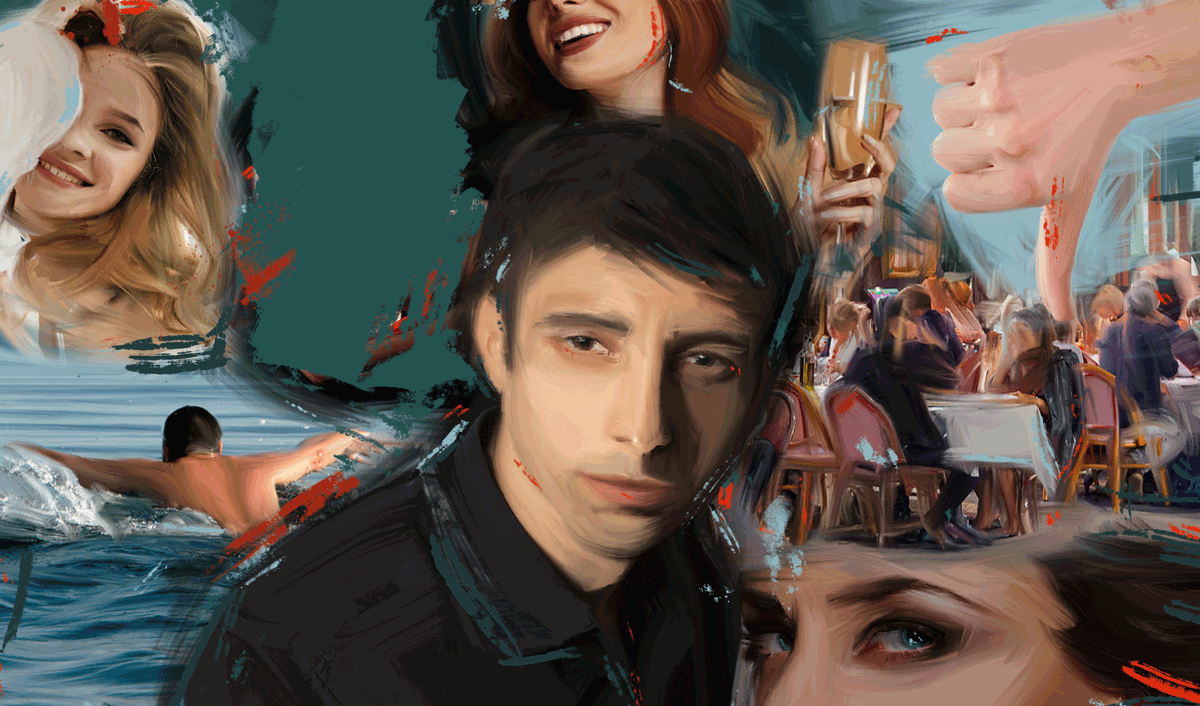

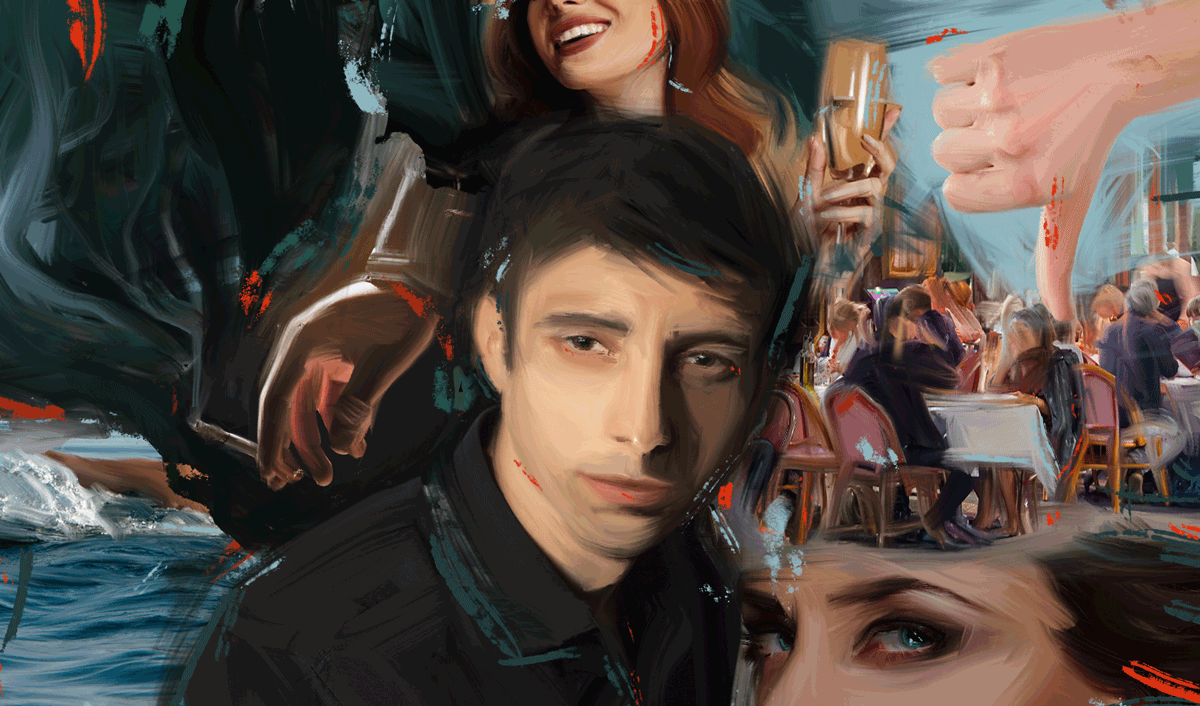
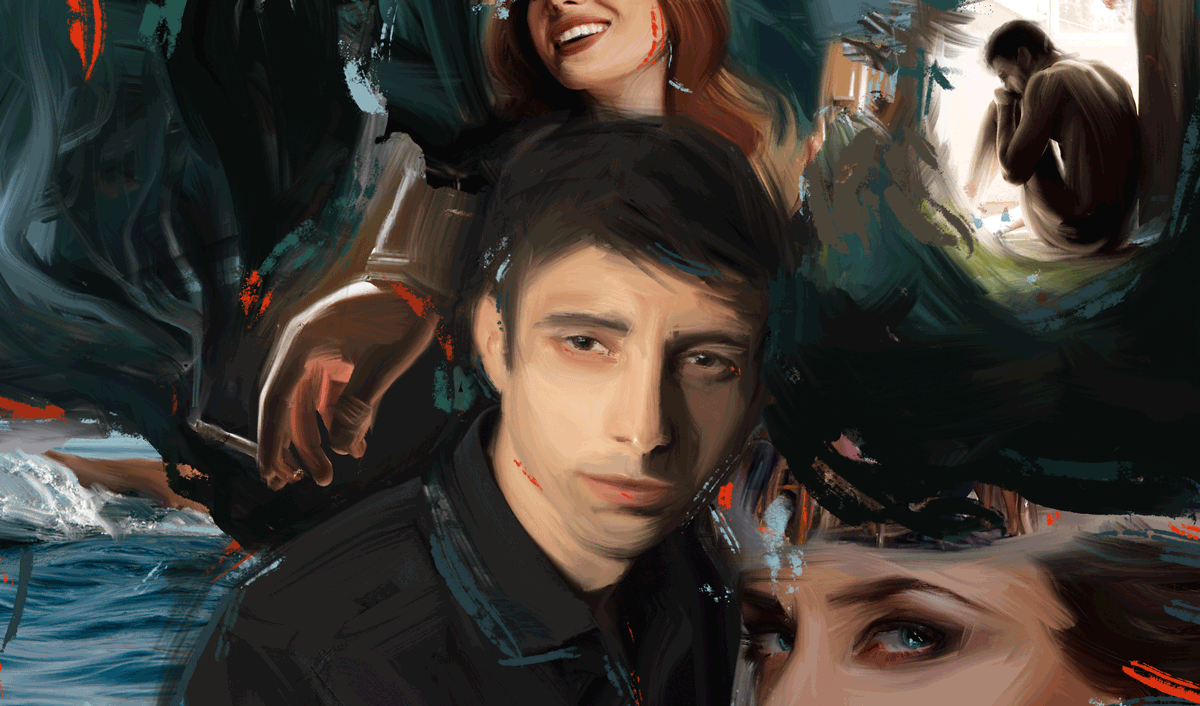
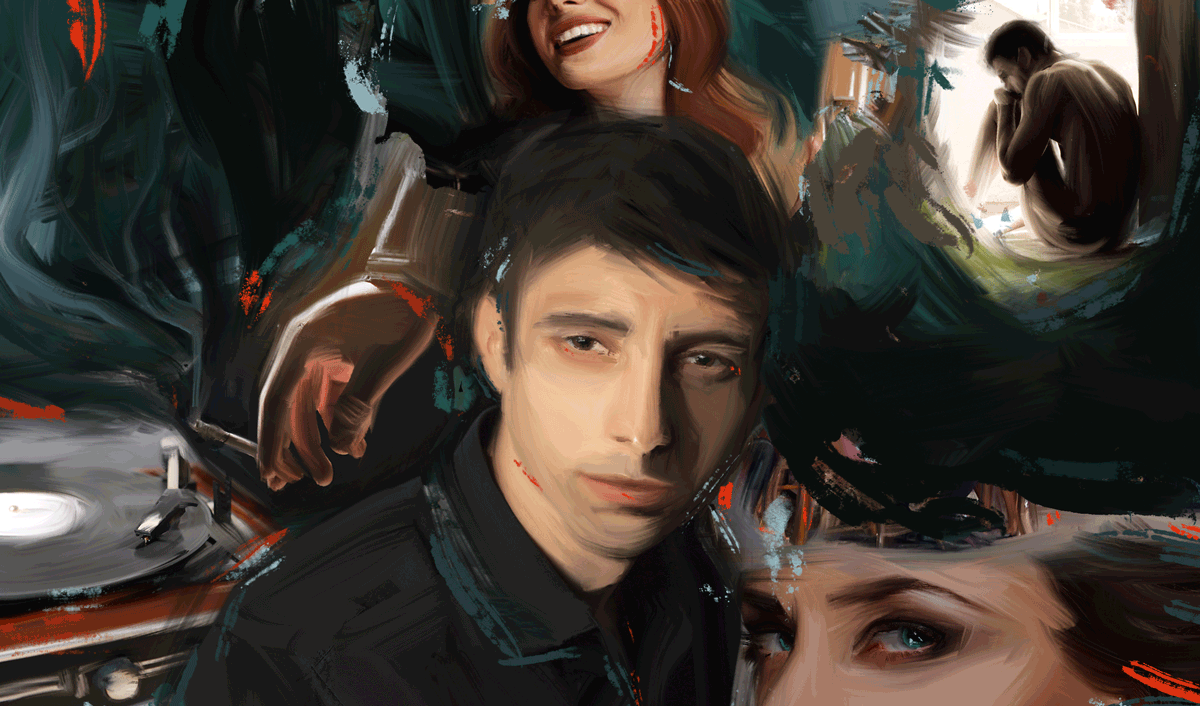
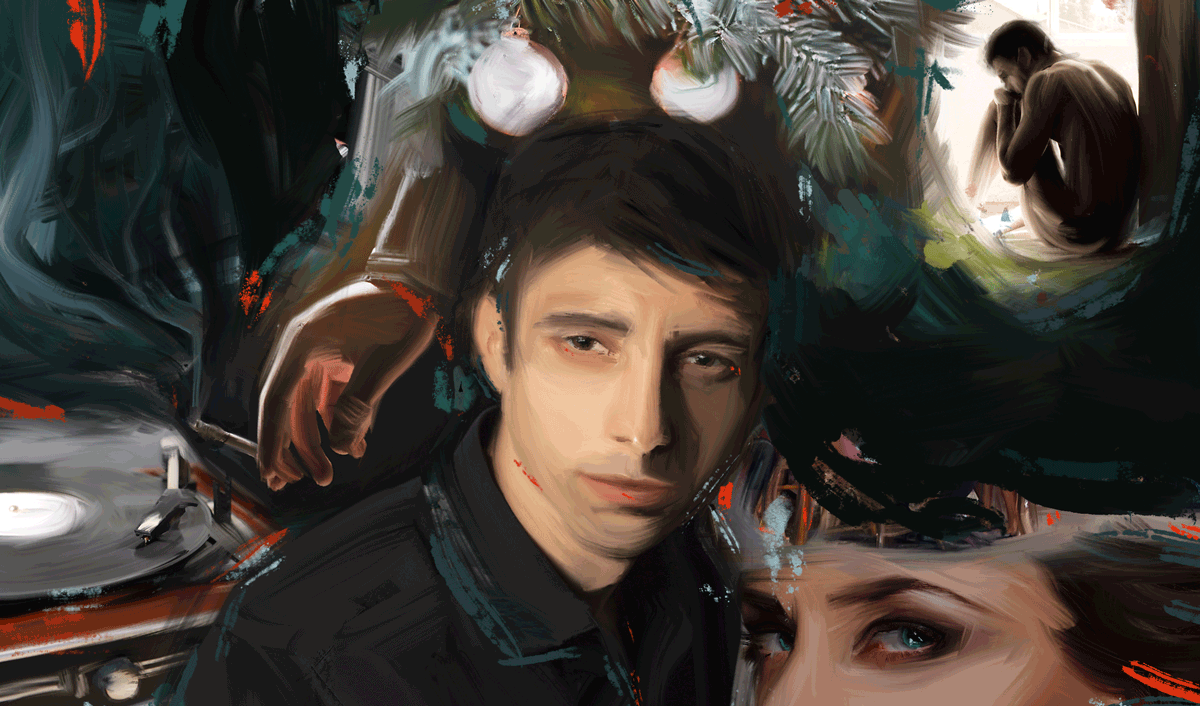
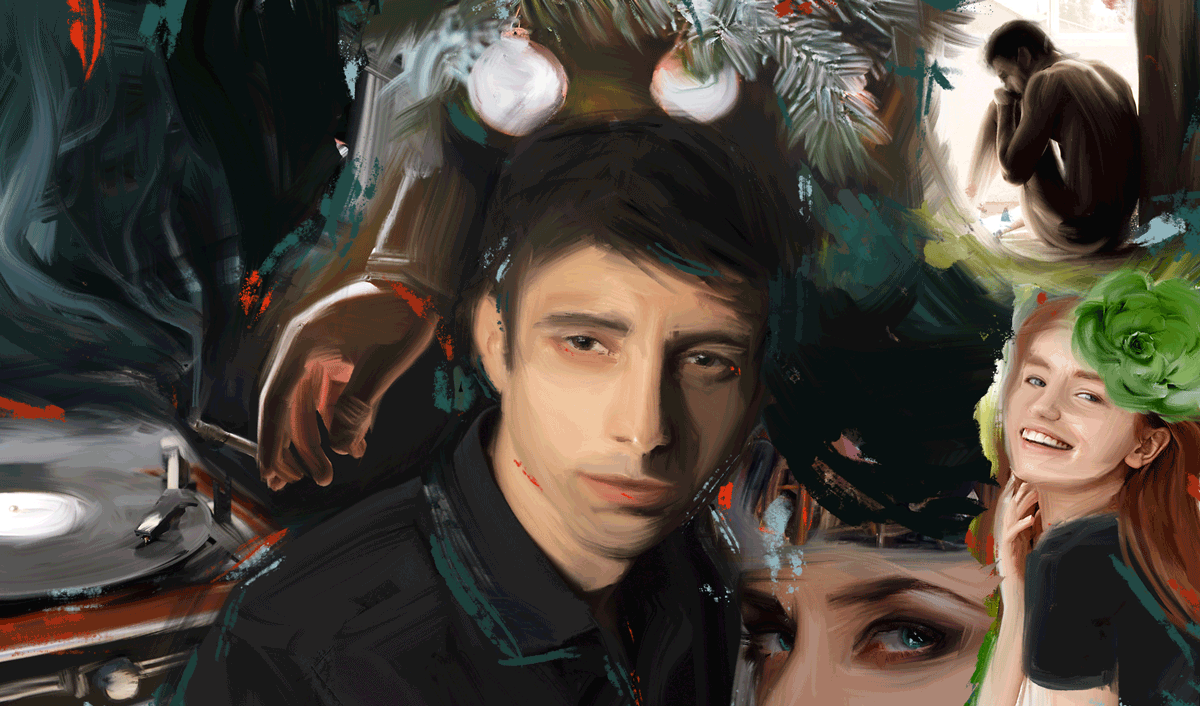
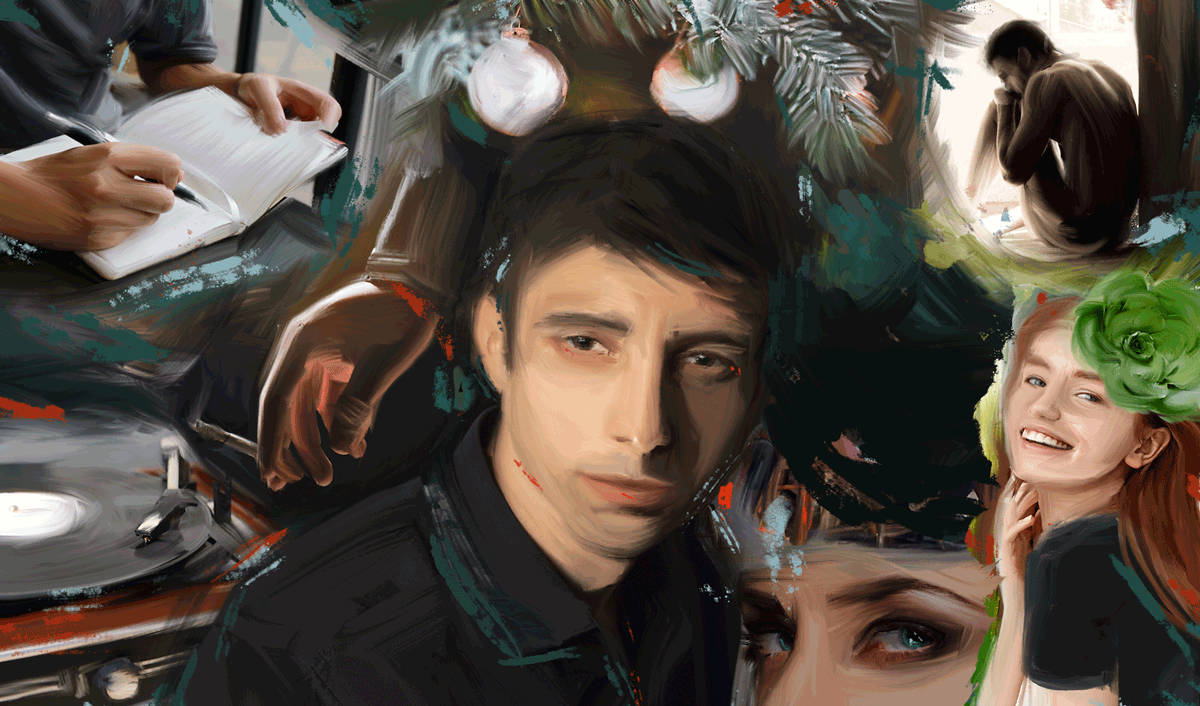
Ein wenig Dekadenz darf es schon sein 😉
Wenn man sich zu sehr an die Dekadenz gewöhnt wird das schnell langweilig. Dann muss es doch wieder mehr und immer mehr sein. Aber so ein bisschen muss das Leben ab und an schon überfließen, sonst fehlt doch irgendetwas.
Meine Mutter sagte: „In der Dekadenz lebt es sich angenehm. Im Aufbruch muss man ständig siegen!“
Hahaha! Das klingt obendrein so logisch, da kann man nicht widersprechen!
„Was verstehst du darunter, zu leben?“ Zu dieser Frage gibt es bestimmt ähnlich viele Antworten wie es Menschen gibt.
Und was wäre Ihre Antwort?
Das klingt vielleicht zu esoterisch, aber ich würde fast sagen meine Umwelt und meine Mitmenschen eine klitzekleines bisschen besser zu machen.
@Daniel Lends: Ein wenig glücklich zu sein und wenn möglich andere Menschen auch noch ein wenig glücklich zu machen. Viel mehr kann man vielleicht gar nicht erwarten.
Diejenigen, die statt des klitzekleinen Bisschens lieber das Große Ganze wollten haben ziemlich viel Unheil angerichtet – allerdings die Menscheit auch weitergebracht.
Ja das stimmt wahrscheinlich. Ohne Extreme und extreme Persönlichkeiten stünden wir wohl anders da.
Anders ohne jede Frage. Aber wäre unsere Situation schlechter oder vielleicht sogar besser? Kann man das überhaupt sagen?
Eventuell stünden wir noch vor Nutzbarmachung des Feuers, vielleicht aber bloß vor der Erfindung der Rads.
Diese Situation mit den unbedachten Worten am Ende kenne ich so gut! Da wird einem immer bewusst wie schwierig Kommunikation sein kann, bzw. wie präzise man mit seiner Wortwahl sein muss.
Das kann selbst bei guten Freunden passieren. Früher lag ich dann nachts im Bett und habe mich geniert.
Habe ich auch schon genauso erlebt. Und ein paar wenige Male nicht mal richtig gemerkt, dass ein guter Freund durch eine unglückliche Wortwahl tatsächlich verletzt war.
Arbeit macht hässlich? Jemand, der sehr gut in seiner Arbeit ist, kann auch ziemlich sexy sein.
Das ist ja eine sehr spezifische und wahrscheinlich auch nur provokant dahingesagte Meinung dieses Ich-Erzählers. Natürlich stimmt das so erstmal nicht, denn arbeiten tun wir natürlich alle. Und die gesamte Menschheit ist meiner Meinung nach nicht per se hässlich.
Aimee behauptet das (unernst und auf Knochenarbeit bezogen). Ich-Erzähler Christian antwortet:“Die Hässlichkeit, die durch Nichtstun entsteht, ist noch abstoßender.“, sagt damit also das Gegenteil.
Es wird ja recht deutlich, dass die Figuren dieser Erzählung sich gegenseitig mit ihren Aussagen herausfordern. Man kann da nicht jeden einzelnen Satz sezieren.
Finanziell bzw. beruflich selbstständig sein, möchte ich nicht mehr missen. COVID macht es einem zwar beileibe nicht einfach, aber in der starren Struktur einer Firma zu sein wäre für mich auch keine Alternative mehr.
Das ist halt immer die Entscheidung zwischen Freiheit und Sicherheit. Beides auf einmal geht nicht, man muss also entscheiden, was persönlich wichtiger ist.
Die einen entscheiden lieber, die anderen führen lieber Befehle aus, auch wenn das etwas freundlicher genannt wird. Für bewegliche Menschen ist das der Unterschied zwischen Risiko und Frustration, für Systemkritiker der Unterschied zwischen Kapitalisten und Sozialisten.
Meist findet man sich ja eh irgendwo in der Mitte, bzw. handelt unterschiedlich je nach der Situation, in welcher man sich gerade befindet.
urrrgh, was für ein unmögliches wort ist möse eigentlich? benutzt das jemand wirklich?
Ich hasse das Wort auch, aber der unbekümmerte Gebrauch charakterisierte Aimee damals ganz gut. Heute gilt die M*se eher als Verniedlichungsform von F*tze: Diese Bezeichnung wird ja schon in fast jedem öffentlich-rechtlichen Fernsehspiel von der obligatorischen Rotlichtgröße auf die umstehenden Damen angewandt. Und dann sagt er: „Fuck!“
Die Chance überraschend vom Dach zu fallen haben ja nicht viele, aber wer zu seiner Lebzeit nie über den Tod nachgedacht hat, na der hat sich ein recht glückliches Leben geführt.
Denken schändet nicht. Lieber ein bisschen unglücklich als brumzkachelblöd.
Es gibt ja genügend andere Dinge über die man nachdenken kann 😉
Ich bin manchmal über mich selbst erstaunt, vielleicht ist es wirklich das Alter. Ich dachte immer, der Tod berührt oder beschäftigt mich nicht sonderlich, aber in letzter Zeit denke ich ebenfalls erstaunlich oft darüber nach. Über meine Eltern, die langsam sehr alt werden. Über Freunde und Menschen, die ich liebe…
Den Verfall seiner Umgebung mitzuerleben ist schmerzlich. Den eigenen Abbau nehmen wir weniger wahr, wenn nicht einzelne Ereignisse uns unmissverständlich darauf stoßen.
Ich habe auch erst angefangen an mein eigenes Alter zu denken, als meine Eltern langsam älter wurden. Es braucht wohl wirklich diesen äußeren Reiz um über solche Dinge nachzudenken.