
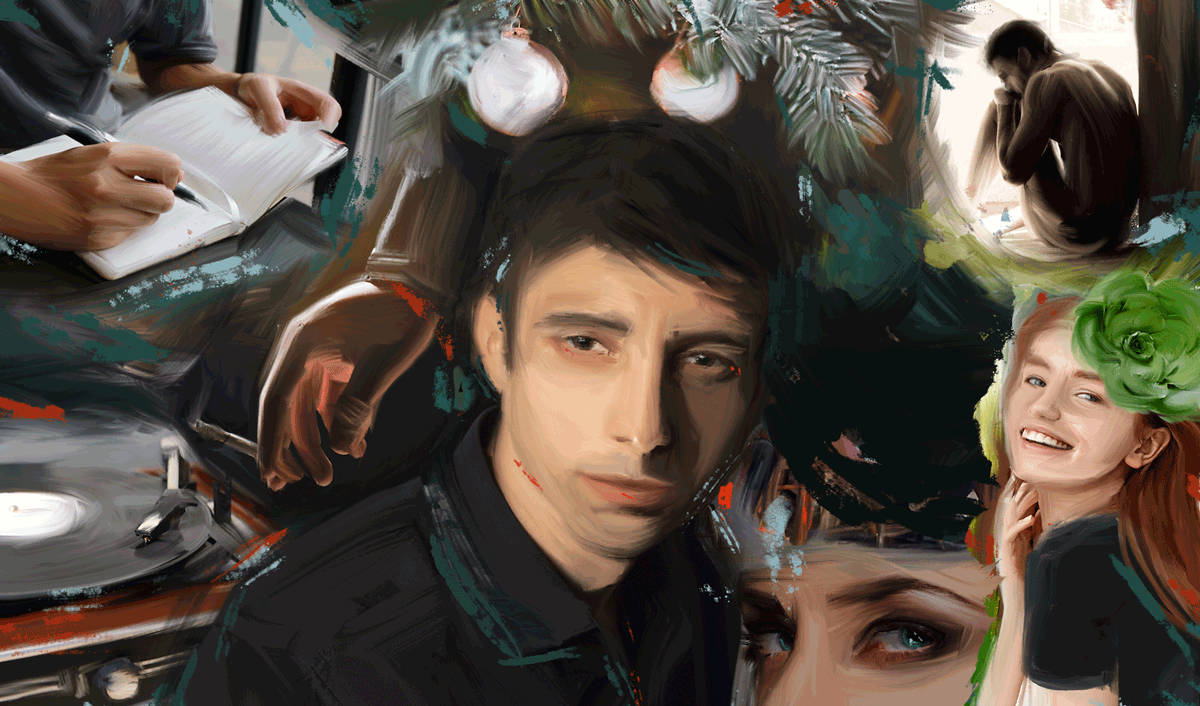
Es war ein sonniger, aber kühler Sonnabend Anfang April.
––Ich hatte meine Lebensmittel eingekauft und außerdem noch ein Paar hellblauer Socken, deren kräftiger, beruhigender Ton mir sofort aufgefallen war. Als ich meine Sachen im Wagen unterbrachte, dachte ich, es würde mir sicher guttun, einen längeren Spaziergang zu machen. Ich stieg also ins Auto und fuhr in einen nahe der Stadt gelegenen Wald, der von meiner Wohnung aus einigermaßen günstig zu erreichen war. Ich stellte meinen Wagen auf einem schmalen Sandweg ab und ging zu Fuß weiter.
––Das Unterholz war von einem schwebenden, kraftvollen Grün erfüllt. Auf den hochstämmigen Buchen lag der erwartungsvolle Schatten knospender Blätter. An die stumpfen Zweige, die bemoosten Steine, die gepflügten Äcker hatte sich das aufbrechende Grün geheftet, durchdrungen vom Glitzern der Sonne, dem Sirren der Insekten, dem Rufen der Vögel. Vibrieren, Wachsen, Werden. Ein Jahr entsteht.
––Ich fühlte mich heiter und ausgeglichen.
––Hier war alles geblieben, wie es Jahrhunderte hindurch gewesen war. Der Wandel der Natur im Kreis des Jahres war die einzig spürbare Veränderung. Ein gleichbleibender, ungehemmter Ablauf, fern allem, was mein Leben ausmachte.
––„Die Jahreszeiten werden weiterlaufen“, dachte ich. „Die Welt wird bestehen bleiben. Nichts hält inne in seiner Bewegung – nur mein Leben.“
––Mein Tod ist nur für mich wichtig.
––Nur für mich trage ich Verantwortung.
––Natürlich wird es einige Menschen geben, die traurig oder sogar entsetzt sein werden. Der Schmerz mag eine leichte Furche in ihr Leben graben, meines wird dann schon abgeschlossen sein. Nichts hinzuzufügen, durchgestanden, vollendet. Vielleicht werden sie mich beneiden, dass ich es hinter mir habe, und hilflos werden sie sein, hilflos wie der schlaffe Körper eines Toten, ohne Zugang, ohne Verständnis.
––Ist es rücksichtslos von mir? Wem bin ich Rechenschaft schuldig? Denen, die sich in zwanzig, dreißig Jahren an irgendein Ereignis dieser Tage erinnern und sagen werden: „Mein Gott, lebte damals nicht sogar Christian noch? Wie die Zeit vergeht!“ Mit meinem Leben zerstöre ich gleichzeitig alle Hoffnung auf Macht und Bedeutung.
––Doch wie viele Menschen erreichen schon Macht und Bedeutung, obwohl sie ein dreiviertel Jahrhundert lang an ihrem zähen bisschen Leben kauen und das Ritual ewiger, stumpfsinniger Wiederholungen ergeben hinnehmen, ohne etwas anderes zu erreichen als den allmählichen Verfall aller Sinne und Organe, belohnt durch ein Alter in zahnloser Verständnislosigkeit?
––Ich gehe lieber, bevor man mich vor die Tür setzt. Und wenn mich überhaupt noch etwas hält, wenn ich nicht schon längst dieses Dasein mit einer anderen Dimension vertauscht habe, die hier zu errichten mir die Kraft fehlt, dann nur wegen der sanften Linie, die der Horizont jenseits der Talsenke an den unteren Rand des Himmels zeichnet, wegen der schmalen Senkrechte einer Kiefer, die die Landschaft in zwei wohlproportionierte Hälften teilt, der schweren Schönheit eines überhängenden Astes, der vertrauten Stimme, die Verständnis signalisiert, der anschmiegsamen Geste einer liebevollen Hand und all der anderen nichtigen Kleinigkeiten, an die wir uns klammern, um das Leben zu ertragen – bis wir die Unzulänglichkeit solcher Hilfsmittel durchschauen, zu durchschauen glauben und sie weiterlieben.
Als Kind hatte ich doch auch die Dinge hingenommen, wie sie sich mir zeigten, ohne zu fragen: Was steckt dahinter, was kommt danach? Irgendwann hatte ich angefangen, die Formen in ihre Einzelheiten zu zerlegen. Doch wenn ich das schon tat, warum war ich nicht in der Lage, die Teile neu zu ordnen zu einem sinnvollen Ganzen?
––Es ist richtig, alte verwohnte Gebäude abzutragen, wenn man den Platz braucht, um neue zu errichten. Doch ohne Baupläne kann man nicht arbeiten. Um Baracken zusammenzuzimmern, lohnt es sich nicht, Häuser einzureißen. Wenn man aber das Bestehende trotz dieser Einsicht nicht erträgt, wenn man zwanghaft alles zersetzt, ohne weiterzuwissen, dann ist man am Ende – wie ich. Es ist schön, alles zu glauben, was man sieht. Doch weder fremde noch eigene Kraft vermag den Menschen daran zu hindern, mündig zu werden, wenn seine Zeit gekommen ist. Fühlt er sich dann seiner Aufgabe nicht gewachsen, so kann er nur hoffen, durch den Tod in eine erträglichere Wirklichkeit versetzt – oder ausgelöscht – zu werden.
Wäre ich doch damals weitergeschwommen, als Andreas mich zurückrief! Dann brauchte ich jetzt nicht die schmerzenden Vogelstimmen zu hören, das quälende Grün zu sehen, das fließende Licht zu spüren, die Verlockung, nicht aufzugeben, sondern einen Ausweg zu suchen, den es nicht gibt. Ich will keine modernde Leiche sein! Mir graut vor den leeren Augen, dem verwesenden Hirn.
––Warum kann der Tod nicht vollkommen sein? Warum lässt er es zu, dass sein Sieg geschmälert wird? Weshalb muss der Körper zurückbleiben, dem Leben als Geisel, die von den niedersten Truppen auf das Schrecklichste zernagt und entstellt wird? Weshalb duldet der Tod diese Abschreckung?
––Können wir nicht tauen wie Eis, verdampfen wie Wasser? Schmelzen wie der Schnee.
Ich bohrte meine Hände tiefer in die Manteltaschen und fühlte etwas Kaltes, Glattes. Ich zog es heraus. Es war das Röhrchen mit Schlaftabletten von Sybille. Ein Zucken durchstieß mich. „Jetzt, da der Himmel hoch ist. Da die Felder nackt, aber nicht mehr kahl sind, da die Vögel singen wie in alten Liedern. Jetzt, im Frühling!“ Als betäubender Schlag, als jähe Erkenntnis traf mich der Entschluss.
––Rechts von mir zog sich jenseits des schmalen Grabens eine Schonung entlang. Es waren menschengroße, eng gesetzte Tannen.
––„In dem Dickicht wird mich so bald keiner finden“, dachte ich. Ich zog den Stöpsel aus der Röhre. Ihr Inhalt glitt in meine Hand. Hastig schlug ich die Hand mit dem weißen, mehligen Haufen gegen meinen geöffneten Mund. Doch ich zitterte so, dass ein paar Tabletten herunterfielen. Ich ging in die Knie, sammelte sie auf und stopfte sie hinterher. Ich biss und kaute. Sand knirschte zwischen meinen Zähnen. Mein Gaumen war von einem bitteren Geschmack verklebt, der meinen Mund zusammenzog. Ich würgte, schluckte, schnappte nach Luft, sammelte Spucke in meinem Mund, schluckte wieder. Eine Pfütze. Ich schwappte mir Wasser in den Mund. Ob es giftig war? Ich schluckte die Pampe. Gleich werde ich mich auslachen. Nein? Da lief ich los. Über den Graben, hinein in das zusammengefügte Grün, gegen dicht verschränkte Zweige, mit gesenktem Kopf und mühsamen, wackelnden Schritten. Gleich musste die Wirkung einsetzen. Mein Körper würde sich auflösen, weggleiten. Spürte ich nicht schon die beginnende Schwäche? Ich kämpfte mich vorwärts, schwer atmend zwischen Stämmen und Ästen hindurch. Wieder musste ich auf den Tod warten. Ich hatte ihn eingeleitet, beschleunigt, aber nicht überrumpelt. Er bestimmte den Zeitpunkt, und ich trieb hilflos durchs Gestrüpp. Plötzlich fielen mir die Socken ein, die hellblauen Socken, die ich nie tragen würde. Konnte ich in den letzten Minuten meines Lebens an nichts Wesentlicheres denken?
––Nein, immer nur diese Socken auf dem Rücksitz meines Wagens. Sie würden erst ihn finden und dann mich. Hellblau, ein tiefes Hellblau. Der Himmel. Das Meer glitzert, die Nadeln.
––Warum hatte ich sie gekauft? Hellblau für die Jeans, und nie würde ich sie tragen. Ich wollte friedlich, gefasst sterben. Ich stolperte, taumelte. Nur weiter! Wenn ich sie doch noch einmal berühren könnte! Hellblau, eine weiche, hellblaue Wolle. Meine Füße schwammen. Ich zerrte an den Zweigen. Die Nadeln. Ich musste laufen, immer laufen und nach Luft schnappen, keuchen und das Blau vor mir sehen, hell und ruhig und kräftig. Mein Gott, ich lief ja zurück! Wieder zurück zu dem Weg, auf das Feld zu, in das Licht. Meine Schwäche. In diesen Nadeln. Könnte ich doch liegen, fallen. Überall Nadeln. Mein zerkratztes Gesicht. Aus Wolle, hellblau. Ohne Arme, Beine, nur Schrammen, Wunden, Schweiß. Weiter. Einmal, nur einmal. Mein Atem, mein Herz und Gestrüpp. Vorwärts! Einmal nur aus himmelblauer Wolle. Blutiges Brennen. Auf Knien, mit Händen greifend. Nicht jetzt! Noch nicht. Unter Zweigen … Nadeln hindurch … dunkle feuchte Erde … kriechend. Plötzlich: Kühle, blendendes Licht. Abgrund, ein harter Schmerz. Hoch! Zum letzten Mal, ich kralle … Boden … Fußspuren … DER WEG … Schritte, Rufe, zwei Menschen, ich sacke ins Dunkel …
Was ist es, was zählt? Dinge, auf die wir uns freuen, bedeuten uns nur etwas bis zu ihrem Eintritt. Jede Erfahrung ist ein Schmerz. Für jeden kleinen Satz, der bewusst empfunden ist, steht ein Tag Leiden. Nichts von dem, was uns zufällt, besitzt Gültigkeit, nur das, was wir uns mühsam erwerben, kann bestehen. Das Leben ist schön, wenn der Schmerz vorbei ist, der Druck geschwunden. Etwas in sich einäschern, ein anderer sein. Die Sonne auf- und untergehen sehen. Von Hügel zu Hügel blicken. Ein klösterliches Leben zwischen Weinbergen. Gänge durch abgeschiedene Wälder. Duft nach Harz und Sonne.
––Doch Urtümelei ist mir zuwider. Ich stehe am Ende der Reihe. Ich bin nicht der, der schafft, ohne zu fragen, der türmt und schichtet in selbstloser Selbstverständlichkeit. Ich besitze nicht die unbewusste Kraft des Ursprünglichen. Ich bin der, der zurückblickt, nachvollzieht und alles mit der zersetzenden Säure des Bewusstseins durchtränkt. Ich betrachte, beurteile, belächle. Ich weiß alles und glaube nichts.
Verfeinerung, Überzüchtung. Satire, Farce, Dekadenz. Die jahrelangen Entdeckungsreisen meiner Ahnen zeichne ich in wenigen Tagen nach. Der riesige Bau ihrer Systeme und Bezüge ist zu einer winzigen Hütte zusammengeschrumpft. Jede Ecke ist ausgeleuchtet. Überall stoße ich gegen Wände und keine kann ich durchbrechen. Ich lebe in der Vergangenheit, indem ich ihre Begriffe ablehne und ihre Gültigkeit bestreite.
––Ein neues Sprechen, Denken, Fühlen müsste geschaffen werden. Ein neues Leben mit neuen Inhalten. Ein neues Bewusstsein. Doch wer ist in der Lage, den Grundstein dafür zu legen?
––Trotzdem will ich versuchen, etwas zu leisten.
Die Zeit in der Psychiatrie – sinnlos. Depression. Na und? Pillen und Worte. Danke, danke! Ist ja gut.
––Aber danach, während der sechs Wochen, die ich jetzt im Sanatorium verbracht habe, habe ich zu malen begonnen. Die Schwestern und sogar die Ärzte sagen, ich hätte Talent. Auch ich bin zufrieden, denn ich sehe Fortschritte. Es ist erstaunlich, was man alles auf die Leinwand bringen kann, wie viel sich mit Formen und Farben ausdrücken lässt. Ich bin entschlossen, mein Studium aufzugeben und an die Kunsthochschule zu gehen, wenn ich meine Kur beendet habe. Außerdem schreibe ich. Jetzt. Niemand soll es lesen. Aber es soll da sein. Existieren. Wie ich.
––Der Wille, berühmt zu werden, ist eine treibende, dem Leben zugewandte Kraft, und doch muss ich auch diesen Trieb fürchten, wenn er sich über alle Schranken hinwegzusetzen beginnt.
Ich liege auf der Terrasse und sehe weit ins Tal hinab.
––Die Wiesen trinken die heiße Sonne. Auf den Wäldern lastet Staub. Der Fluss, unten am Fuß des Berges, schleppt sich schwerfällig zwischen den trockenen Steinen hindurch.
––Ich liege unter einem großen Sonnenschirm. Neben mir steht ein Glas mit Zitronensaft. In manchen Augenblicken spüre ich, dass mich nur eine dünne Wand vom vollkommenen Glück trennt.
––Und doch ist es nur ein weiterer Aufschub. Es hat sich zurückgezogen und regt sich kaum. Verborgen, fast unsichtbar, schläft es, von den Anstrengungen des Angriffs erschöpft.
––Aber bei großer Stille kann ich es fühlen, nach wie vor, ganz tief, ganz leise. Ich gehe darüber hinweg und versuche, nicht daran zu denken. Ich lächle und sage, ich sei geheilt.
––Diesmal ist es noch gut gegangen. Vielleicht wird es auch noch das nächste Mal gut gehen. Doch es wird immer wiederkommen, zäher, wilder, furchtbarer. Eines Tages wird es mich besiegen. Dann werden sie mich finden, irgendwo, irgendwann, und niemand wird wissen, wie und warum.

Titelillustration mit Material von Shutterstock: Nora_n_0_ra (Porträt Mann), Seprimor (Augen), Kitti Krotsurikan (Hand mit Zigarette), alpkhan photography (nackter Mann), Pixel-Shot (Plattenspieler), kate_k (Weihnachtsbaum), Cookie Studio (rothaarige Frau), woo jung hoon (grüne Papierblume), aodaodaodaod (Hand mit Notizheft), dugdax (Wald)

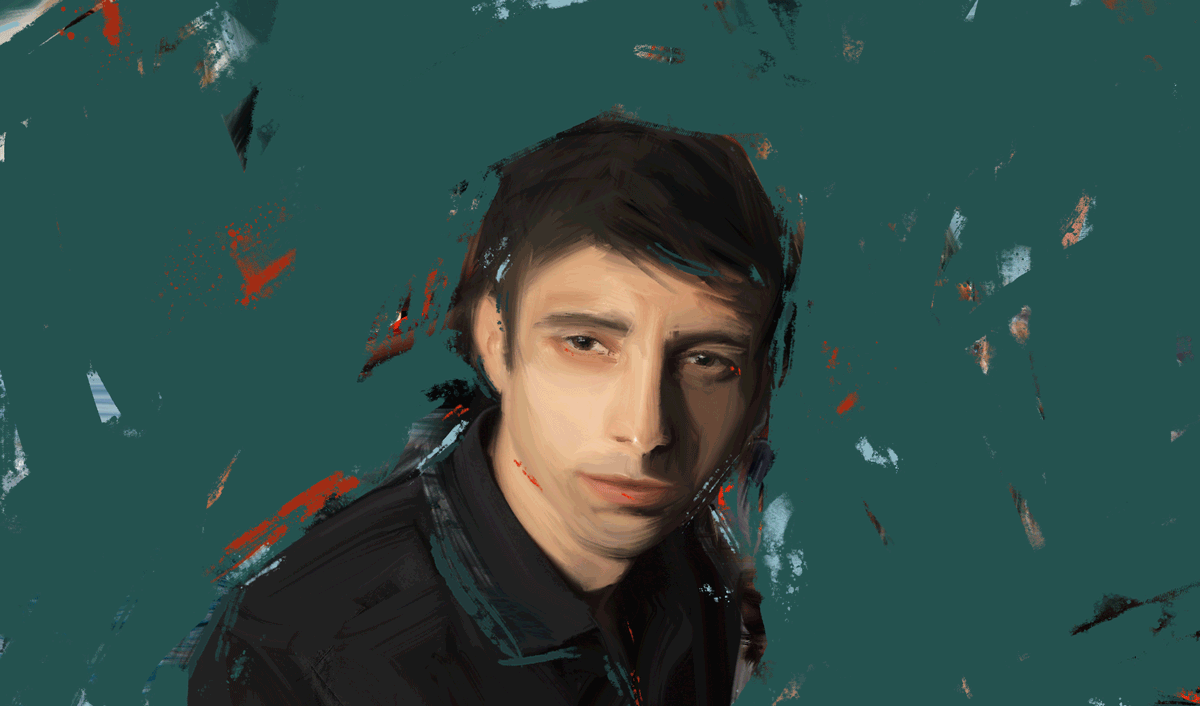

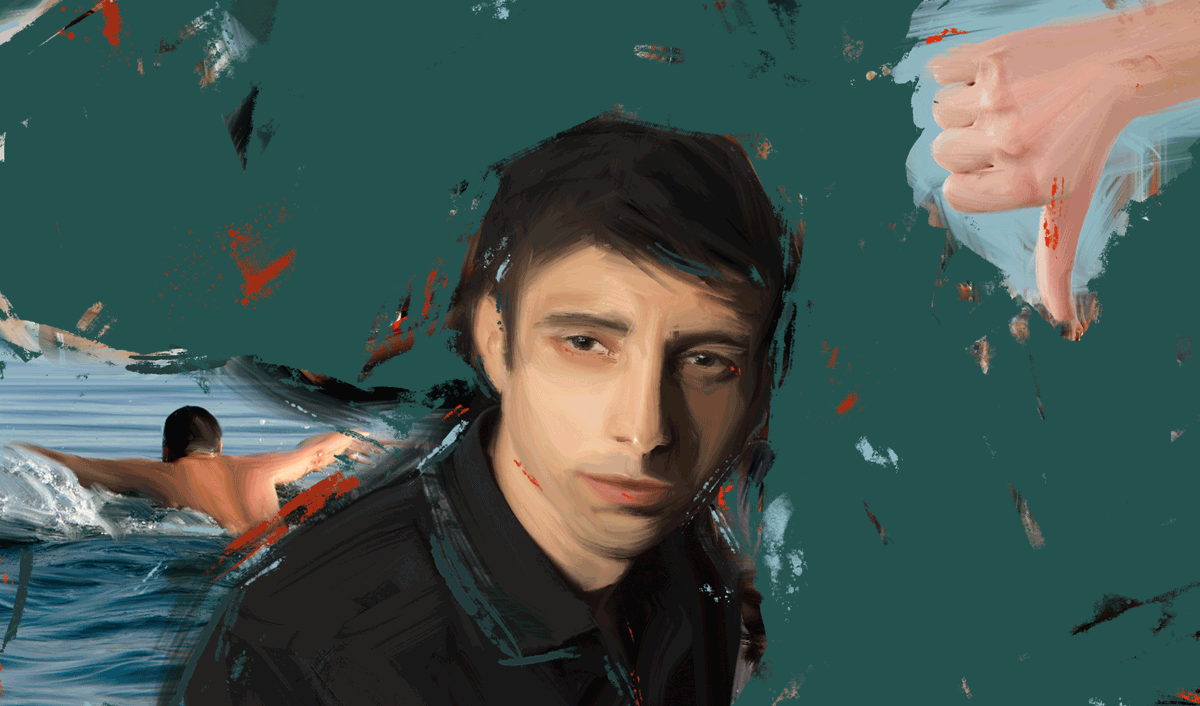
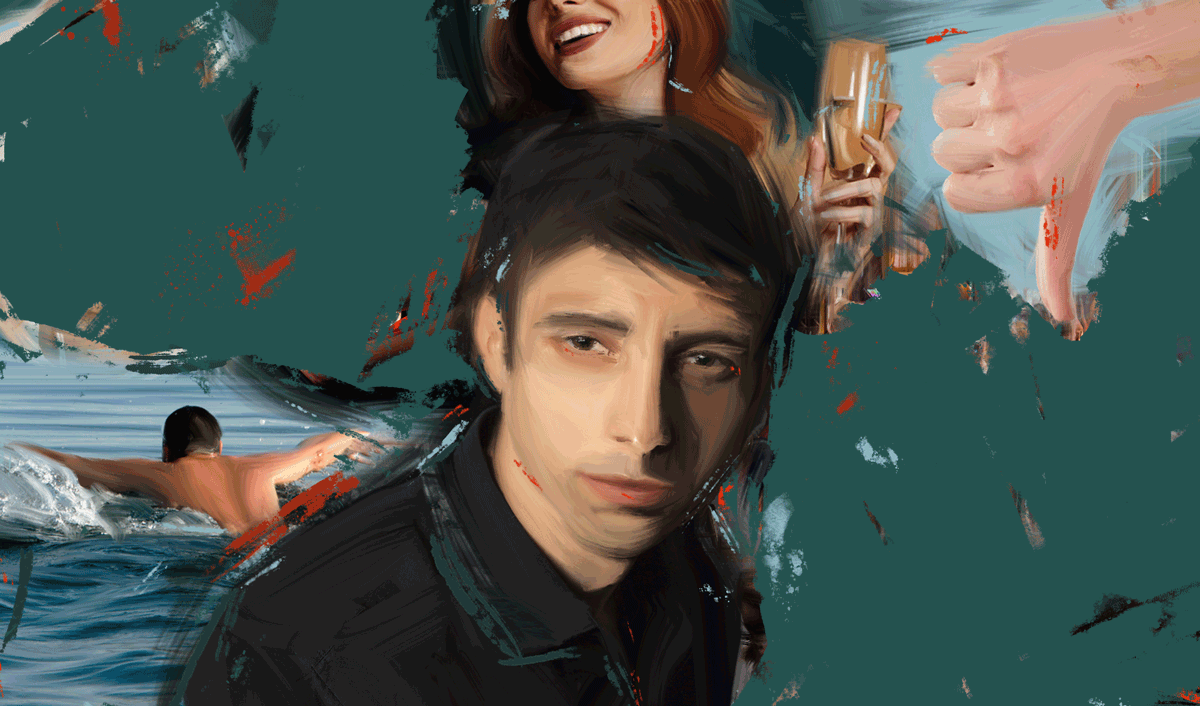
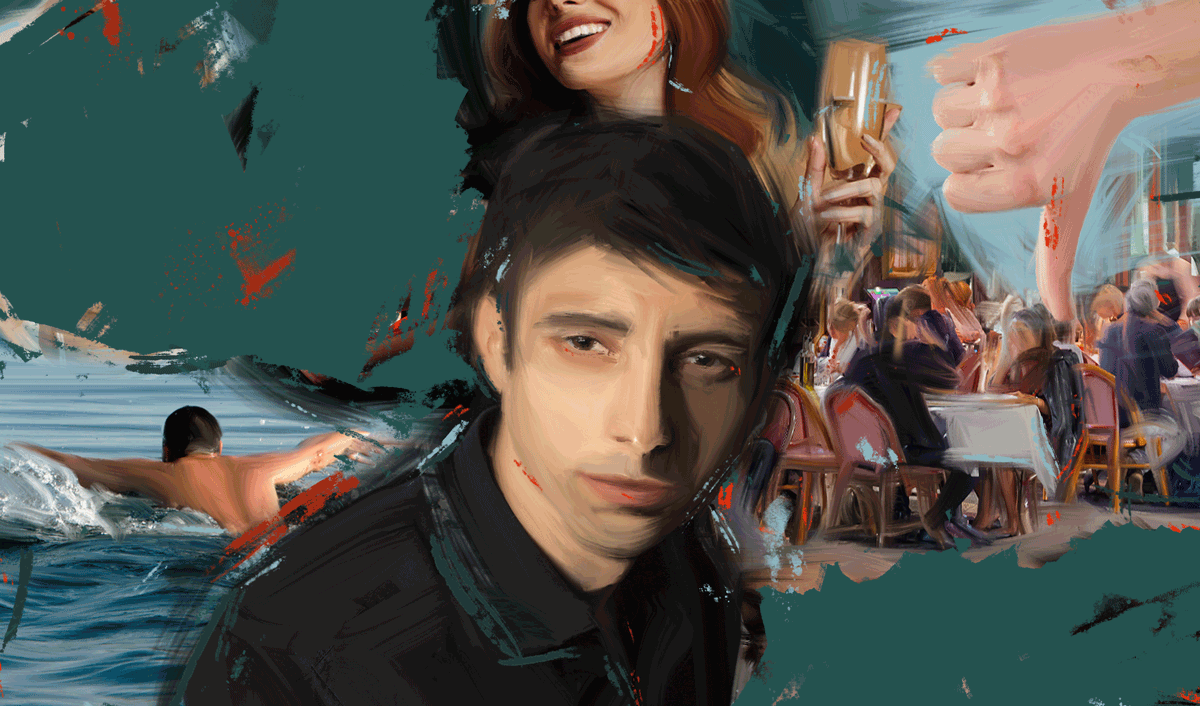
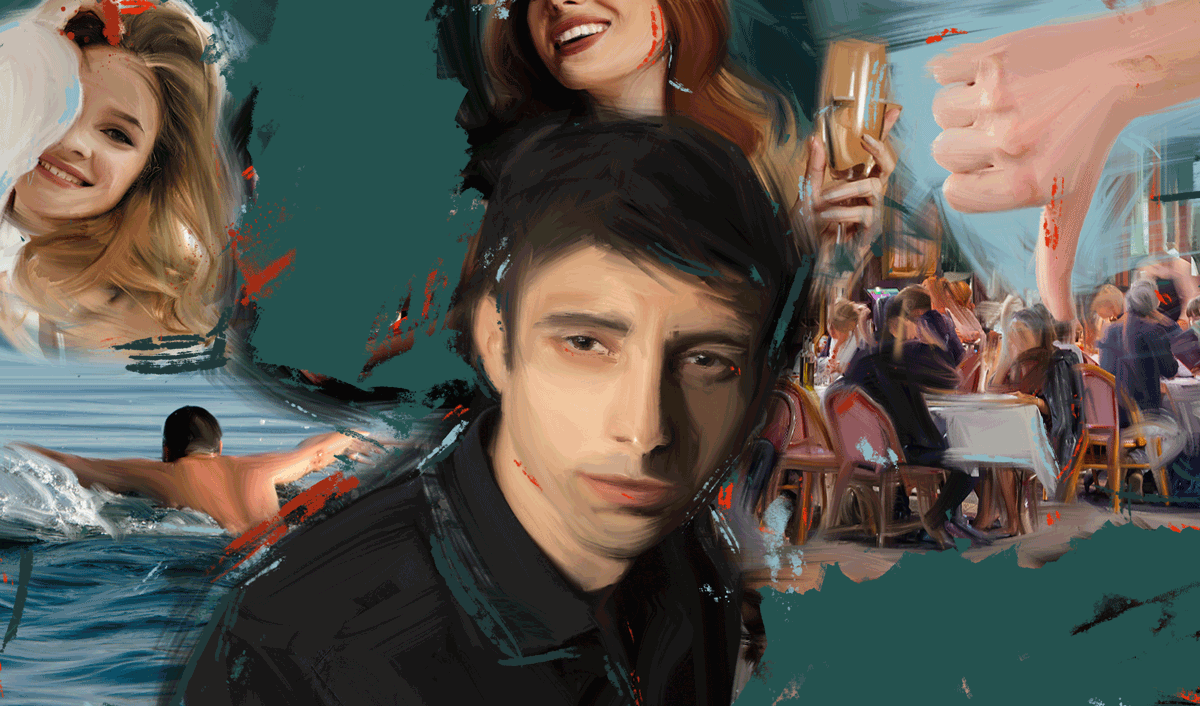
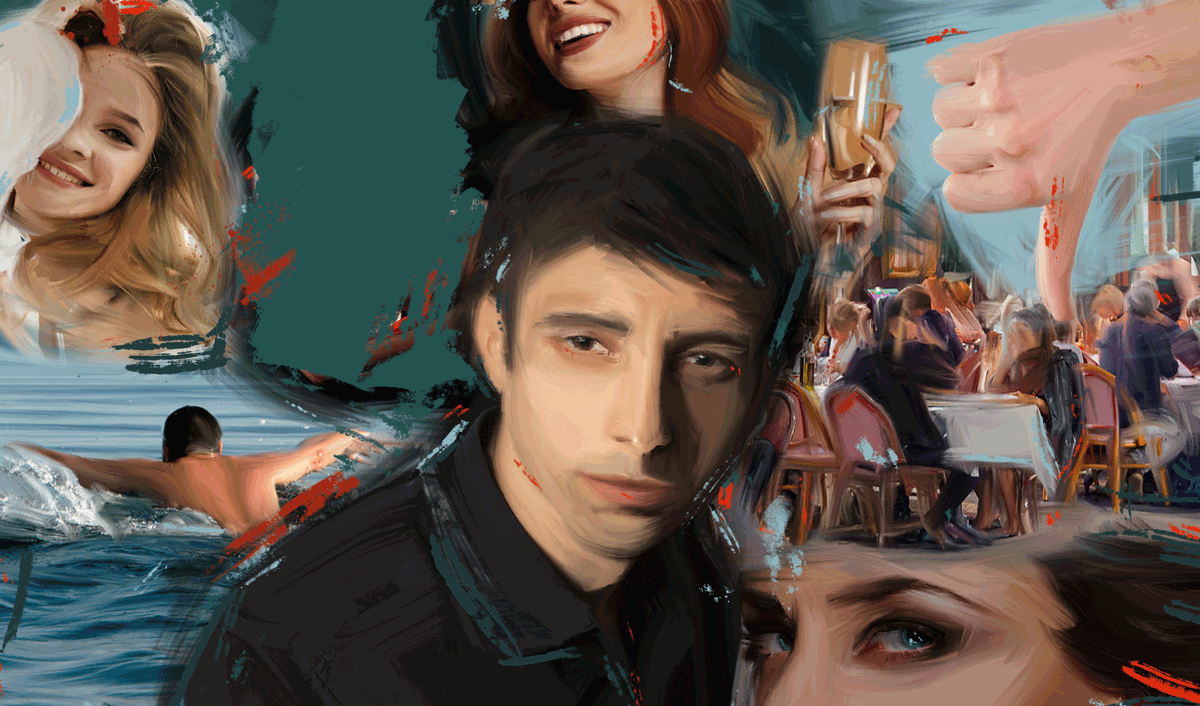

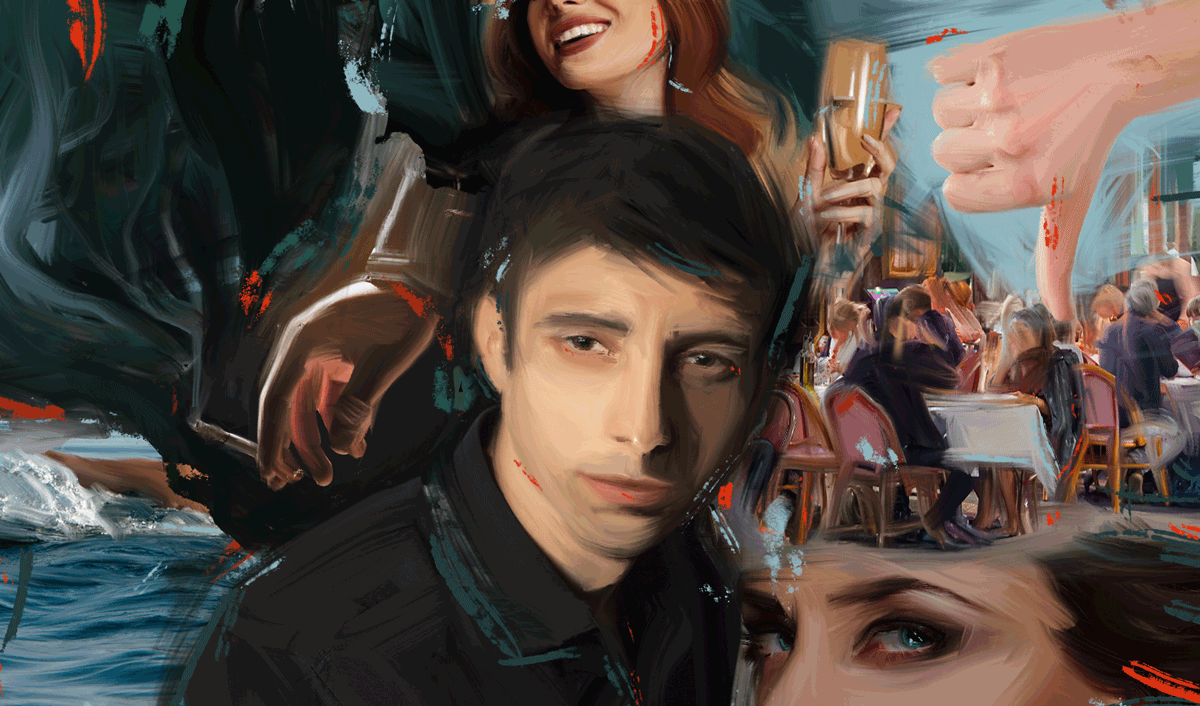
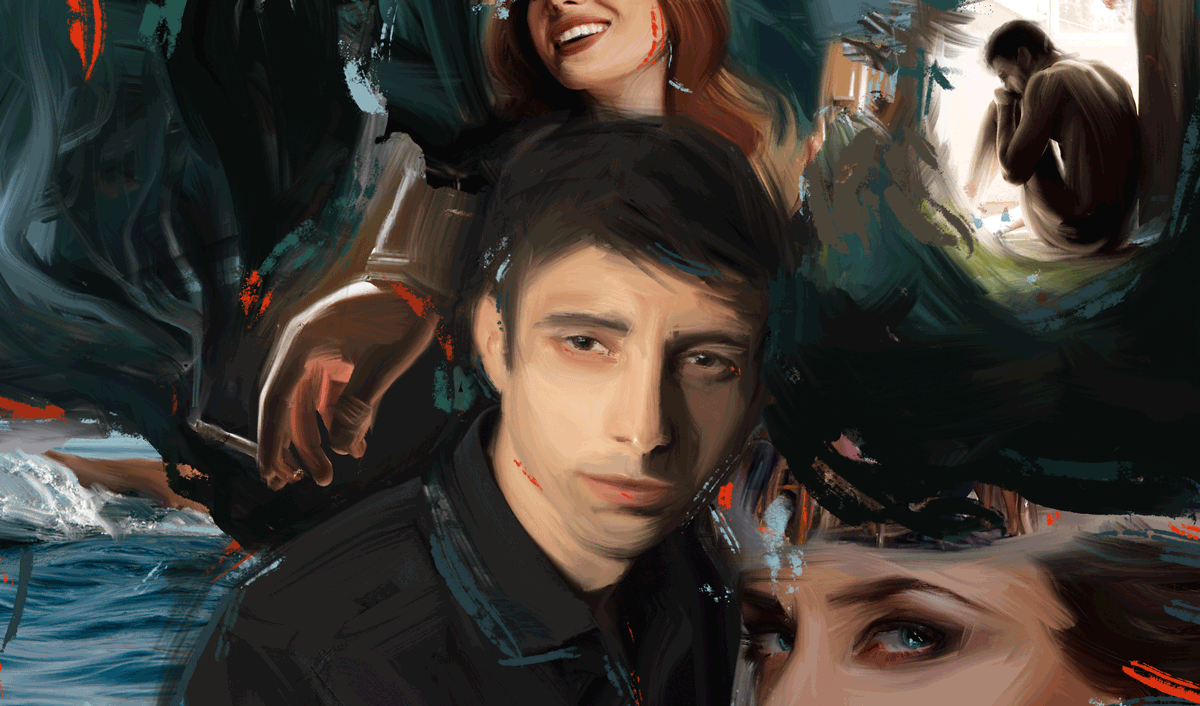
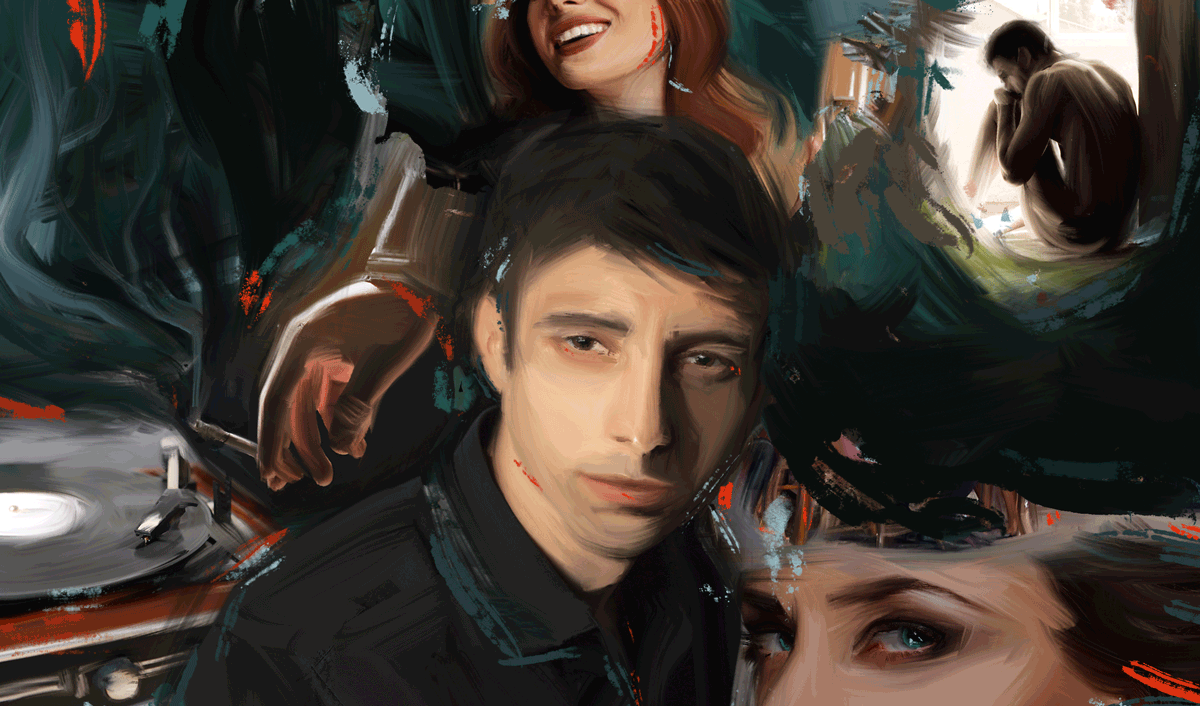
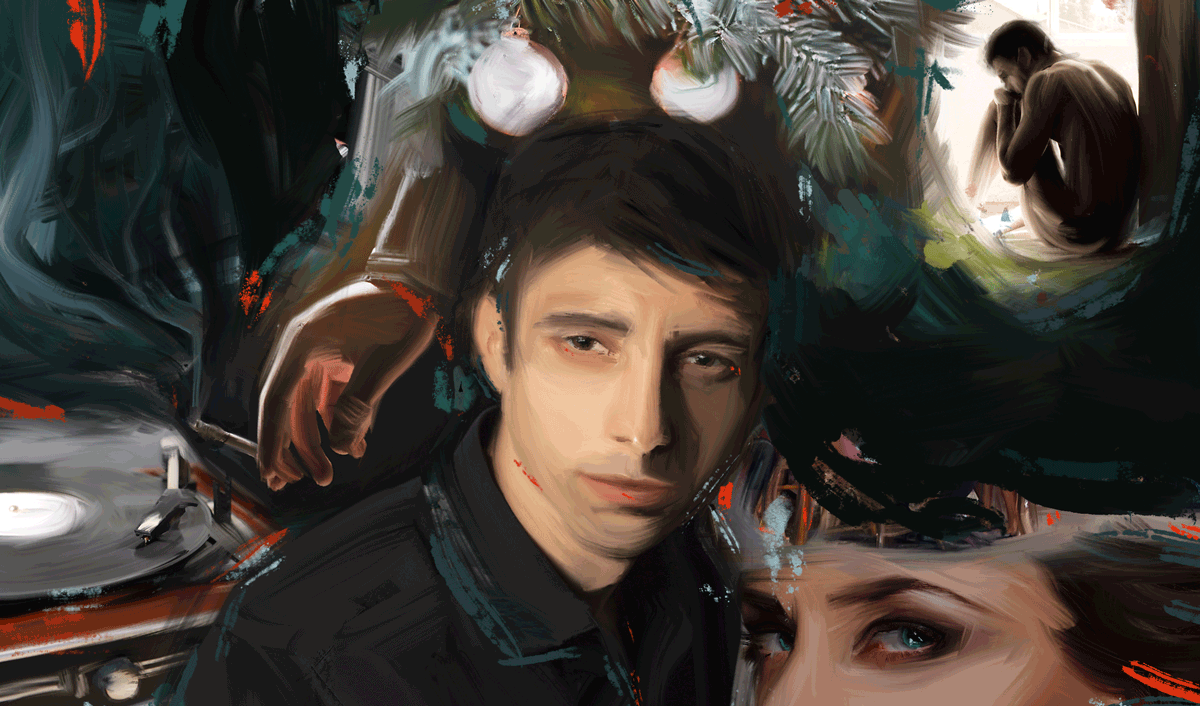
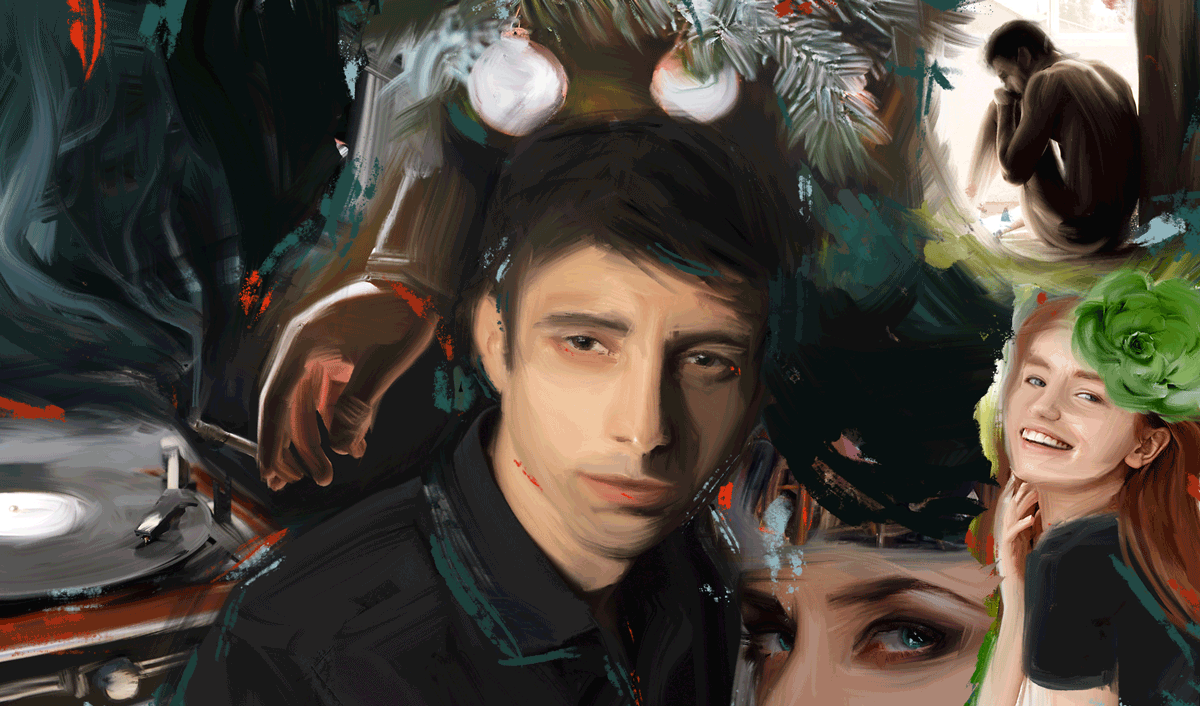
Man kann Aufatmen, zum Glück ist dieser „Sprung“ nicht ganz so schlimm ausgegangen, wie er es hätte können. Auch wenn unser Christian nur von einem Aufschub redet.
Nach 14 Teilen „Schnee“ bin ich auch froh, dass er zumindest dieses eine Mal glimpflich davon gekommen ist. Man hat ja durchaus Sympathie für Christian aufgebaut. Auch wenn es nur eine Erzählung ist.
Mich freut Ihr Verständnis für diesen ’schwierigen Typ‘.
Tatsächlich ein etwas untypisches Rinke-Ende(?). Oder Moment, fehlt nicht noch die Perspektive der Tochter?
Schlaftabletten. Auch da hat sich seit 68 einiges getan. Mittlerweile werden die Medikament-Packungen ja so klein gehalten, dass selbst eine ganze Packung nicht zum Suizid reichen würde. Man müsste also schon eine ganze Zeit lang horten, zumindest im Affekt funktioniert das zum Glück nicht mehr.
Das wusste ich gar nicht. Da hatte jemand eine recht schlaue Idee.
Das hat ja 68 auch nicht gereicht. Sonst wäre Christian nicht in der Psychiatrie gelandet, sondern auf dem Friedhof.
Die Idee, dass nur der Tod als Lösung möglich ist, wenn man der Aufgabe des Lebens nicht gewachsen ist, muss man ganz klar verneinen. Auch wenn es sich nur um eine Geschichte und nur um die Perspektive des Protagonisten handelt. Ich würde trotzdem widersprechen.
Leider gibt es nur genügend Fälle wo andere Möglichkeiten außer Reichweite scheinen. Da nützt die Feststellung alleine dann meistens nicht besonders viel.
Wichtig war mir, dass hier ein Mensch ohne körperliche Leiden oder materielle Sorgen, dem alle Türen offenstehen,
diese Türen zuschlägt. Warum? Das ist die Geschichte.
Greifbar wird dieses WARUM letztendlich natürlich nicht. Kann es wohl auch gar nicht. Aber diese inneren Monologe sind trotzdem sehr spannend zu lesen.
Übrigens interessant wie die verschiedenen Blaus und Grüns hier immer wieder eine Rolle spielen…
Farben spielen eine große Rolle in unserem Leben, auch bunt und grau. Nichts zu sehen, fände ich schlimmer als nichts zu hören. Nach meinem Schlaganfall habe ich zunächst nichts geschmeckt – vielleicht lag es an der Krankenhaus-Kost …
Solange ich noch meine fünf Sinne habe, nehme ich den Selbstmord mehr theoretisch.
Ein Freund, der kürzlich (zum Glück relativ mild) am Coronavirus erkrankt ist, sagte mir das Seltsamste und Verwirrenste an der Krankheit sei der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn.
Diesmal ist es noch gut gegangen. Und vielleicht geht es ja auch immer weiter gut und dieses schreckliche Gefühl der Machtlosigkeit verschwindet einfach genau wie es gekommen ist.
So ein richtiges Happy Ending ist das selbstverständlich nicht, aber mal schauen was die Tochter noch zu der Sache zu sagen hat.
…und ob vielleicht sogar noch ein zweiter Sprung bevorsteht. Wobei dann könnte sie ihre Geschichte ja gar nicht mehr erzählen.
Außer der Sprung geht ebenso glimpflich aus wie Christians.
Falls sie in der Ich-Person schriebe, könnte der Sprung nicht zum Tod führen.
wer denkt der tod führt in eine erträglichere wirklichkeit, dem ist wahrlich nicht zu helfen.
Man muss sogar helfen. Oft funktioniert es ja auch ganz gut, bei Christian ist es ja auch „noch gut gegangen“.
Der Selbstmörder will nur weg aus der unerträglichen Wirklichkeit und ist mit dem Ende des Seins einverstanden.
Wobei diese Wirklichkeit natürlich rein subjektiv ist
Faszinierende Gedankengänge. Gleichzeitig muss man notieren wie verquer Christian sich und die Welt sieht. Man bekommt ja fast den Eindruck als könnte nur ein einfacher urtümelnder Mensch in dieser Welt existieren, ein reflektierender hingegen unweigerlich zum Selbstmord streben.
Das ist sicher Disposition. Aber: Unter ganz bestimmten Umständer könne jeder zum Mörder werden, heißt es.
Zum Selbstmörder wohl auch.