Den Kuss in ein Gesicht gedrückt,
Den Stempel auf die Marke.
Irgendein Kuss und irgendein Gesicht,
Irgendein Hoffen, irgend Verzweifeln,
Gestempelt und gebranntmarkt.
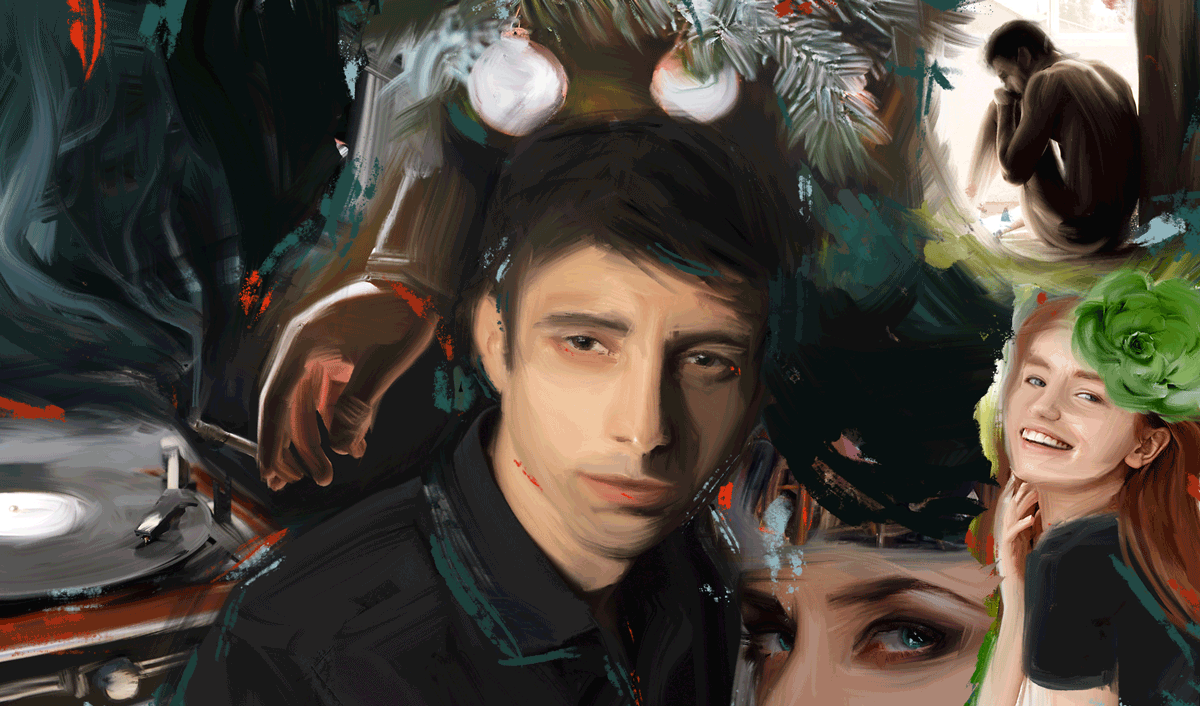
Als die Karnevalszeit vorüber war, merkte ich, wie mir die Dinge immer mehr aus der Hand glitten. Machtlos sah ich die Scherben meiner Unternehmungen und Pläne vor mir. Alles, woran ich mich freuen wollte, zerrann mir zwischen den Fingern. Wenn mich bei einem Gespräch etwas zum Widerspruch reizte und ich die Worte schon auf der Zunge hatte, dann trocknete plötzlich etwas in mir ein, und ich sagte nichts, sondern nickte nur gleichgültig. In Gesellschaft passierte es mir, dass ich lange Zeit dasaß, ohne zu registrieren, worüber gesprochen wurde. Ich versuchte, mich zusammenzunehmen, meine Teilnahmslosigkeit zu überwinden, aber es war vergeblich. Ich kam nicht dagegen an. Das Elend der Welt rührte mich nicht mehr als mein eigenes. Die Aufrufe zu Taten betrafen mich nicht. In Diskussionsrunden kam ich mir vor wie ein Blinder auf der Vernissage. So begann ich notgedrungen, wieder ein zurückgezogeneres Leben zu führen. Dabei hörte ich viel Musik. Na ja, Musik. Manchmal hörte ich mir sechs, sieben Mal denselben albernen Schlager an, und wenn die letzten Takte näher kamen, sagte ich: „Nein, es ist noch nicht zu Ende!“, und dann spielte ich die Platte wieder von vorn.
––Jazz war mir zu motorisch, vital, Bach zu rational, Beethoven zu siegessicher. Mozart und Schubert schienen meinen Zustand am ehesten auszudrücken: die Schwerelosigkeit, in die unvermittelt das Chaos hereinbricht. Die reine Welt der Form, in die verheerend die Materie, Manifestation allen Seins, zerstörerisch eindringt. Der unlösbare Zwiespalt zwischen Lebenswillen und Todessehnsucht. Die Heiterkeit im Bewusstsein der Vernichtung, läuternd, klärend, rettend. Und doch waren sie gestorben und hatten alles mit sich hinabgerissen, auch die Kluft zwischen Leben und Tod. Alles Gefälle war ausgeglichen, die Erhebungen waren eingeebnet, die Wellen geglättet. Nicht einmal Zerrissenheit und Verzweiflung durften bleiben. Der erlösende Friede war befohlen, die Belohnung aufgezwungen. Diese Unbarmherzigkeit konnte man nur mildern, indem man nicht auf sie wartete, sondern sie herausforderte.
––Immer wieder starrte ich auf die Bilder gotischer Maler in ihrer bedingungslosen Ehrfurcht und Unterwerfung und ihren entfesselten Beschreibungen von Strafgerichten und Todesqualen. Vielleicht waren wir aus der Hölle des Seins für eine kurze Gnadenfrist auf die Erde entlassen, um danach für ewig die Martern der Gewissheit zu erdulden. Zeitgenössische Schöpfungen beschäftigten mich kaum. Ich fühlte mich den Toten mehr verbunden als den Lebenden. Zu dieser Zeit begann ich, Gedichte zu formen, nichts Bedeutendes, aber etwas, das man aufschreiben konnte, durchlesen, fassen, etwas, das da war. Eins zum Beispiel lautete:
Oder ein anderes:
Wenn du ‚Glück‘ sagst, meinst du
getrocknete Tränen und dass du nie wieder weinen wirst.
Aber schon bald wirst du,
zermürbt vom alles umschlingenden Auswurf des Glücks,
in deinem Schmerz geborgen und vergessen sein.
Ich wusste nicht, ob ich mich in etwas hineinsteigerte oder nur meiner Veranlagung folgte.
––Wahrscheinlich kann man das gar nicht trennen. Es war ein Irrtum gewesen, wenn ich nach meinem Zusammenbruch geglaubt hatte, der Spuk sei nun vorüber. Er hatte gerade erst begonnen. Nur eine kurze Pause, ein Aufschub hatte stattgefunden, bevor mich derselbe Wunsch (?), derselbe Wahn (?) gefangen nahm. Was war es, das mich gepackt hielt und nicht losließ? Meine Bestimmung, mein Wesen? Der unauslöschliche Kern allen Seins, der erst herausgeschmolzen werden musste: Schlacke des Lebens?
––Ich glaubte nicht an solche Hirngespinste, und doch war ich bereit, für den Gegenbeweis mein Leben wegzuwerfen. Denn mehr schien es mir ohnehin nicht wert, wenn nichts davon hinüberzuretten war. Wie lange sollte ich noch darauf warten, etwas oder nichts zu sein? Manchmal graute mir vor mir selbst. Dann stürzte ich mich mit verzweifelter Sehnsucht ins Leben. Jeden Augenblick wollte ich mich zwingen: Genieß! Freu dich! Finde das Leben schön! Für ein paar Minuten mochte mir das fast gelingen, aber dann fürchtete ich schon den Moment herbei, in dem ich mir wieder bewusst sein würde: Es ist zu Ende. Und ich empfand mein Lachen zuvor fast als einen Verrat.
Es konnten mehrere Tage vergehen, ohne dass ich mir darüber Rechenschaft ablegte, und doch pochte unaufhörlich die Frage in mir: Wozu? Mal war sie kaum wahrnehmbar, mal war sie ein Dröhnen, das durch mich hindurch hallte: Wozu? Wozu?
––Früher oder später musste ich das Rätsel aus eigener Kraft lösen, und die Antwort lag jenseits aller Grenzen. Trotzdem war ich nicht unglücklich. Hätte mir jemand den Vorschlag gemacht, mein Leben gegen ein anderes, erdverbundeneres zu tauschen, hätte ich abgelehnt. Ich war weder niedergeschlagen noch tatenlos. Ich hatte ja eine Aufgabe: Endlich hatte ich etwas gefunden, was mich ganz ausfüllte, wovon ich völlig durchdrungen war, wofür es sich zu sterben und eine gewisse Zeit lang sogar zu leben lohnte. Und war es auch nichts Fruchtbares, Schöpferisches, Nützliches – das hatte mir nie gelegen –, so lernte ich doch dadurch das Glück kennen, ganz in einer Idee zu leben und in ihr aufzugehen.
––Die einzige Idee, die Wissenschaft, Fortschritt und technisierte Zivilisation zwar hatten verdrängen, aber nicht beseitigen können, hatte ich ergriffen wie einen Rettungsring. Das, was unausrottbar, unauslöschlich allem Leben aufgestempelt ist, was schon vor der Geburt feststeht – das, was bleibt, wenn nichts bleibt: der Tod! Manchmal versuchte ich, unvoreingenommen an mich heranzutreten. Dann fragte ich mich: „Was ist los mit mir? Bin ich krank? Physisch? Psychisch? Depressiv? Pervers?“
––Für jede Regung gibt es eine physiologische Erklärung. Vielleicht könnte ein Arzt mir helfen.
––Aber ich wollte mich nicht heilen lassen. Was in mir vorging, hatte ich als mein Leben erkannt, das ich auf mich nehmen, durchleuchten, durchforsten und zu einem Abschluss bringen wollte. Nie hatte ich mein Leben so bewusst geliebt wie in jenem kurzen Abschnitt, bevor ich es verlassen wollte. Nicht im Abenteuer, in der äußerlichen Erfahrung, sondern nur noch in der ruhigen Betrachtung und Vertiefung all dessen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt angesammelt hatte, sah ich den Sinn meiner letzten Wochen. Ich wollte Abschied nehmen, solange der Verlust noch einen Schmerz für mich bedeutete und nicht das überdrüssige Beiseiteschieben einer abgenutzten Sache. Ich selbst konnte den Zeitpunkt bestimmen, wenn schon nicht über das Leben, so doch über den Tod, vorausgesetzt, ich kam ihm zuvor …
Wenn nichts bleibt, bleibt immer noch die erlösende Selbstvernichtung, die erlösende Zerstörung, die sinnvoll ist, weil nur was geschaffen worden ist, zerstört werden kann. Unser Tod ist in uns. Er ist ein Teil von uns.
––Warum soll man sich mit dem Schmutz, der Unordnung und Blindheit dieses Lebens abfinden, wenn man dem die reine Welt des Todes entgegensetzen kann?
––Der Tod ist klar, rein, sauber, der einzig vollkommene Trost. Nur das Sterben ist schmutzig. Die Leiche ist ekelhaft in ihrer entstellten, faulenden Hilflosigkeit. Niemand soll mich sehen! Niemand darf mich finden! Niemand darf erfahren, wie es geschah!
––Ich will verschwinden, fort sein, ohne Spuren zu hinterlassen.
––Meine Gedanken, die frei gestreift waren, kannten nur noch ein Ziel – wie Lemminge, die unbeirrbar ihren Weg ins Meer antreten.
––Dennoch war ich nicht kopflos. Ich sah alles klar, wie von höherer Warte.
––Begrenztheit und Engstirnigkeit sind solide Grundlagen, mit denen man auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Nur Verständnis ist gefährlich: Es wächst, steigt und schwillt bis zum Überlaufen.
––In dieser Zeit hatte ich oft das Gefühl, mein Verstand würde sich davonschleichen wie ein ungebetener Gast, der schon zu lange geblieben war und sich nun seiner Pflichten besinnt, ein Vogel, der aufsteigt und ein verwaistes Nest wirrer Erinnerungen zurücklässt, während er selbst den Horizont berührt.
––Dennoch war diese Empfindung nicht furchteinflößend. Sie war vielmehr tröstlich wie die Gewissheit eines sanften Todes.

Titelillustration mit Material von Shutterstock: Nora_n_0_ra (Porträt Mann), Seprimor (Augen), Kitti Krotsurikan (Hand mit Zigarette), alpkhan photography (nackter Mann), Pixel-Shot (Plattenspieler), kate_k (Weihnachtsbaum), Cookie Studio (rothaarige Frau), woo jung hoon (grüne Papierblume), aodaodaodaod (Hand mit Notizheft)

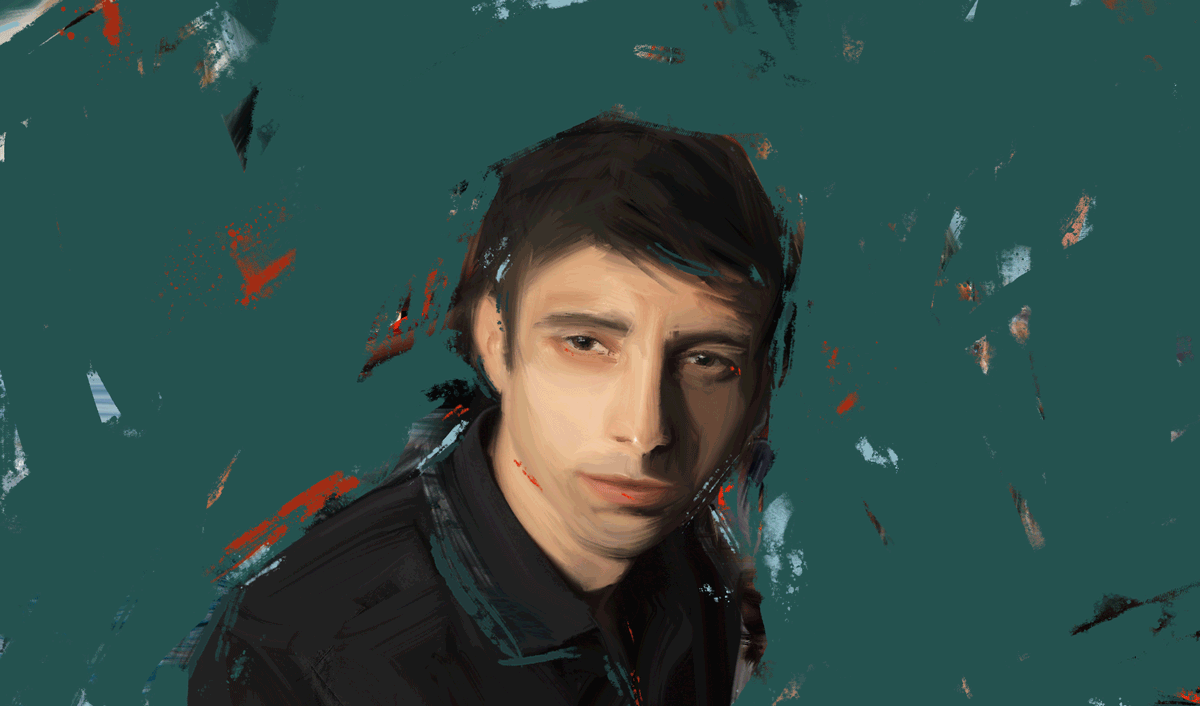

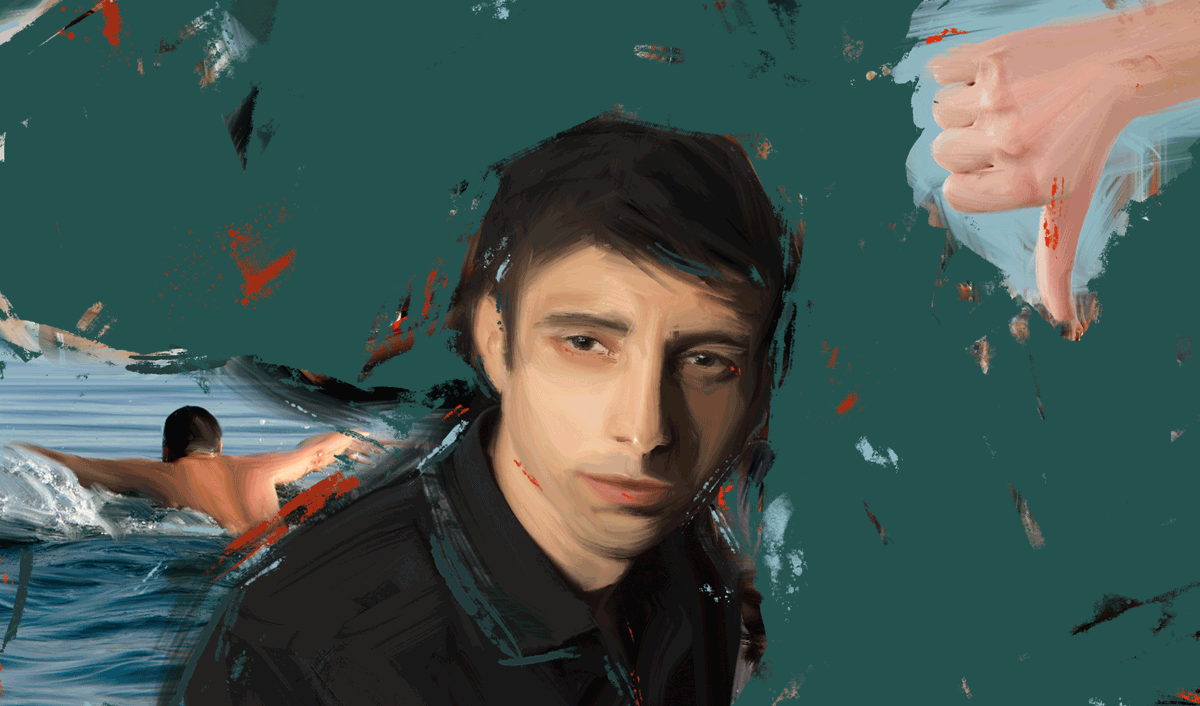
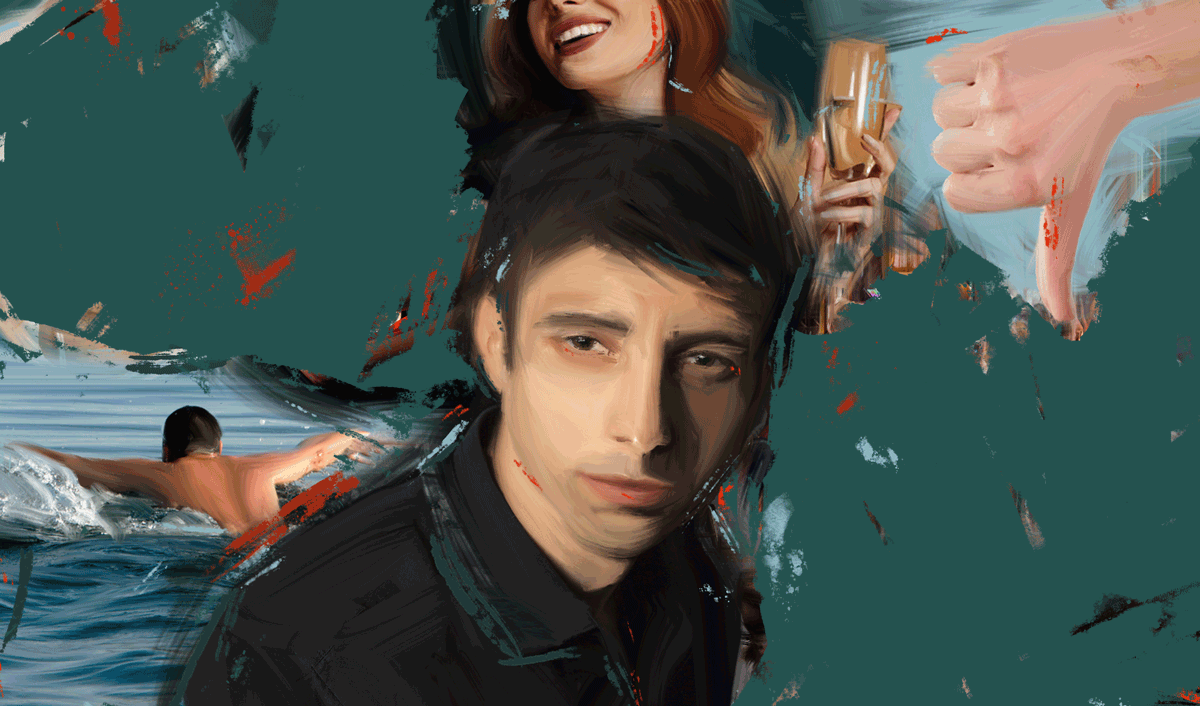
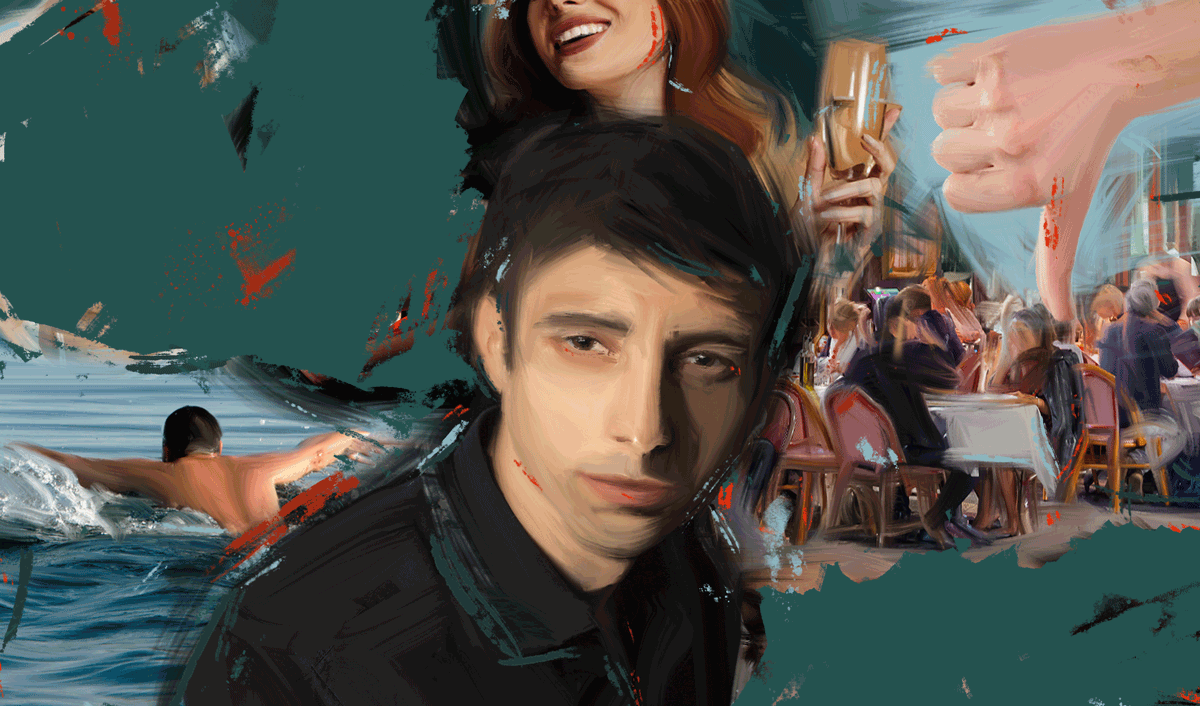
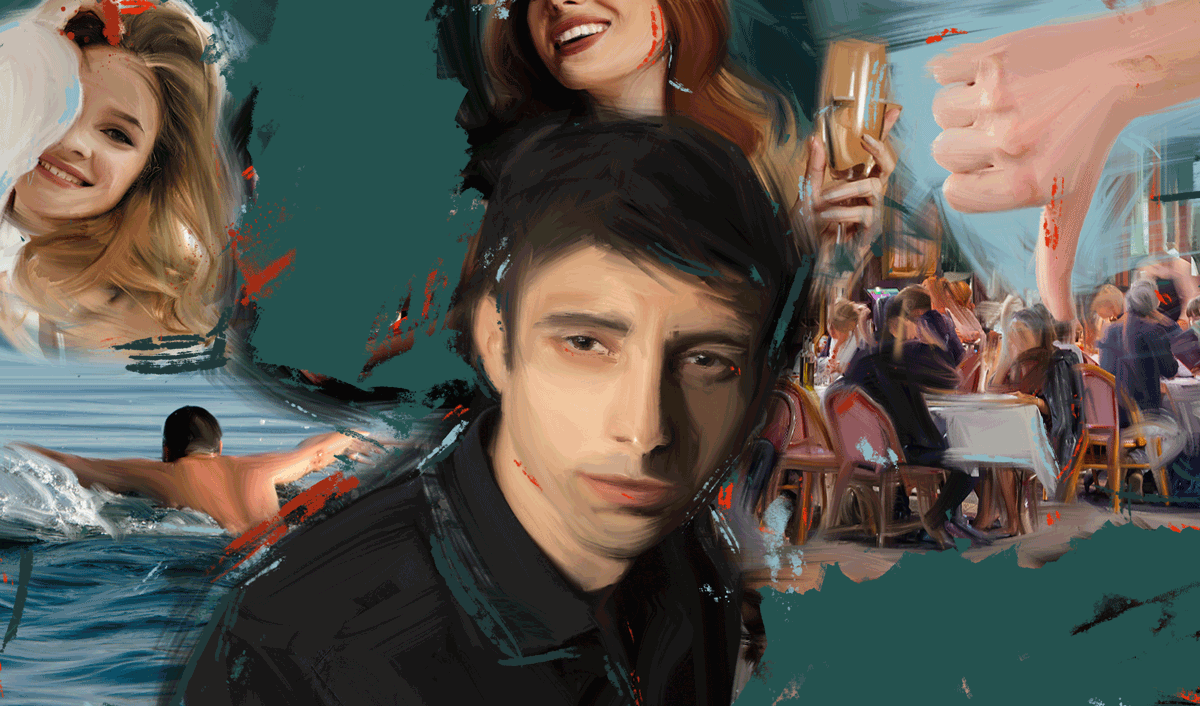
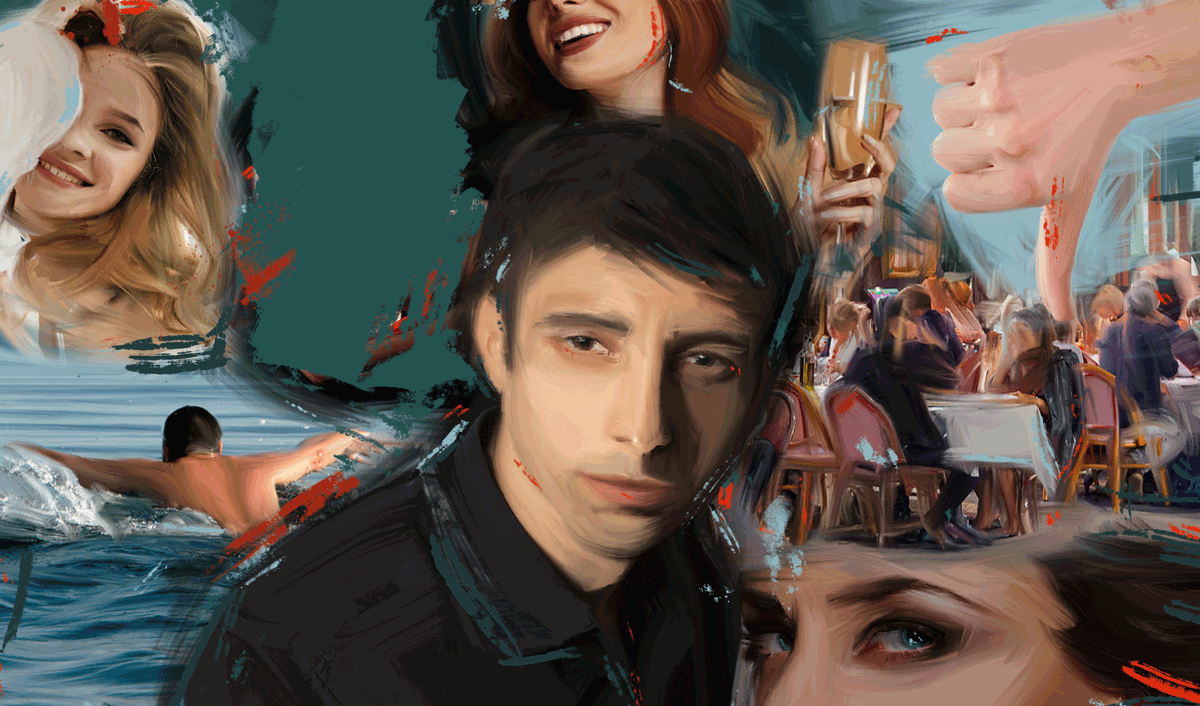

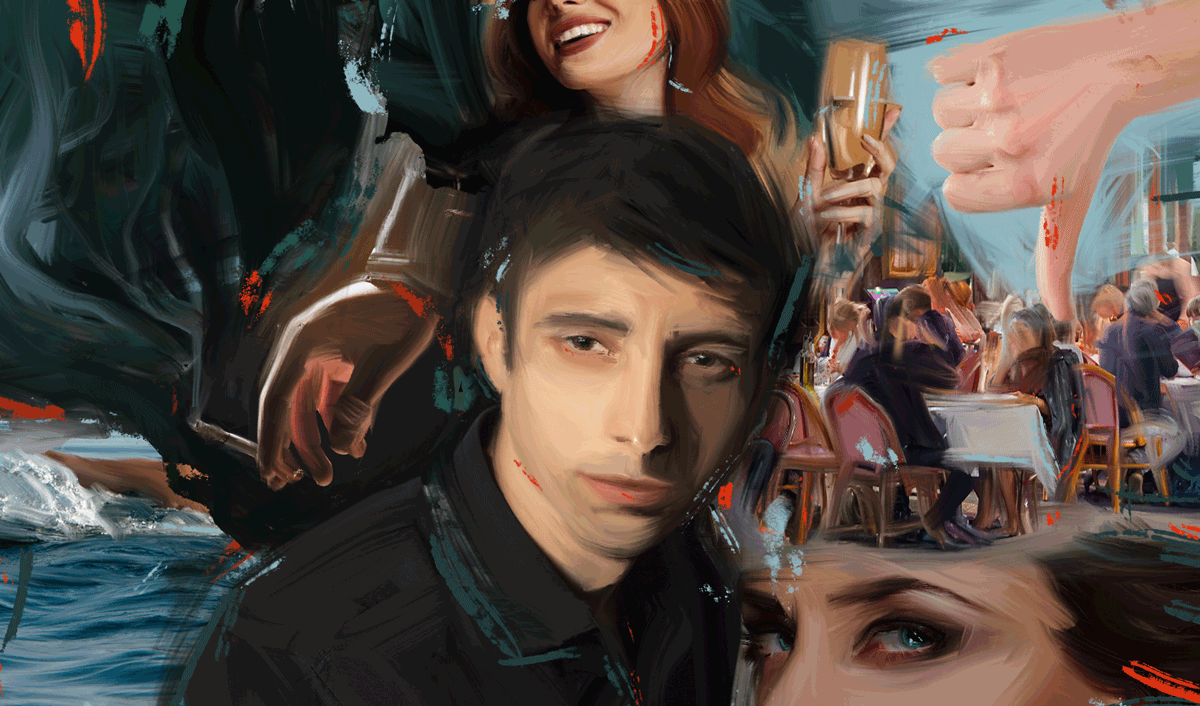
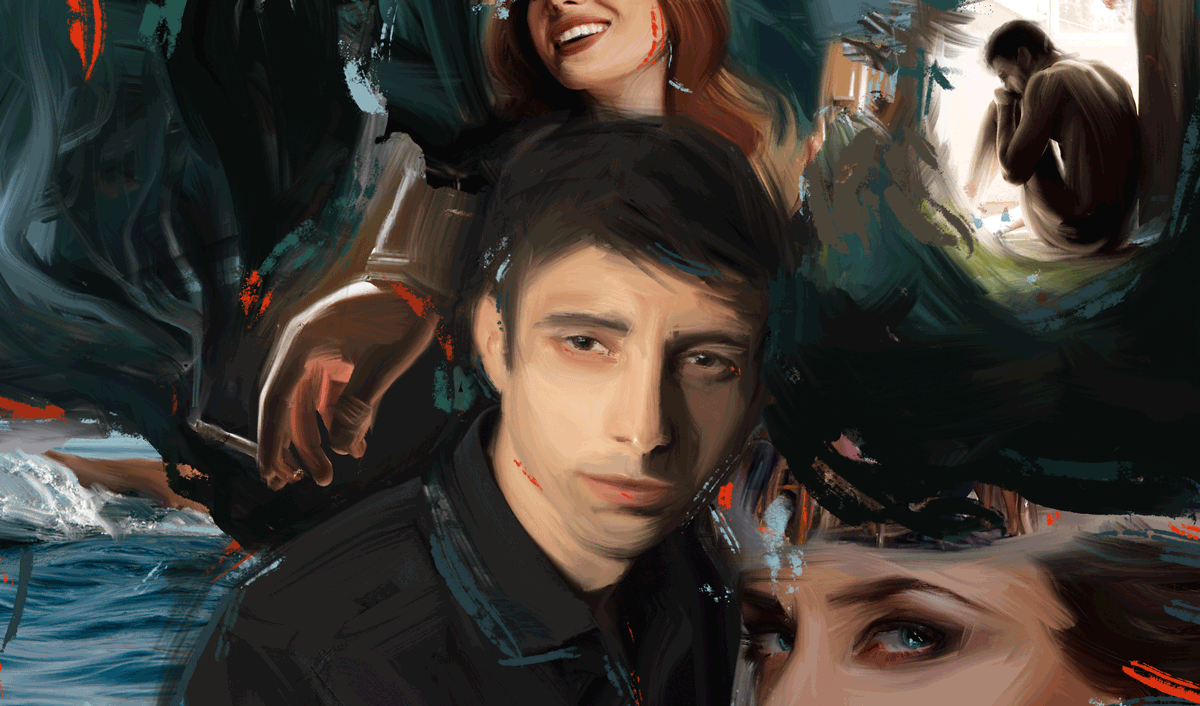
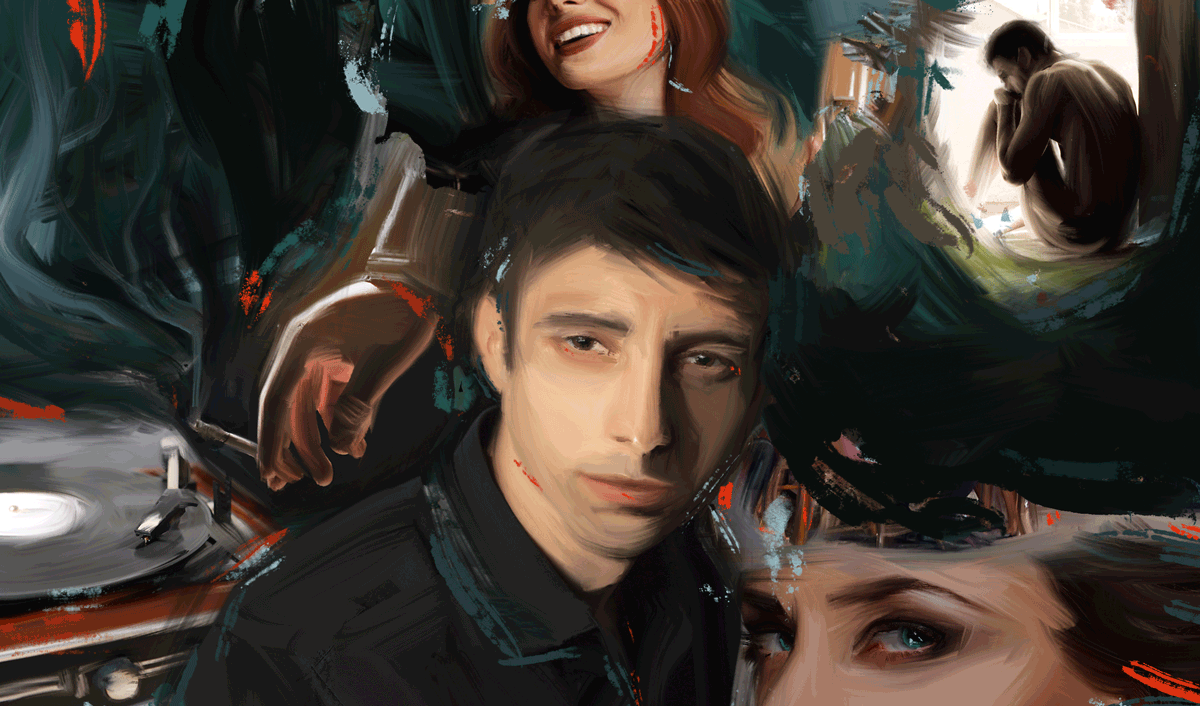
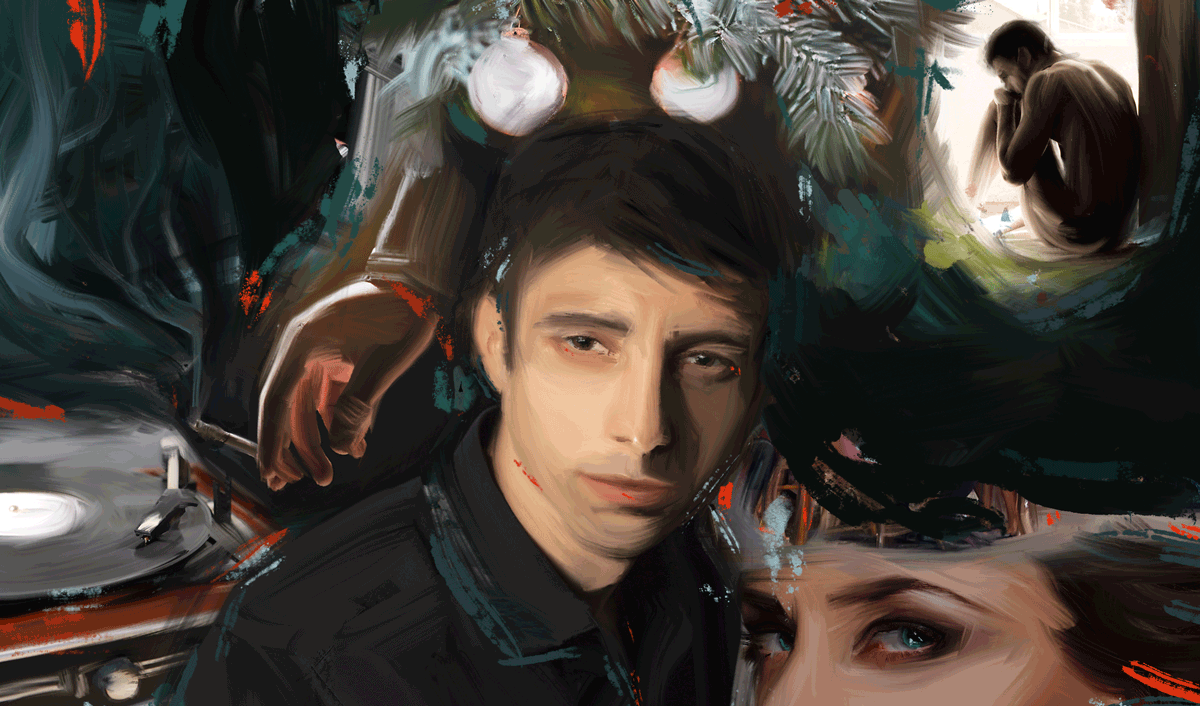
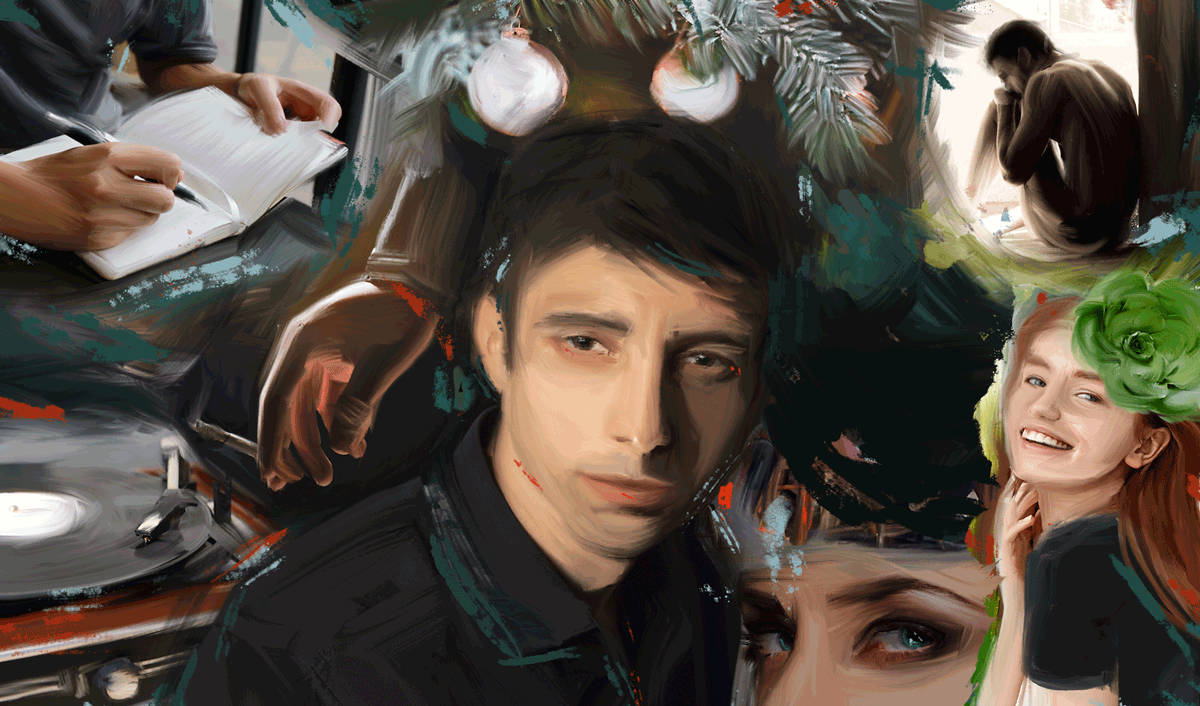
Die Frage „Wozu?“ ist eine Falle. Jedenfalls wenn man sie auf das gesamte Leben anwenden will. Da wird man keine zufriedenstellenden Antworten finden und wie unser Hauptdarsteller unglücklich verzweifeln.
Ich kenne auch die Antwort: Für diesen Augenblick hat es sich zu leben gelohnt!
Was für eine Antwort! Ja ich schließe mich da an, ein solcher Moment kann ausreichen.
Es gibt nicht nur eine Antwort, es gibt viele. Deshalb kann einem niemand anders die Frage beantworten. Das muss jeder für sich selbst tun.
Trotzdem gibt es unendlich viele Autoren und Prediger, die ihrer Kundschaft diese Frage präzise beantworten und gut daran verdienen.
Klar, viele Menschen suchen nach solchen Antworten und Geld wird eben aus allem gemacht. Zum Glück gibt es hier in Deutschland noch nicht diesen Trend der Televangelists wie in den USA. Da wird es noch einmal eine Runde gruseliger.
Der Erfolg von Leuten wie Kenneth Copeland oder Paula White kann einem wirklich Angst machen. Unverständlich, dass es trotz aller offensichtlichen Argumente sol viele Anhänger gibt.
Nicht nur das Leben ist ein Theater, die Religion ist es in dem Falle auch. Ernst nehmen kann man sowas nicht, unterhaltsam finde ich es auf alle Fälle.
Hmmm, kann man wohl in Schmerz geborgen sein? Vertieft und versunken bestimmt, aber wirklich geborgen?
Bei Ich-Erzählern kann sich der Autor immer auf subjektive Empfindung herausreden … Hollaender lässt Marlene Dietrich singen: wenn ich gar zu glücklich wär‘, hätt‘ ich Heimweh nach dem Traurigsein
In dem Fall geht es ja wahrscheinlich auch gar nicht so sehr ob das in der Realität funktioniert. Es ist doch vielmehr eine Empfindung. Die kann ich schon so nachvollziehen.
Fort sein ohne Spuren zu hinterlassen oder für immer in Erinnerung bleiben. Schon spannend wie unterschiedlich Menschen über das Leben und den Tod denken.
Es gibt so viele Wege das Leben zu leben, wie es Menschen gibt.
Verschworene Gemeinschaften würden das bestreiten und Abweichungen sogar ahnden: Kirchen, Diktaturen, Clans.
Die „wissen“ möglicherweise, dass es nur einen richtigen Weg gibt, aber dass es Ungläubige/Abtrünnige/Abweichler zur eigenen Ideologie gibt, das wissen die ebenfalls.
Man ahnt: Der Sprung rückt näher.
Morgen.
😰
Die Verzweiflung, die Christian spürt, kenne ich so nicht. Zum Glück. Aber Moment von Teilnahmslosigkeit, wie er sie oben beschriebt, habe ich auch schon erlebt. Da fühlt man sich einfach nicht dazugehörig und sucht dementsprechend nach einem (anderen) Sinn.
Bestimmt kennen die meisten von uns solche Gefühle und Gedanken. Das Leben ist ja nicht immer nur rosig, ganz im Gegenteil. Der Unterschied liegt wohl eher darin, wie wir mit solchen Dingen umgehen bzw. ob wir überhaupt einen Weg finden damit umzugehen.
Ich habe immer gehofft, dass, wenn man liest, anderen geht es ähnlich, dann tröstet das schon. Das war eine starke Motivation zu schreiben für mich.
Nicht alleine zu sein gibt immer Kraft. Selbst wenn dieses Nichtalleinsein nur durch Bilder, Texte, Lieder geschieht.
„Mancher wird erst mutig, wenn er keinen anderen Ausweg mehr sieht.“
William Faulkner sah das richtig, also einen Ausweg.
Der Tod ist in uns, ist ein Teil von uns, überhaupt keine Frage. Aber trotzdem ist mir dieses Nachdenken darüber fremd. Vielleicht ist das gut so, vielleicht kommt irgendwann einmal eine Art Erwachen oder eine Panik. Wer weiss es schon.
Genauso wenig wie man sich zwingen kann, nicht zu denken, was einen beschäftigt, so wenig sollte man sich zwingen, dauernd an etwas zu denken, was einen nicht beschäftigt. Dass der Appetit beim Essen kommt, habe ich nie geglaubt. Eher kommt das Erbrechen.
Das ist ja irgendwie auch das spannende am Menschsein, dass ein Thema für einen lebenswichtig sein kann, während der andere sich nicht im Traum damit auseinandersetzt. Vielfalt!
Bei manchen nur Einfalt. Sind die glücklicher?
Zumindest wird man meistens nur auf dem Weg glücklich, den man sich selbst aussucht. Garantien gibt es dafür wohl keine.