
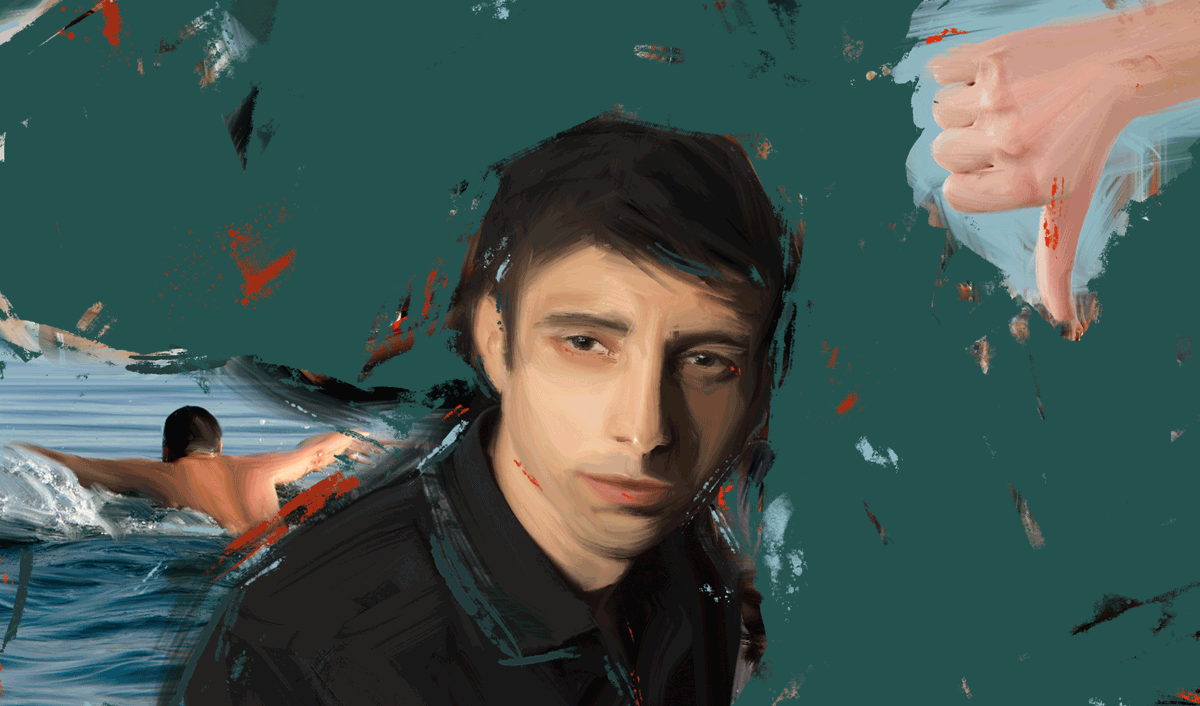
Sich treiben lassen oder gegen den Strom schwimmen. Vielleicht liegt das Ziel stromabwärts, und die ganze Mühe war umsonst.
––Warum soll uns die Möglichkeit, ein in finanzieller Hinsicht sorgloses Leben zu führen, die Verpflichtung auferlegen, besonders umsichtig, fürsorglich und auf unsere Würde bedacht zu sein? Sehnen sich nicht die meisten Menschen nach eben diesem Zustand, um dann nach Herzenslust verschwenden und sich ausleben zu können? Warum verlangen einige von sich die Weisheit eines Philosophen und die Selbstzucht eines Mönches?
––Genauso ungerecht, wie es ist, arm und dumm geboren zu werden, so ungerecht ist es auch, sich plötzlich in einer Welt von Pappmaché zu finden inmitten von Menschen, durch deren schulterklopfende, gut gelaunte Oberflächlichkeit man hineinstarrt in ein Inneres, das wie eine fade, marktschreierische Reklame für ‚Glück‘ anmutet.
––Trotz allem war ich damals von dem durchdrungen, was ich für die ‚kapitalistische Idee‘ hielt. Ich war zutiefst davon überzeugt, dass es der Sinn des entstandenen Lebens ist, sich mit allen Mitteln emporzukämpfen, all seine Fähigkeiten einzusetzen, um einen bevorzugten Platz zu ergattern.
Wer nach Wahrheit, Toleranz und Gerechtigkeit fragt, bringt ein größeres Handicap mit in diesen Kampf als jemand, der dumm oder schwach ist. Mit derartigen Begriffen darf nur der sein Maß an Überlegenheit und Ehrwürdigkeit unterstreichen, der es entweder gar nicht mehr nötig hat oder der sich an solch erhabenen Worten emporhangelt an die Spitze einer stoßkräftigen Gemeinde von Überzeugungstätern. Weltverbesserer hören erst dann auf, lächerlich zu sein, wenn sie die Macht besitzen. Vorher aber ist es gleichgültig, ob man die sanfte, die brutale, die intellektuelle, heroische oder religiöse Geste benutzt. Jeder hat selbst zu erkennen, was ihm am besten liegt.
––Nur wer ins gemachte Nest hineingeboren wird, ist etwas schlechter dran. Ihm drohen seine Gaben zu verkümmern, was später, wenn andere nach seinen Krumen picken, oft verhängnisvoll sein kann. So ist Marxismus für Millionärssöhne oft eine Art des Selbsterhaltungstriebs: Er schärft die Waffen. Gerade weil ich an dieser Auffassung auch dann noch festhielt, als ich mich entschlossen hatte, aus jenem Kampf auszuscheiden, kam ich zu dem Schluss, ich sei für das Leben in dieser Welt untauglich. Wäre das, was mich veranlasst hätte, den Kampf aufzugeben, Schwäche gewesen, so hätte ich auf ein anderes, gerechteres Konzept zurückgreifen können, einige sehr beliebte Modelle dieser Art sind ja schon vorhanden. Sie reden den Starken ein, sie seien eigentlich ganz schwach, was sich schon in naher Zukunft, vor oder nach dem Tode (je nachdem), erweisen werde; den Schwachen machen sie weis, dass sie in Wirklichkeit, notfalls eben alle gemeinsam, sehr stark wären, und sie verdrehen das Offensichtliche mithilfe von unbeweisbaren und unwiderlegbaren Gedankenkraxeleien so gründlich, dass man geneigt ist, alles zu glauben, was zeitlich und räumlich weit genug entfernt ist, um ungefährlich zu bleiben – oder einem hilft, sich das einzureden, was man gerade über sich hören will.
––Ich aber hielt meine Kampfesunlust nicht für Schwäche, was vielleicht falsch, immerhin jedoch tröstlich war. Mich lockte ganz einfach das Ziel nicht. Der Preis erschien mir so gering, dass ich kein Bedürfnis verspürte, ihn mir zu erkämpfen.
––Auch in solch einer Lage kann man auf eine andere Sicht der Dinge ausweichen, vielleicht sogar selbst ein Modell entwerfen, wobei am durchschlagendsten, weil für die Umwelt am verblüffendsten, die entgegengesetzte der bisherigen Richtung ist. Wird man auf diese Weise auch nur in den seltensten Fällen zum Diktator über mehr als fünfzig Menschen – manchmal bleibt es ganz in der Familie –, so kann doch die posthume Macht des Märtyrers eine sehr verlockende Aussicht darstellen.
––Viele, die weniger opfern wollen als das eigene Leben, begnügen sich sogar schon mit der Aussicht, später einmal als verkannte Genies ins Bewusstsein der Nachfahren einzugehen. Natürlich bietet das, was man zu Lebzeiten hat, die sicherste Gewähr dafür, dass man es auch nach Kräften auskosten kann – nur wenige Institutionen sind in der Lage, der Menschheit das auszureden –, trotzdem ist es ja besser, ein Glück erst nach dem Tode zu erwarten, als gar keine Zukunftspläne zu haben.
Es gibt sogar einige Menschen, die sich mit dem befriedigenden Gefühl begnügen, überhaupt an etwas zu glauben. Denn allein das Bewusstsein ihrer Ideologie macht sie der Masse der Nicht- oder Andersdenkenden überlegen. Mag sein, dass Weltanschauung tatsächlich Snobismus ist. Vielleicht ist wirklich alles, was über Essen, Trinken und Arbeiten hinausgeht, Luxus. Manche Menschen können ohne Luxus nicht leben, andere nicht mit ihm. Im Grunde ist es auch gleichgültig, ob man sich mit Nudeln, Gefühlen oder Ideen anheizt. Hauptsache, die Maschine läuft. Gerade das aber war bei mir die Schwierigkeit.
––Nicht nur, dass mir das Ziel meiner anerzogenen Einstellung unbefriedigend erschien, ich fand auch kein besseres. – Im Gegenteil, ich war fest davon überzeugt, dass alles auf die wohlvertraute Formel zu bringen sei, mit der ich nach wie vor rechnete. Ich verstand deshalb die Menschen, die sich drängten und stießen, sehr wohl, nur lehnte ich es ab, mich an diesem Gedränge zu beteiligen.
––Es passte also alles, was um mich her geschah, in mein Weltbild – außer mir selbst. Der Gedanke, mich davonzustehlen, lag deshalb recht nahe. Ich war ohnehin überflüssig.
Doch ich wollte diesen Gedanken so lange wie möglich von meinem Bewusstsein fernhalten. Ich wollte mich bemühen, meine Neugier dem Leben gegenüber neu zu entfachen. Aber das war unmöglich angesichts des einschläfernden Meeres, umgeben von der Einsamkeit zufriedener Freunde, in die trägen Abwechslungen eines Sommers gezwängt, dessen Tage über den Laufsteg ziehen wie die Teilnehmerinnen einer Schönheitskonkurrenz: langsam, wohlproportioniert, leer und erfüllt von dem Zwang auf Hoffnung. Schon früher hatte ich den Durchschnitt als ‚die Häufung der gebräuchlichsten Abartigkeiten‘ bezeichnet.
Solche Aussprüche klingen originell und geben eine gewisse Sicherheit. Was ich in einem Bonmot ausdrücken kann, quält mich nicht mehr. Ich denke, das liegt an der ‚Kraft des Formalen‘. – Klingt hochgestochen. Aber es schafft Abstand. Doch wenn ich mit solchen Aussprüchen meinen Unwillen – oder ehrlicher: mein Unvermögen – kennzeichnete, mich in eine schützende, mittelmäßige Gesellschaft einzufügen, so fühlte ich mich doch andererseits geborgen in meiner eigenen Gemeinschaft aus Privilegierten – und Dünkel ist eine sehr feste Bindung.
––Nirgendwo wird es schärfer geahndet, aus der Reihe zu tanzen, und nirgendwo leiden die Betroffenen stärker unter der Ächtung als unter denen, die sich als Elite empfinden. Ungetroffene Vereinbarungen sind absolut verbindlich. Sicher kann man sein Besonderssein tragen wie ein Kleidungsstück: elegant-elegisch. Wenn es nichts anderes ist als ein Kleidungsstück, ohne das man nackt stünde. Anderssein, das sich zu Cliquen schart, ist meist nur eine Art Konfektion für Betuchte. Aber was geschieht, wenn man das als Haut fühlt – Besonderheit, nicht aufwertend, sondern trennend? Was geschieht, wenn belanglose Worte zu treffen beginnen, weil sie den bloßstellen, der sie ausgesprochen hat? Was geschieht, wenn man fremd ist, weil man eine neue Sprache spricht und die alte verlernt hat, wenn Verständigung unmöglich und Verständnislosigkeit Zustand wird? Wenn nichts bleibt als das erlösende Meer, das in den Himmel wächst? – Man flieht! Man nimmt alle Kraft, die man hat, zusammen. Man wählt eine alltägliche Umgebung mit alltäglichen Menschen und sucht den Puls der Zeit da, wo er am mechanischsten schlägt. Eine regelmäßige Beschäftigung mit Frühaufstehen, Kantine und Feierabend, ein Unterschlupf.
––Vielleicht stellt man sich, wie ich es tat, für einen Monat ans Fließband. – Ein lächerlicher, wenig lukrativer Einfall. Statt für das Studium zu lernen, nachzuholen, vorzubereiten – ein Gespräch mit ihnen versuchen, sich scheu an ihren Tisch setzen, mittags, manchmal in ihren Kneipen ihr Lachen auffangen, erleichtert, hoffnungsvoll, und am Ende dieses Monats ein paar Scheine zählen, die man bekommt, weil man etwas geleistet hat, sich eingeordnet hat, Glied einer Kette geworden ist, die Produktion heißt, weil man glaubte, man kann werden wie das, was man tut. Belohnung für einen Irrtum.
Es ist etwas Selbstverständliches, dass ein Student während seiner Ferien arbeitet.
––Ich aber brauchte weder Geld, noch hatte ich mir eine Beschäftigung gewählt, die mich auf meinen zukünftigen Beruf vorbereiten konnte. Ich hatte mich betäuben wollen durch erfüllbare Pflichten, durch Einförmigkeit und eine Unzahl vorgeplanter Handlungen, die gedankenlos macht. Doch wozu das alles? Ich brauchte weder den Lohn noch die Ausbildung. Ich durchschaute mich schnell, und die anderen taten es auch. Es wäre eine Aufgabe gewesen, sie für mich zu gewinnen, aber ich brachte es nicht fertig. Ich fühlte mich allen unterlegen und war froh, als der August um war.
––Natürlich hätte ich meine eigene Wohnung in der Stadt aufgeben, in ein einfaches Zimmer ziehen und neben dem Studium Geld verdienen können; mich selbstständig machen. Aber ich hatte wenigstens eine Erfahrung gewonnen: Man soll sich keinen Prüfungen stellen, die einem das Schicksal nicht auferlegt. Ein Examen ohne Prüfer ist nicht zu bestehen, weil niemand es bewertet, auch man selbst nicht. Ich lebte also weiterhin in meiner schönen Wohnung, aß gut und fuhr mein Auto, und ich beneidete die, die weniger schön wohnten, schlechter aßen und Straßenbahn fuhren. – Ja, wer zu wenig Arbeit hat, kommt auf dumme Gedanken!
––Doch was macht der, der nicht arbeiten kann, weil er den Sinn der Arbeit nicht einsieht, dem das viel zu lästig ist, der sich lieber umbringen würde? ‚Sich umbringen‘ – da ist es wieder!
––Hastig spülte ich einen Schluck Bier herunter. Ich saß an einen winzigen Tisch gezwängt in einem Straßencafé und versuchte, die flutende Bewegung der vorbeiziehenden Passanten zu genießen. Ich konnte jeden einzeln betrachten, dann zog ein Mosaik aus Einsamkeit und Ernst, Lachen und Verbundenheit an mir vorbei, Hasten und Zögern, Schreien und Schweigen liefen nebeneinander her. Ich konnte es aber auch als ein Ganzes sehen, dann verschmolzen alle Eindrücke zu einer Gesamtfarbe, die Grundton zu dem ist, was man ‚die Atmosphäre einer Stadt‘ nennt.

Titelillustration mit Material von Shutterstock: Nora_n_0_ra (Porträt Mann), Kateryna Tsygankova (Schwimmer), Davizro Photography (Daumen runter), Dean Drobot (Frau mit Champagnerglas)

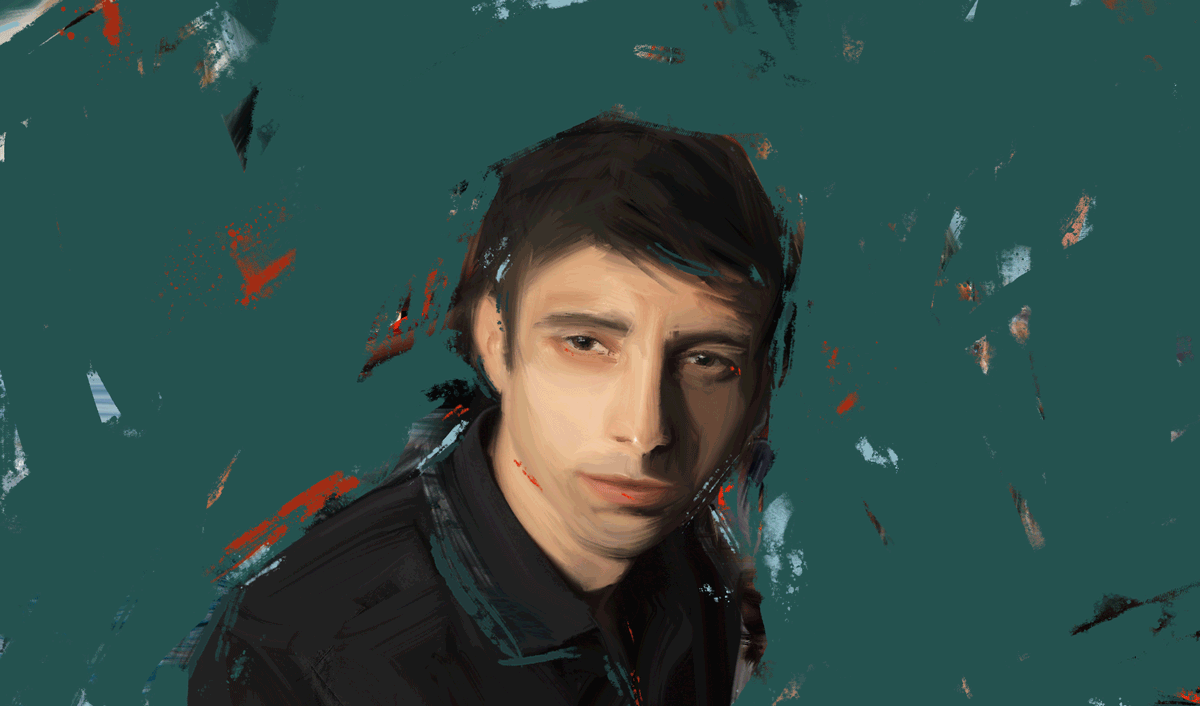

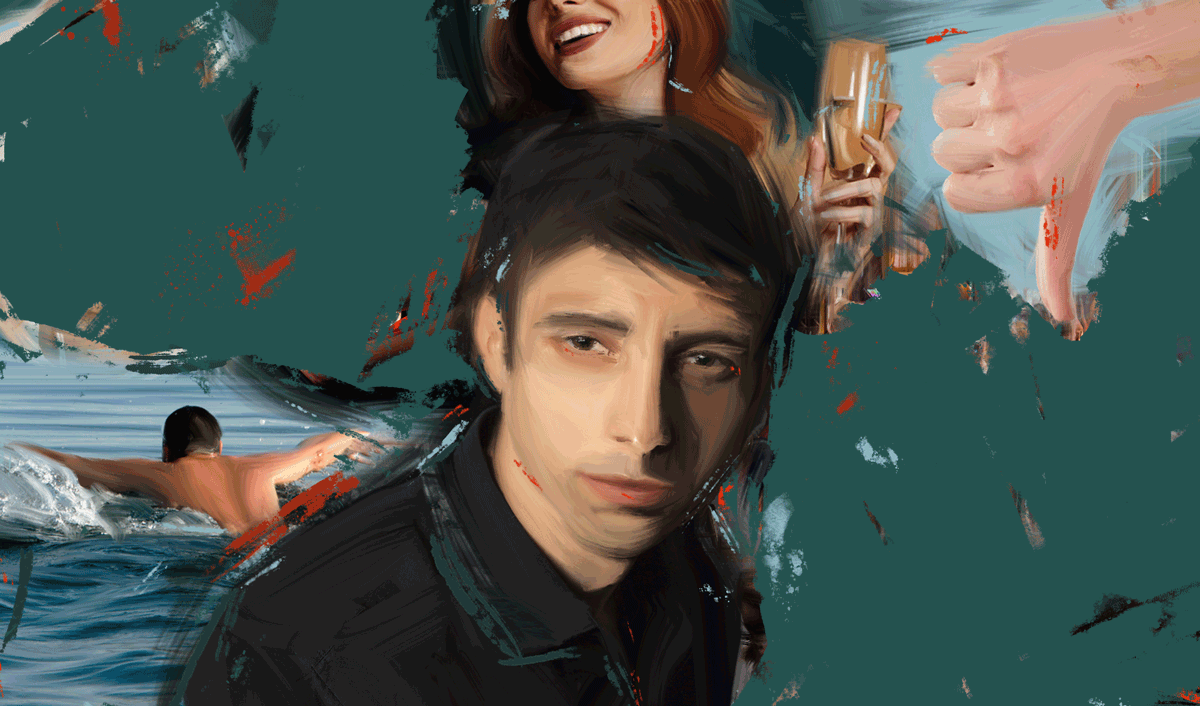
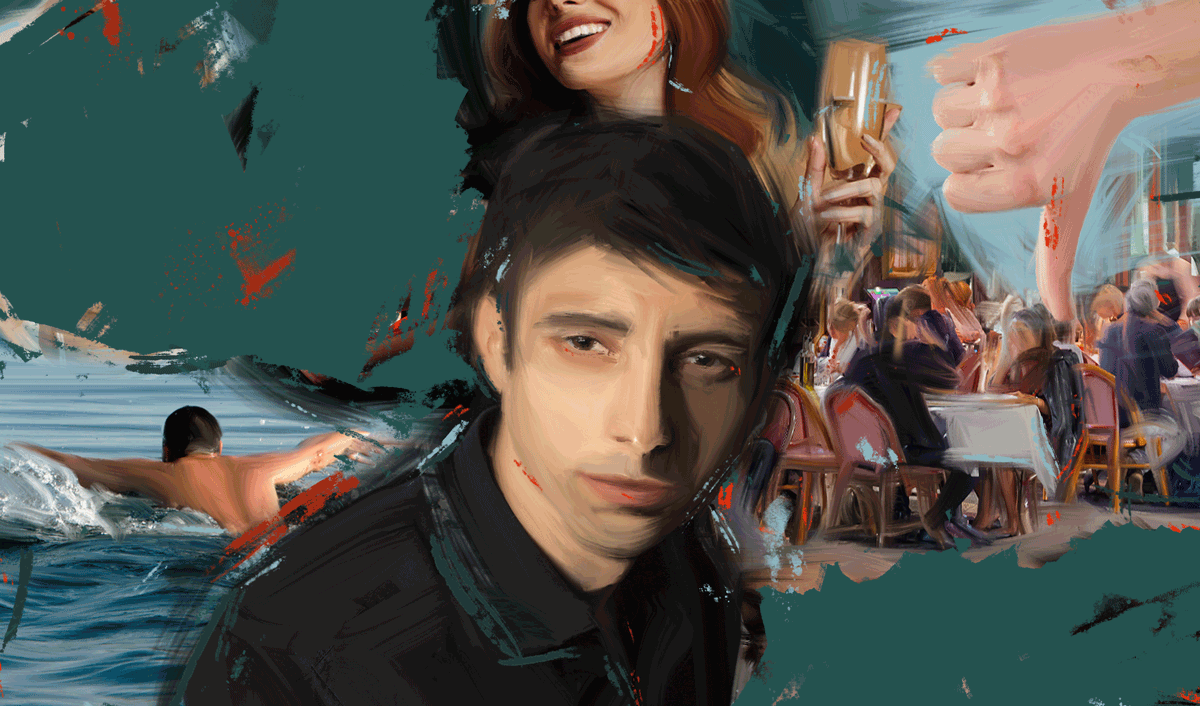
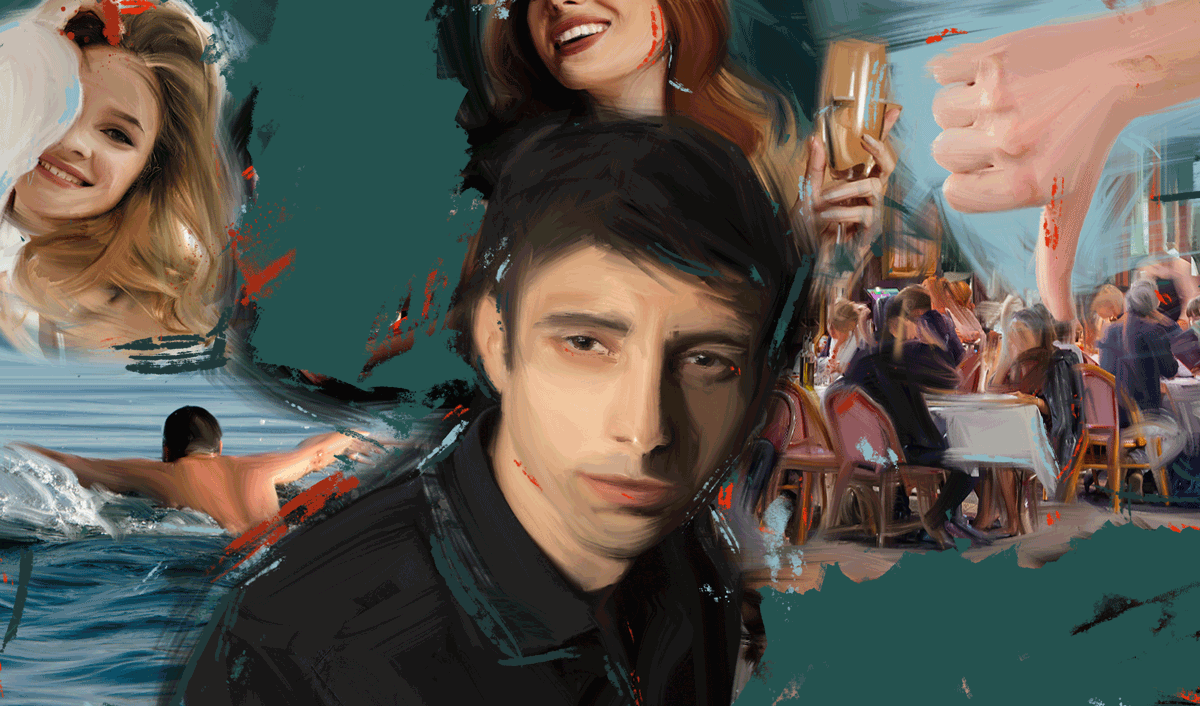
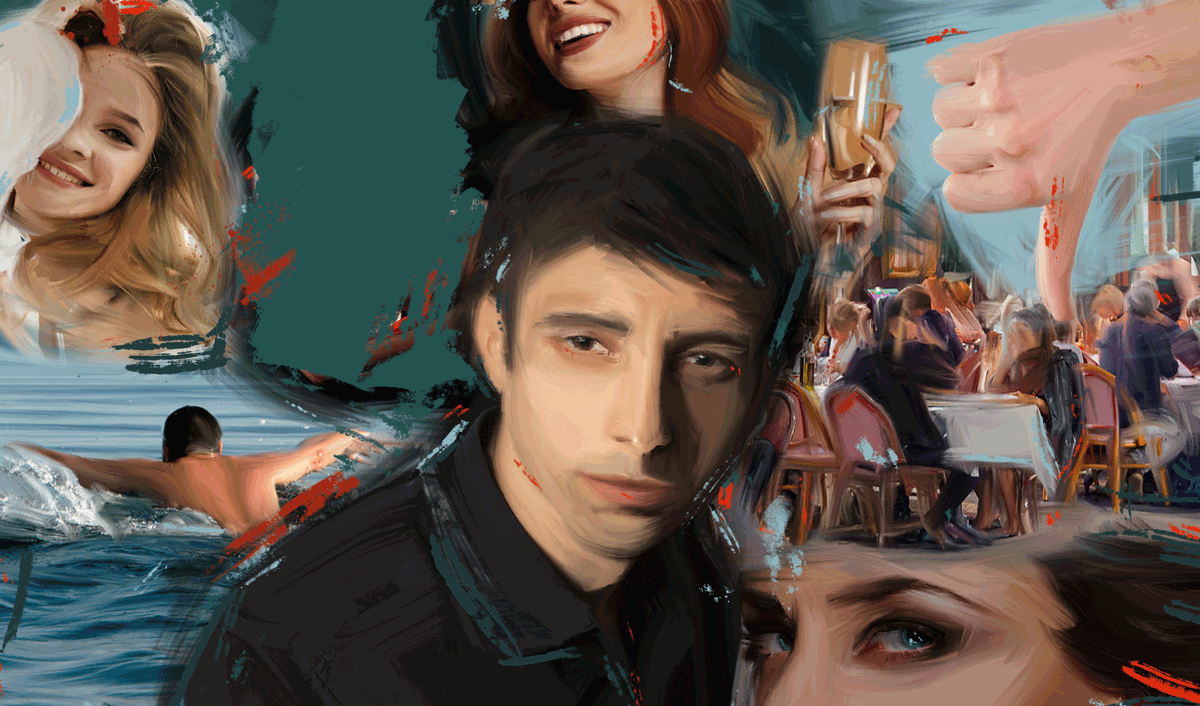

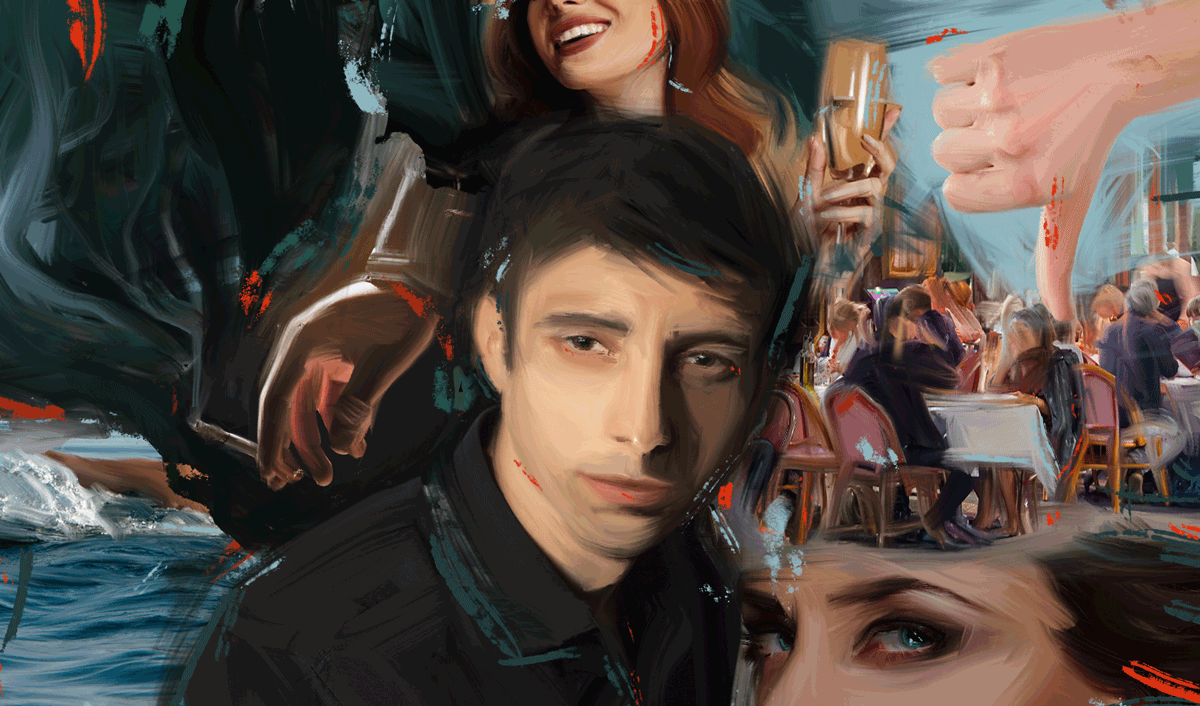
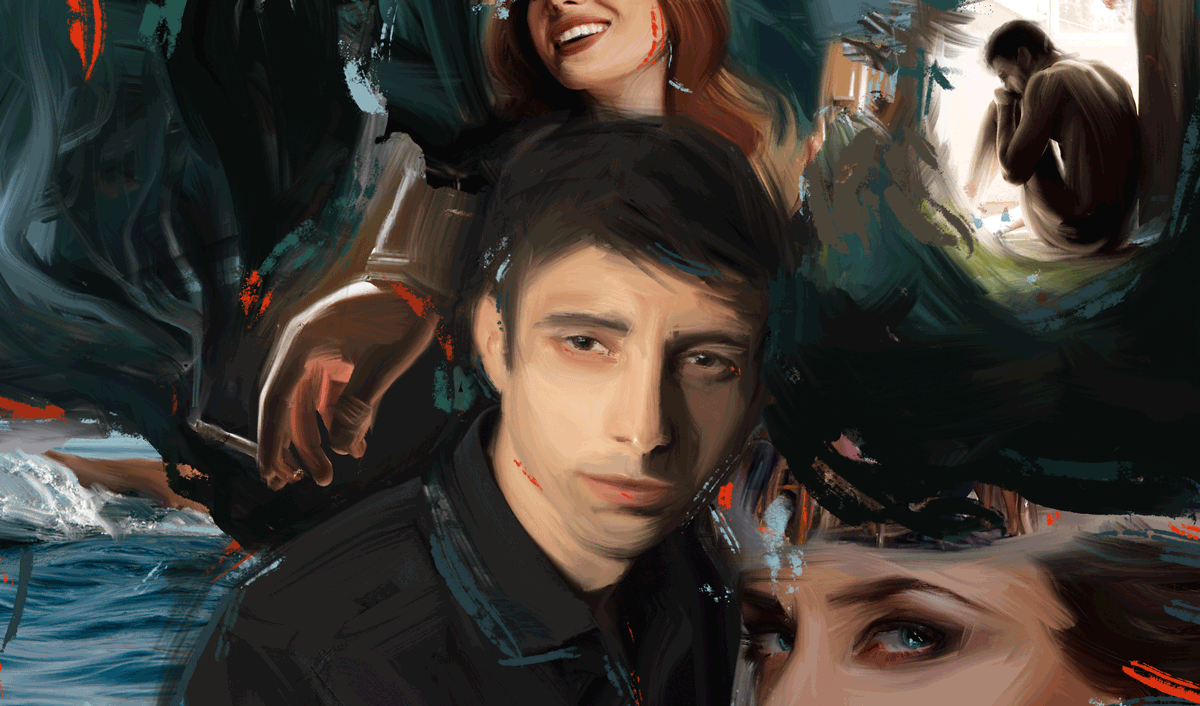
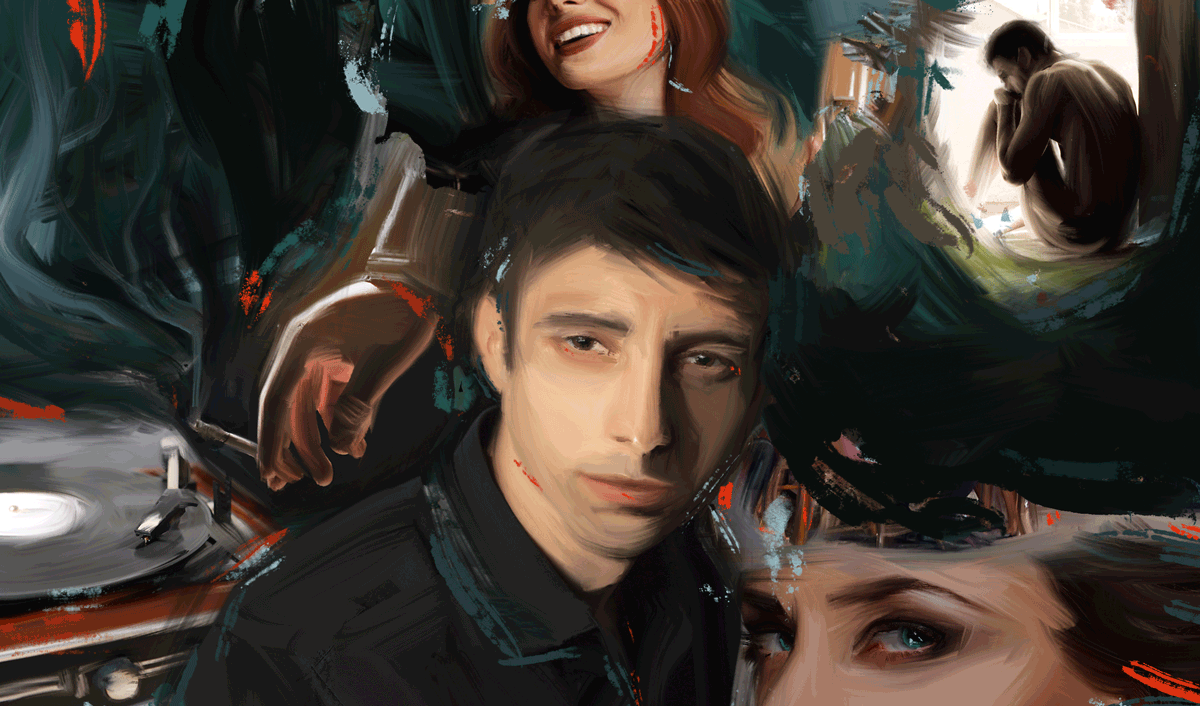
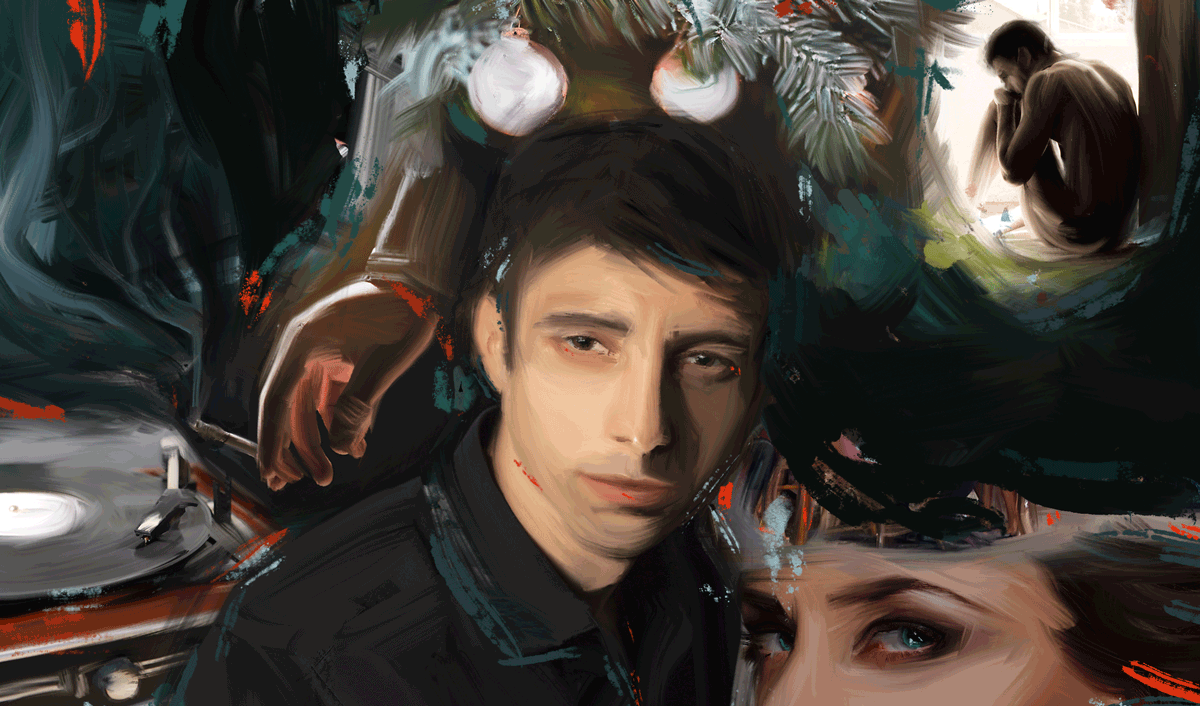
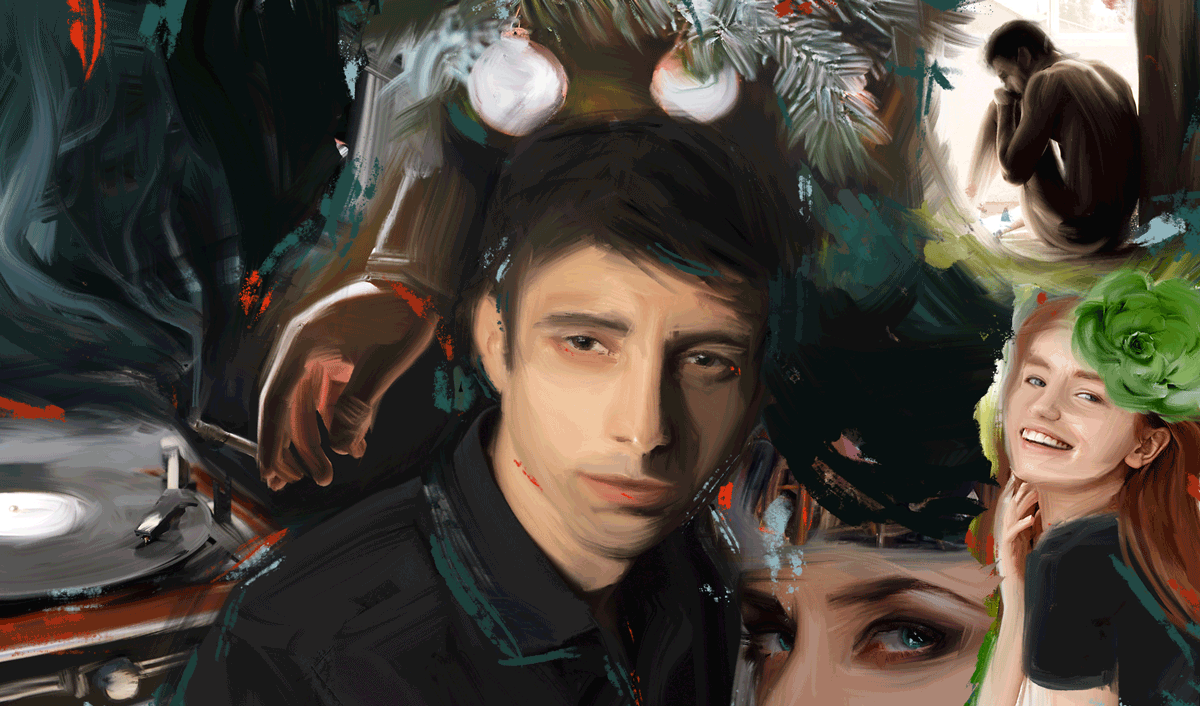
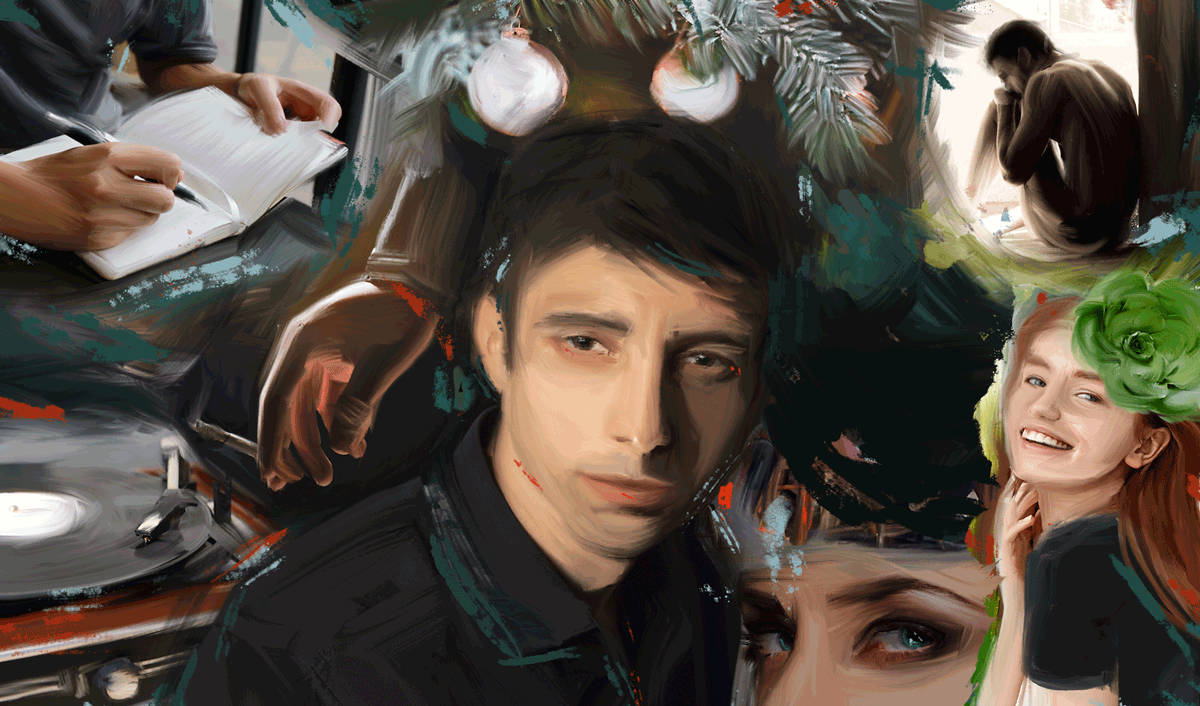
Asketisch wie ein Mönch oder verschwenderisch wie der reichste Jetsetter. Beide Extreme scheinen mir zu verkrampft zu sein.
Ja, sicher. Aber Jugend neigt zu Extremen: schwarz – weiß, gut – böse, richtig – falsch. Da liegt mitunter wenig zwischen Anarchist und Ausbeuter.
Genau, Gelassenheit kommt ja oft erst mit dem Alter. Zumindest wenn man Glück hat. Bei mir ist das tatsächlich ein wenig so.
Das ist ja auch das tolle an der Jugend. Hinter jeder Idee steckt eine Unmenge an Begeisterung und Tatendrang. Da schießt man schon mal über das Ziel hinaus, aber das gehört nunmal dazu.
Wie weit man hinausschießt und wen man mit seiner Kugel im Kopf, im Bein oder im Herzen trifft, das dürfen die Angegriffenen bewerten und notfalls bekämpfen. Das gehört auch dazu.
Passend zur Täter-Geschichte…
Besser Glück nach dem Tod als gar keine Zukunftspläne, tja nur was wenn das Glück dann eben nicht mehr eintritt? Leben vergeudet oder alles egal?
Sarkasmus ist dem Ich-Erzähler offenbar nicht fremd.
Das wird er vom Rinke haben 😉
Geht so etwas denn überhaupt, gar keine eigene Weltanschauung zu haben?
Das wäre fast eine philosophische Überlegung. Kein Weltbild wäre dann vielleicht auch schon wieder eine Art Weltbild? Wer weiss es schon…
Ein Weltbild gedankenlos zu übernehmen oder gar keins zu haben, unterscheidet sich natürlich dadurch, dass nichts zu fragen gemütlicher ist, als keine Antworten zu finden.
Ergo: wer weniger denkt ist manchmal glücklicher.
Das stimmt vielleicht, ist aber sehr schwer zu akzeptieren. Im Forschen, im Lernen hoffen wir doch auf das Glück der Erkenntnis.
Schwer zu akzeptieren und schwer zu tun. Das Nichtdenken haben ja höchstens die buddhistischen Mönche im Nirvana drauf.
Man muss sich wirklich keine unnötigen Prüfungen aussuchen, aber ich kann die Gedanken des Erzählers nachvollziehen. Er verpasst hier ja quasi das, was er als essenziell und prägend ansieht.
Er sagt ja auch die „Gaben drohen zu verkümmern“!
Nun ja, aber er entscheidet sich doch letztendlich bewusst gegen die Teilnahme an diesem typischen Leben. Er genießt ja die Unbekümmertheit, die sein Erbe ihm ermöglicht. Verpassen tut er also auch nur das, was er sich selbst aussucht.
Verpassen und Verprassen. Es gibt schlechtere Kombinationen 😉
Vom Erbe des Ich-Erzählers weiß man nichts. Es wurde nur ein Partygast zitiert. Und der Vater von Andreas hat Einfluss, nicht unbedingt Geld. Ob hier ein Leben im Überfluss stattfindet oder nur vorgegaukelt wird, ist nicht entschieden.
Immerhin hat er laut eigener Aussage das Arbeiten neben dem Studium nicht nötig. Und er wohnt trotzdem bequem in seiner eigenen Wohnung in der Stadt. Aber schon richtig, momentan muss man sich ja auch mit dem zufrieden geben, was der Erzähler uns suggerieren will. Die Wahrheit muss ja auch das nicht sein.
Elite oder nicht: bitte, tanzt doch alle etwas mehr aus der Reihe!
Aber bitte erst wenn die Corona-Pandemie vorbei ist 😉
Früher war das etwas anders. Heute müssten viele ja erst mal in die Reihe reintanzen.
Das ist dieses Paradox, man will ja eigentlich gleichzeitig möglichst große Individualität und trotzdem bitte Einheit.
Ganz außerordentlich unauffälig zu sein, ist die richtige Mischung, um sich bewundern, aber nicht schnappen zu lassen.
Toll wäre natürlich eine Gesellschaft, in der man so anders sein kann wie man möchte und trotzdem dazugehört. Aber das funktioniert auch heute bei weitem noch nicht immer.
Für viele Menschen gehört es zum Selbstwertgefühl, sich abzugrenzen: gegen Fremde oder Ärmere oder Andersgläubige. Der Klassenfeind ist bereits ein Feind. Vorurteilsfreies Nebeneinander mit Achtung statt Verachtung setzt ein gefestigtes Selbstwertgefühl voraus. Das ist leider in wenigen Gesellschaften anzutreffen. Schon Veränderungswille schafft Gegnerschaft.
Ist es nicht auch eh völlig normal sich von den Mitmenschen abzugrenzen? Diese Idee, dass wir alle gleich sind und uns dementsprechend gleich verhalten, gleich kleiden, gleich denken ist doch sowieso absurd.
Es wäre wünschenswert zu dem Schluss zu kommen: Wir sind alle gleichwertig, aber nicht gleichartig.
Amen!
Wenn man sich Mühe macht, hat das ja meistens einen Sinn oder zumindest einen Auslöser. Ob die Anstrengung am Ende vergebens war, darüber darf man sich gar keine Gedanken machen. Wer schon vor dem Tun anfängt zu zweifeln, der wird jedenfalls nicht viel schaffen und auch nicht sonderlich weit kommen.
Das Leben lässt sich ja eh schlecht planen. 2020 ist das beste Beispiel. Man muss manchmal auch einfach loslegen und sehen wohin die Reise führt. Nicht kopflos, aber aktiv.
Zweifel sind lästig, aber auch nützlich. Wenn man nicht an ihnen hamlethaft verzweifelt, sondern sie überwindet, geht man sein Werk gestärkt an. (Verkehrt sein kann es natürlich trotzdem.)
Mit dem Wissen wächst der Zweifel. Jedenfalls laut Goethe. Wer seine Taten nicht hinterfragt, mit dem stimmt also wahrscheinlich etwas nicht. VERzweifeln ist dann natürlich eine Spur zu doll.