


Nachtluft. Frösteln zwischen den Sträuchern, zwischen den Beinen. Etwas, das eingefroren ist, etwas, das sich nicht mehr rührt und erstarren wird.
Es stimmt nicht mehr. Wahrscheinlich hat es nie gestimmt. Der Schlafsack, der Unterschlupf, die anderen rechts und links, kein Unterschlupf mehr. Irgendwann werden die Vögel anfangen. Das wird unerträglich sein. Die Sonne wird aufgehen, das Licht wird lärmen: Tag.
Auf dem Boden hocken, an die Wand gelehnt, die Zeichnungen ausgebreitet. Warten, Träumen. Gesichter, Beine, Autos: ein Vorbeigleiten. Beine, Autos, Gesichter: ein Vorüberziehen. Autos, Gesichter, Beine. Ein Stehenbleiben, endlich ein Fragen und irgendwann vielleicht ein Käufer. Der Zwang, lebendig zu werden. Ein Lächeln tauschen, eine Ware. Autos, Himmel, Gesichter, Himmel, Beine, Himmel. Sonne und Wolken. Regen. Ein Unterschlupf. Manchmal Hunger, meistens. Gemeinschaft der Hungrigen. Zusammengehörig, austauschbar, eins. BRDDR, Bindung und dadurch Hilfe. Nur dadurch. Nur der Rhythmus der Stimmen und Gitarren. Musik und Coca-Cola. Anpassung und Norm: auch hier. Das dumpfe Gefühl: So geht es nicht weiter. Das Glück erkannt und dadurch verloren. Die beschränkte Harmonie der Herde eingebüßt. Bedauern? Eigentlich nicht. Unruhe? Ja, Unruhe. Etwas muss anders werden. Heute vielleicht oder morgen oder vielleicht erst im nächsten Jahr. Etwas hat sich verändert. Etwas muss sich verändern. Die Bilder stimmen nicht mehr. Der Standpunkt stimmt nicht mehr. Der geänderte Blickwinkel macht alles verkehrt. Der Versuch, selbstständig zu sein, schließt aus. Eingebettet in die Blätter, die ein anderer vollgekritzelt haben könnte. Wertlos, bezuglos – aus.
Zurück? Aufgeben? Aufgeben wahrscheinlich, aber nicht zurück. Vorwärts. Kämpfen. Nicht mehr gegen etwas, sondern für etwas anderes. In mir. Ein innerer Kampf, und dann vielleicht ein äußerer. Es wird Tag. Es wird Zeit. Es wird etwas passieren.
Ich schreibe diesen Bericht also tatsächlich. Ich habe mich hingesetzt, hier in diesen Herbstgarten, zu den bedeutungslos bunten Blumenbeeten, kurzes, zähes, dicht gepflanztes Zeug in den unbeholfenen Anlagen dieser thüringischen Kleinstadt, und ich bringe die Buchstaben zu Papier, die nun vor mir auf dem Bogen, zu Worten gestaffelt, dasselbe ausdrücken sollen, ein Versuch, was in Linien und Schattierungen mein Gesicht sagt, was hinter meiner Stirn als reißender Gedankensturz so unermüdlich gearbeitet hat, bis es mein Gesicht durchfurcht, meine Stimme ausgewaschen und meinen Blick weggespült hat. Wasser gegen Granit. Ein Wildbach zwischen Felsen, unterhalb meiner Grotte. Wie das Wasser brodelt und rauscht im Fallen! Wie es zu Tal donnert, gurgelt, tost und weiterrast, irgendwohin, wo es verschmelzen wird mit anderen Strömen und zur Ruhe kommen muss. Muss es? Wann und wo? – Niemals und auch dann nicht. Nirgends und auch dort nicht. Doch ich täusche mich wohl. Mein Gesicht ist zwar geschliffen, meine Stimme ist zwar geprägt, mein Blick ist zwar gefeilt, aber das Relief ist nicht zu entziffern. Freispruch. Natürlich gab es Freispruch.
Etwas ist zerbrochen. Etwas wird nie zerbrechen. Ich will keinen Rat, denn ich will keine Änderung. Alles, was mein Leben ausmacht, müsste sich gleichzeitig auch ändern, blasser, unbedeutender werden. Die innere Spannung würde erschlaffen zu einem Leben, das nur Bequemlichkeit und nicht Erfahrung sucht. Ich wäre freundlicher, ausgeglichener. Es gäbe nicht die atemlosen Augenblicke, die sich auf Unwägbares gründen: auf Konturen, Bewegungen, Hoffnungen. Das Verschwiegene durchdringen und, wenn überhaupt, mit den wenigen teilen. Gemeinschaft der Gläubigen. Gemeinschaft der Wissenden. Nein, ich will keine Hilfe. Ich müsste auf zu vieles verzichten, um noch zurückzukönnen. Ich möchte meine Berechtigung, mehr nicht. Keinen Arzt, keinen Psychiater, keinen Pfarrer. Keinen Wandel.
Ich nehme mich an.
Es war Morgen geworden. Die Vögel hatten ihr schrilles Gekreisch auf ein erträgliches Maß gedämpft. Einige von uns hatten sich schon gewaschen, notdürftig, alles war notdürftig, eine einzige wochenlange Notdurft. Von den Schlafpritschen und Waschräumen in den Jugendherbergen bis zu den Übernachtungen im Freien: Open Air, aber nicht für drei Tenöre, sondern für dreizehn Schnarcher zum Sleep-in, Woodstock für ganz, ganz Arme, neunundzwanzig Jahre danach. Früher gab es die FDJ-Heime, aber das haben die wenigsten von uns noch mitmachen müssen, und was unsere Eltern uns darüber erzählt haben, war nervtötend, egal, ob sie es gemocht haben oder nicht. Aber: ‚Wer jung ist, fragt nicht viel‘, behaupten die Greise und meinen damit anerkennend ihre eigene Anspruchslosigkeit von früher. Sonst soll man als ‚junger Mensch‘ natürlich viel fragen (nicht nach Designer-Klamotten, aber nach Lebensinhalten), vor allem lauter Fragen, die mit Ja zu beantworten sind: Stehst du zu unserer freiheitlich demokratischen Rechtsordnung? Willst du Ausländer integrieren? Und dich selbst? Da ist es dann auch nicht mehr weit zu solch intimen Bekenntnissen wie: Ich bin für Gerechtigkeit. Ich bin dafür, dass Einsatz sich lohnt. Ich verlange, dass alle Arbeit haben. – Als ich neun war, verschwanden die entsprechenden Spruchbänder mit weißer Schrift auf rotem Grund von den Straßen und Hauswänden unserer Republik, und ein Dreivierteljahr später verschwand die Republik selber. Erst kommt die Idee, dann kommt die Aktion – das gilt für den Anfang, aber fürs Ende gilt es auch.
War mein Ende gekommen? Aufgebrochen, ausgebrochen war ich aus der verzärtelten Drangsalierung einer bemühten Kleinbürger-Familie, mit hochgerecktem Hals war ich losgezogen und würde am liebsten mit gesenktem Kopf in die verhasste Eingebundenheit der Kleinstadt zurückkehren, mich an den frisch gestrichenen Fensterläden erfreuen, den Blumenkästen, den Neuigkeiten, die immer nur in der Zeitung stehen: Am 2. Mai haben die Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel beschlossen, den Euro einzuführen. Dabei hatten sich meine Eltern so über die D-Mark gefreut. Am 9. Mai hat der Transvestit Dana International den Grand Prix Eurovision de la Chanson für Israel gewonnen. Meine Eltern waren kurz entsetzt, aber bis zur Entrüstung reichte es nicht mehr, sie waren wild entschlossen, sich an westliche Standards anzupassen. Als meine Eltern zum ersten Mal Kohl wählen durften, war ich zehn. Sie kamen genauso zufrieden zurück von ihrer Verrichtung wie früher, als sie noch Honecker zu wählen hatten. Aber dass jetzt alles besser werden würde, war keine Frage, für Kind nicht und für Greis nicht. Die Häuser wurden weiß getüncht, die Dächer neu gedeckt, wir bekamen Fenster, durch die es nicht zog, und es hörte auf, nach dem Sprit der Trabis zu stinken. Es gab Werbeplakate, Neon-Beleuchtung und lauter glattpapierene Zeitschriften am Kiosk. Außerdem hatte mein Vater viel mehr Zeit für mich, weil er im Handumdrehen arbeitslos war, dafür verdiente meine Mutter das Doppelte von früher. Es gab nichts, das mir nicht gefiel. Ich mochte alles. Aber das blieb nicht so. Nur dass ich noch nicht wusste, dass das nie so bleiben würde. Mein Vater nutzte seine Freizeit dazu, meine zu beschränken, immer mehr. Zum Schluss konnte ich gar nichts mehr ertragen, nicht die rausgeputzten Häuser, nicht die umgeschulten Lehrer und mich selbst am allerwenigsten. Durchfall: Du musst es anhalten, unbedingt, aber du weißt, es schwitzt sich nicht weg. Irgendwann kommt es raus.
Meine Eltern fanden es ganz in Ordnung, dass ich wegwollte. Wahrscheinlich dachten sie über mich dasselbe wie ich: Alles ist besser als das, was jetzt ist. Wenn ich in einem italienischen Nest meine ersten Spagetti hingeschoben bekommen hätte, wäre ich bestimmt auf dem nächsten Muli nach Rom geritten, und wenn ich in einem dieser Suburbs in Pennsylvania das Licht der Welt hätte erblicken müssen, wäre ich nach New York getrampt. So musste eben Berlin dran glauben. Berlin, wo alles aufgehört hatte aufzuhören, wo alles angefangen hatte anzufangen und wo nichts fertig war, am allerwenigsten ich. Leute, denen es genauso geht wie dir, findest du schnell. Leute, die so denken wie du – das ist schon schwieriger, alle glauben ja immer, das sei dasselbe: So, wie es mir geht, so bin ich. Aber Leute, die so fühlen wie du – das kannst du vergessen.
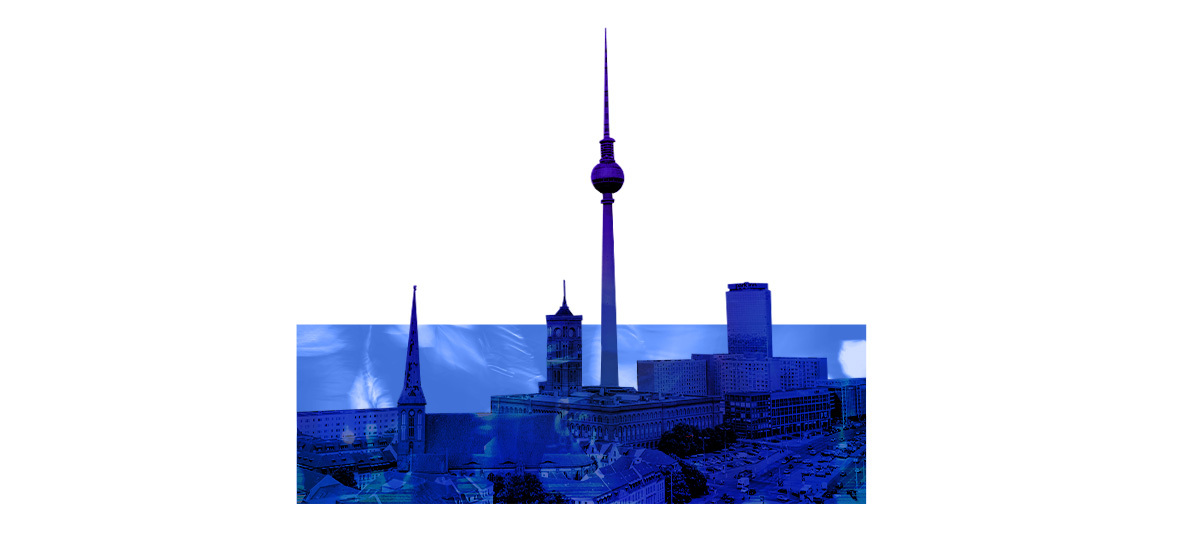
Titel-, Haupttitel- und Abschlussbild mit Material von Shutterstock: Anton Starikov (Schlafsack), Sam Wordley (Mann), Christian Mueller (3, Hintergrund) | François-Guillaume Ménageot – ‚Das Martyrium des Hl. Sebastian‘/Wikimedia Commons/gemeinfrei/public domain | Pavel Sepi (Berlin)







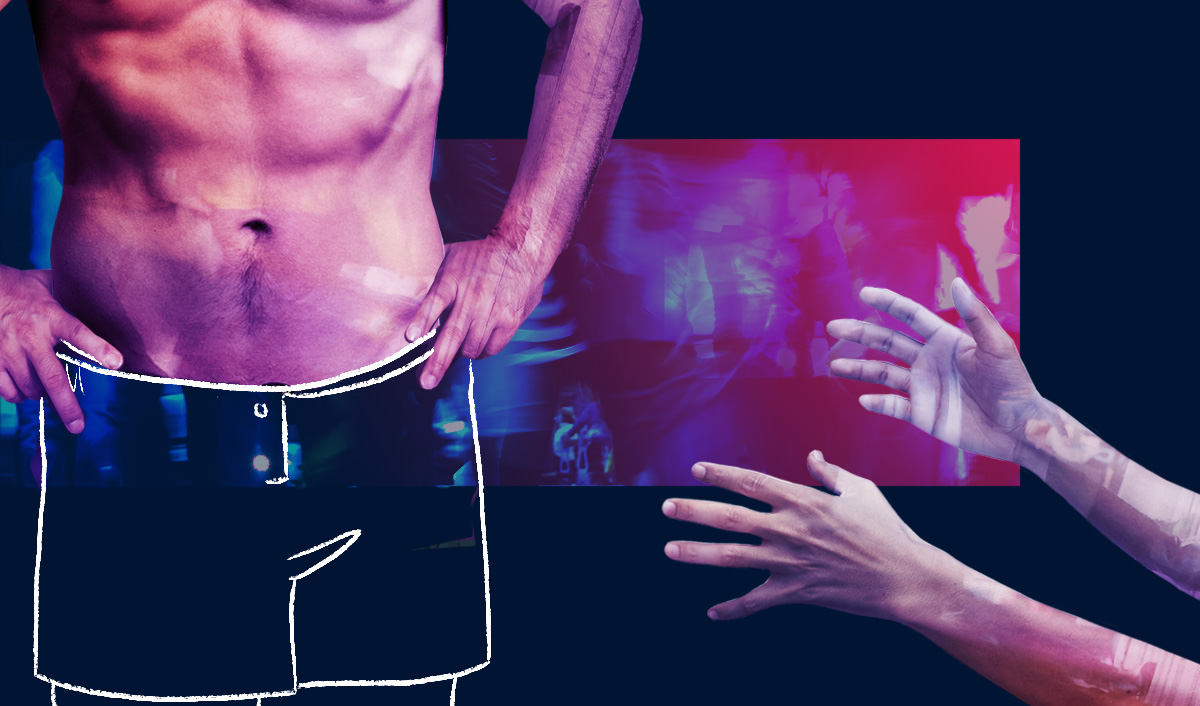










Wann wäre ich wahrhaft glücklich?
Nun verstehe ich endlich auch den Titel der kompletten Reihe.
Die Aussage kann als Resignation, aber auch als Herausforderungverstanden werden, wie sich am Ende zeigen wird.
Ein innerer Kampf scheint all den Erzählungen der Reihe gemein zu sein. Aber wenn man den Bezug zur Judasgeschichte im Kopf hat, scheint das nicht zu überraschen.
Äußere Kämpfe sind mehr was für Blockbuster, bei denen für viele Millionen Dollar Autos und Häuser in Flammen aufgehen, bevor der strahlende Held mit Fäusten und Waffen das Böse besiegt. Wenig arthouse-kompatibel.
Vielleicht ist das ja der nächste Schritt. Wenn man durch das Rinke-Archiv klickt fehlt bisher jedenfalls das Blockbuster-Drehbuch 😉
Erstmal eine Netflix-Serie bitteschön…
In einem Blog lassen sich halt Essays und Dialoge befriedigender verwirklichen als Anleitungen zum In-die-Luft-Jagen. Die Welt mit Hilfe einer Netflix-Serie zu retten, ist dagegen eine zu bewältigende Herausforderung.
Das sind zum Auftakt ja schon mal zwei Fragen, mit denen man sich mitunter ein ganzes Leben beschäftigen kann: Wer bin ich und wer will ich sein!?
Wer weiß, was er will, ist schon einen Schritt weiter. Manchmal in die verkehrte Richtung.
Oft hilft es aber ja schon wenn man überhaupt mal eine Richtung hat. Sobald man feststellt, dass man auf dem falschen Weg ist, kann man das ja korrigieren. Schlimmer finde ich oft wenn man komplett feststeckt.
Wie unser Held. Noch.
Nicht zurück. Vorwärts. Naja, mal schauen wohin uns das in den folgenden Kapiteln führt.
Eine Stadt, wo nichts fertig war … so könnte man Berlin auch heute noch gut beschreiben 😉
Man schaue nur auf das Chaos rund um die vergangene Wahl. Ich staune und wundere mich…
Es wäre jedenfalls ein Gau wenn die Wahl tatsächlich wiederholt werden müsste.
Aber interessant wäre es auch. Sind Wahlergebnisse Zufallstreffer eines Tages, Abbild einer Stimmungslage oder
Ergebnis gründlichen Durchdenkens der Situation?
So richtig viel hat sich in Berlin ja seit der letzten Wahl nicht verändert. Obwohl man eigentlich nicht so richtig zufrieden mit der rot-rot-grünen Regierung war. Eine Neuwahl würde dann wohl auch kein dramatisch anderes Ergebnis bringen.
Keine prosperierende Großstadt ist jemals fertig. Wenn sie fertig ist, ist sie Museum.
Überzeugend! Mich hat das an Berlin auch nie gestört, ganz im Gegenteil.
Wer eine hübsche, ordentliche Stadt lieber mag kann ja nach München ziehen. Jedem das Seine.
Wenn es Beruf und Finanzen hergeben.
Wer dieser unglückliche junge Mann wohl ist? Er scheint ähnlich mit seinem Leben zu hadern wie der Junge aus der Beelzebub-Reihe.
Das ist doch kein untypischer Zustand für junge Menschen. Natürlich nicht immer in gleichermaßen dramatischem Ausmaß, aber das Hinterfragen von dem was ist scheint mir ziemlich normal zu sein.
Zufriedene Menschen verirren sich, wenn sie es bleiben, selten als Hauptpersonen in Buch- oder Filmhandlungen.
Das dürfte stimmen. Die Geschichte solch eine Figur wäre auch äußerst langweilig. Außer man schreibt einen Ratgeber für Glück und Zufriedenheit.
Gerade der letzte Satz „Aber Leute, die so fühlen wie du – das kannst du vergessen“ klingt nach einem sehr verbreiteten Denken in der Pubertät. Zum Glück relativiert sich das mit den Jahren zumindest ein kleines bisschen.
Das Gefühl, einzigartig zu sein, nimmt mit dem Alter ab. Das enttäuscht und erleichtert.
Wer es schafft mit dem Alter entspannter, gelöster, offener zu werden, der hat viel erreicht. Es gibt ja auch die gegenteiligen Beispiele, wo Menschen eher abstumpfen und verhärten.
Der eigene Charakter und die äußeren Umstände bewirken den Unterschied.
Der letzte Absatz hat mich nachdenklich gemacht. Tatsächlich ergibt sich ja vieles einfach aus den Möglichkeiten, die man vorgesetzt bekommt. Auf einmal ist man eben in Berlin und nicht in New York. Meistens hätte es aber eben auch anders kommen können.
Jede veränderte Ursache schafft eine veränderte Wirkung.
In der Tat. Und am Ende kann man sich ja auch nur mit dem auseinandersetzen was man kennt – und Entscheidungen anhand der Situationen fällen, die einem begegnen.
Das kann eigentlich eine recht hilfreiche Einsicht sein. Also nicht zu wollen, was außer Reichweite liegt. Sondern den Fluss ausnutzen um dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Klingt ein bisschen Eso, aber es ist sicher nicht falsch.
Gegen den Strom zu schwimmen hat auch etwas für sich: Beim Lachs führt es zum Laichplatz oder auf den Teller.