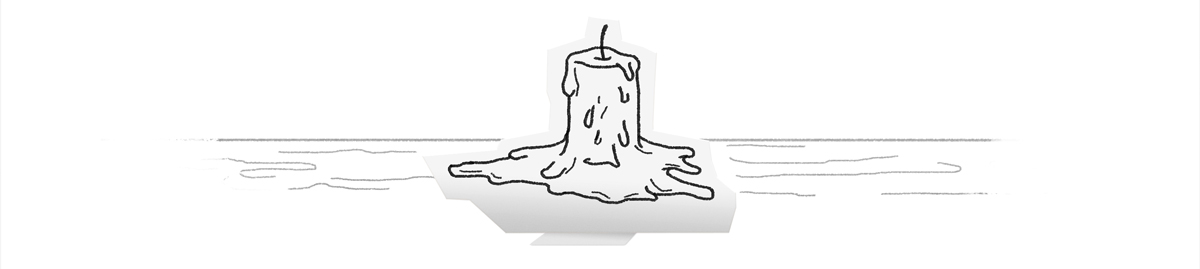
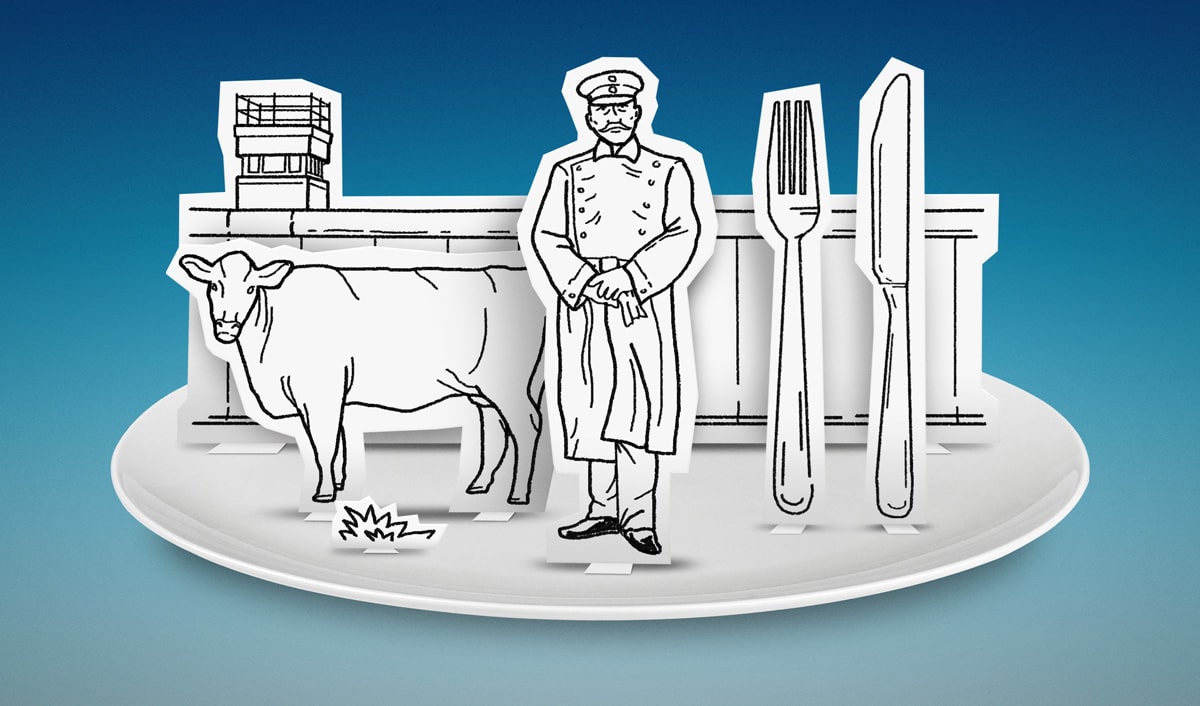
Es ist der 1. Juli 1998 und nicht zu fassen: Ich sitze in einem ‚Block House‘, Hamburgs prominentester Steakhauskette. Ich sitze hier, allein mit meinen Rechenkästchen. Ich schreibe sie voll, wie immer, Seite für Seite. Zum ersten Mal allein im ‚Block House‘. Sonst waren wir doch immer zu zweit, zu viert, zu sechst, seit fast dreißig Jahren. Wir kauten und sprachen über den Film, den wir gerade gesehen hatten. Menschen, die weg sind, zum Teil für immer. Und wo bin ich? – In Berlin. Mein erster Abend in Berlin. Im ‚Block House‘! – Na und?
Vorher hatte ich alle Schenken der Umgebung vom ‚Adlon‘-Restaurant bis zur Ostzonenkneipe beäugt – nichts war mir passender erschienen. Wie auch! Von meinem Fensterplatz aus kann ich eine dunkle Fläche sehen, an deren Rand schon die Zementmischer lauern: die Ober-Fläche des Führer-Bunkers. Triumph der Grill-Gesinnung über die Barbarei von nationalem und realem Sozialismus. Ein weites, leeres Feld. Es macht Spaß, in diesen Abgrund von Geschichte, fünfzig Meter weit diesseits der abgetragenen Mauer, zu starren, das Rind zu zerkauen und zu wissen, dass ich mich solchen Gaumenfreuden immer nur im Jenseits habe hingeben dürfen, bisher. Dabei brauche ich mich gar nicht als amerikanophilen Leichenfresser zu denunzieren: Der ‚knackige‘ (Speisekartenlyrik!) Salat mit einer Soße, die seit Bestehen der ‚Block-Häuser‘ nicht etwa ‚Sugo Italiano‘ heißt, sondern ‚Italian Dressing‘, dieser Salat ist ebenfalls ein durch und durch westlicher Genuss, den man jenseits des Eisernen Vorhangs, als es ihn noch gab, nicht kannte. Umso munterer beiße ich also in den Radicchio, zwar nicht ganz in Sibirien, aber doch im Osten, nur dreißig Gehsekunden entfernt von dieser ideologischen Linie heikelster Stelle: dem Hosenschlitz zwischen zwei Systemen – knöpf oder zipp? –, damals.
Ich habe nun mal eine Schwäche dafür, alles nach seiner äußerlichen Erscheinung zu beurteilen. Ich sehe das platte Dunkel und dass Hitler darunter Zyankali geschluckt hat und Eva und das Ehepaar Goebbels mit seinen sechs Kindern auch – mir teilt sich das erklärungslos mit. Weil ich weiß: Hitler hat erst seine geliebte Schäferhündin Blondi vergiftet, um zu testen, ob der Stoff wirkt – misstrauisch wie alle Diktatoren. Sich selbst hat er beim Biss auf die Kapsel erschossen: Doppelt hält besser, auch beim Sterben.
Doch von nun an widme ich mich lieber der Realität, dem – stimmt schon – zu allen Zeiten unerfreulichsten Thema. Und da kommt dann auch gleich so was Hausfrauliches in mir durch: Ich finde, der Sozialismus müsste sich dafür schämen, wie er sein Wirkungsfeld übergeben hat: Ruine und Platte, das war’s. Wir müssen noch dankbar sein, dass Honecker sein Geld lieber für Grenzbefestigungen ausgegeben hat als für Gebäude, sonst wären da noch mehr Grässlichkeiten als die, die sich links zu meinen Blicken auftürmen. Warum bloß ist der Sozialismus so niederschmetternd unkreativ gewesen? Das kann doch nicht etwa an der Idee liegen, die ja eigentlich einleuchtet. Wenn natürlich die Menschen nicht alle gleich und von Natur aus gut wären, sondern von Natur aus verschieden und schlecht (dabei aber domestizierbar), dann sähe die Sache schon anders aus. Dann dürfte man für die Elite Heime in Wandlitz bauen und Jagden in der Mark veranstalten. Dann haben die einen, wie Bill Gates, gute Ideen und die anderen, wie ich in meinem Japan-Fonds, schlechte Aktien.
Ich finde Schäbigkeit eine schreckliche Hinterlassenschaft – und mehr sehe ich nicht. Wenn schon die Oberfläche – mein Wirkungsfeld – nicht stimmt, wie kann eine mir womöglich unzugängliche Tiefe in Ordnung sein? Da liegen dann doch auch höchstens Leichen im Keller, denen egal sein dürfte, ob sie vom Hakenkreuz oder durch Hammer und Sichel erschlagen worden sind. Umso schlimmer für die, die eine neue Welt schaffen wollten, jetzt Aral und McDonalds in Prenzlauer Berg zu sehen. Nur: Sie hatten ja vierzig Jahre Zeit, hier in Berlin!
Inzwischen sitze ich, am 2. Juli, Unter den Linden. Die Markisen begrenzen gnädig den Blick nach oben, und die bordeauxroten Säulen hier unten lassen vergessen, dass dort über uns wüstester DDR-Beton die ehemalige Prachtstraße verunstaltet. Unaufdringlicher gleiten die Autos vorbei, und gegenüber ist ein altes Gebäude eingerüstet, daneben prangt DDR-Einheitsfassade, dann kommt ein alter Bau, der wieder anständig hergerichtet ist. Dazwischen die Linden. Sie blühen sogar. Hier, wo ich sitze, habe ich nichts auszustehen. Die Sonne scheint mir vom Brandenburger Tor her in den Rücken, die Tische sind weiß gedeckt, die Speisekarte ist französisch, und die Preise verscheuchen alle die, die vergangenen Zeiten hinterhertrauern.
Da ich eine Gesellschaft, in der alle gleich sind, noch nie gesehen habe und mir auch nicht vorstellen kann, gehöre ich lieber zu den Privilegierten, denn ich bin – Françoise Sagan abwandelnd – lieber im Grandhotel dankbar als im Obdachlosen-Asyl. Die Angestellten in den Geschäften der Friedrichstraße und in Lokalen, die ich für betretenswert erachte, haben – neun Jahre nach Honecker – ihre Lektion gelernt. So viele gute Tage, wie mir zwischen der Kosmetikabteilung des ‚Lafayette‘ und der Rezeption des ‚Madison Suites‘ gewünscht worden sind, kann ich mein Lebtag nicht haben, ohne zu verzweifeln.
Warum waren denn alle Kellner in Moskau, Warschau und Ostberlin gleich unfreundlich, warum ließen sie Wartende hochnäsig nicht ein, um ihren Schreckensfraß zu ertragen, wenn jetzt, unter kapitalistischen Bedingungen, alle bis zur Aufdringlichkeit hin fragen, ob man zufrieden sei und noch was wolle? Das muss doch am System liegen, woran denn sonst? Also, wenn Kapitalismus bedeutet, freundlichere Gesichter, besseres Essen und blankere Fassaden, wieso hat es dann den Kommunismus je gegeben? Um das festzustellen, bin ich heute stundenlang herumgefahren. Ich glaube nun mal nicht, was mir Leute sagen, sondern was ich sehe: in Gebäuden, Gesichtern und Gedanken.
Zunächst mal aber musste ich der SED ein hohnstrotzendes Schnippchen schlagen: Ich fuhr im Zickzack alle Straßen ab, die früher von der Mauer zerschnitten waren. Mein alter Mercedes erinnerte sich sehr gut an das erniedrigende Schauspiel, als ihm von Grenz-Vopos in ausgebeulten graugrünen Anzügen die Sitzbank rausgerupft und mit einer Stange im Tank rumgestochert worden war. Dann erforschten sie ihn noch mit Spiegeln untenrum, so als ob da vielleicht Rolands Urgroßtante klebte, die wir im Spreewald besucht hatten.
„Wie soll man hier eigentlich fahren?“, fragte Roland angesichts vorgeschriebener Schlangenlinien, und der Obergraugrüne sächselte bissig zurück: „Gibt’s denn bei Ihnen in der BRD keine Grenzkontrollen?“
„Zumindest muss man bei uns kein Hindernisrennen veranstalten, damit die eigenen Bürger nicht ausrücken können“, gab Roland patzig zurück, was den Eifer der Beamten nicht eben dämpfte, es ihrem Vorbild Lenin nachzutun, der ja auch schon Kontrolle den Vorzug vor Vertrauen gab und sich damit mehr als Menschenkenner denn als Menschenfreund outete. Ein tödlicher Fehler: Hätte der Sozialismus so volkstümliche Dinge erfunden wie Massentourismus, Jeans und Coca-Cola, dann gäbe es ihn vielleicht noch. Es ist wohl die beste Pointe, die die Geschichte diesem Jahrhundert beschert hat, dass die ursprünglich progressivste Idee unseres Säkulums am Sicherheitsbedürfnis ihrer Verfechter zugrunde gegangen ist.
Wäre das Bruttosozialprodukt nicht in Grenzbefestigungen und Waffen, sondern in Lebensqualität investiert worden, hätten sich die Völker des Ostens vermutlich nicht erhoben. Denn die meisten Menschen interessiert nun mal mehr, wie sie wohnen, was sie anzuziehen und zu essen haben und wohin sie reisen können, als wem die Produktionsmittel gehören.
Anders als damals, 1986 am Übergang Heinrich-Heine-Straße, als man zum Hin und Her des Streckenverlaufs nur sagen konnte: ‚Ich weiß nicht, was soll es bedeuten‘, war mein Wagen gestern eher auf Hoffmann von Fallersleben eingestimmt – zwischen dem Auto und mir herrschte Einigkeit. Recht und Freiheit bot die Straße: Potsdamer Platz im Osten – zick –, Stresemannstraße im Westen – zack –, wieder in der Leipziger Straße im Bezirk Mitte – zick –, Lindenstraße in Tiergarten – zack –, Treptower Park mit Sowjetischem Ehrenmal – zick –, nächste Querstraße Kreuzberg – zack –. An einem raren Stückchen Mauer vorbei zurück in den Osten und von da aus über den Landwehrkanal nach Neukölln. Schließlich endgültig ins ehemalige Ostberlin, ab nach Köpenick!
Dieser Stadtteil übersetzt die größte Baustelle der Welt, zwölf Kilometer westlich am Potsdamer Platz, ins Vorstädtische: Die Straßenbahnschienen werden aus der Hauptstraße herausgerissen, die Brücke über die Spree, die den Ortskern mit dem Rest der Welt verbindet, wird renoviert und ist nur im Slalom einspurig befahrbar, mein Ost-West-Zickzack in einer Nussschale. Das Schloss wird generalüberholt und verwehrt den Zugang.
Plattenbau, Ruinen und Instandgesetztes wechseln einander ab. Die Häuserzeilen bilden Gebisse, die dringend dentaler Fürsorge bedürfen. Nur das Rathaus ist blankgeputzt, auf dem Treppenabsatz steht ein lebensgroßer Hauptmann von Köpenick: ein armer Schlucker in zu großer Uniform. Das ist lustig und anrührend. Im Ratskeller haben Roland und ich 1977 Eisbein mit Erbspüree zu fünf Mark neunundsechzig gegessen. Heute verheißt die Speisekarte im Messingkasten: „Schuster Voigts Himmelreich: halber Hummer mit Südseekrabben an feinen Blattsalaten – 33,00 DM.“
Am schönsten war der kleine Markt. Da stimmte alles: die Jahrhundertwende-Kulisse der Bürgerhäuser, die duftenden Stände mit heimatlichen Waren und die Marktfrauen, die mit der Kundschaft um die Wette berlinerten: „Dat jeht extra.“ – „Brauchen Se ’n Belech dafür?“ – „Nee, nee, ick bin da vatraunswürdich.“
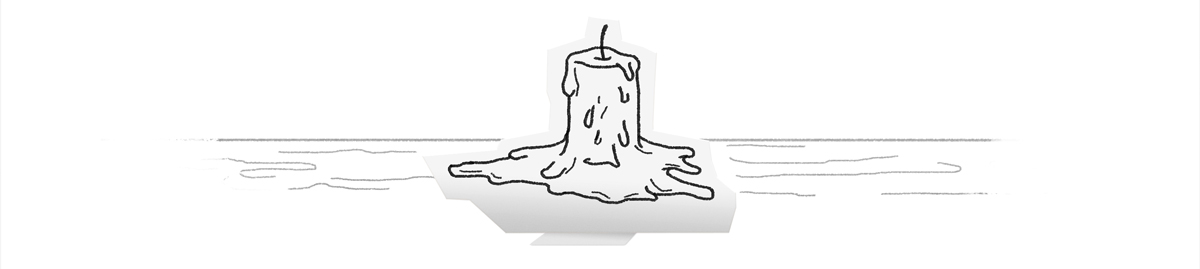
Titelgrafik mit Material von Shutterstock: SOMMAI (Teller)

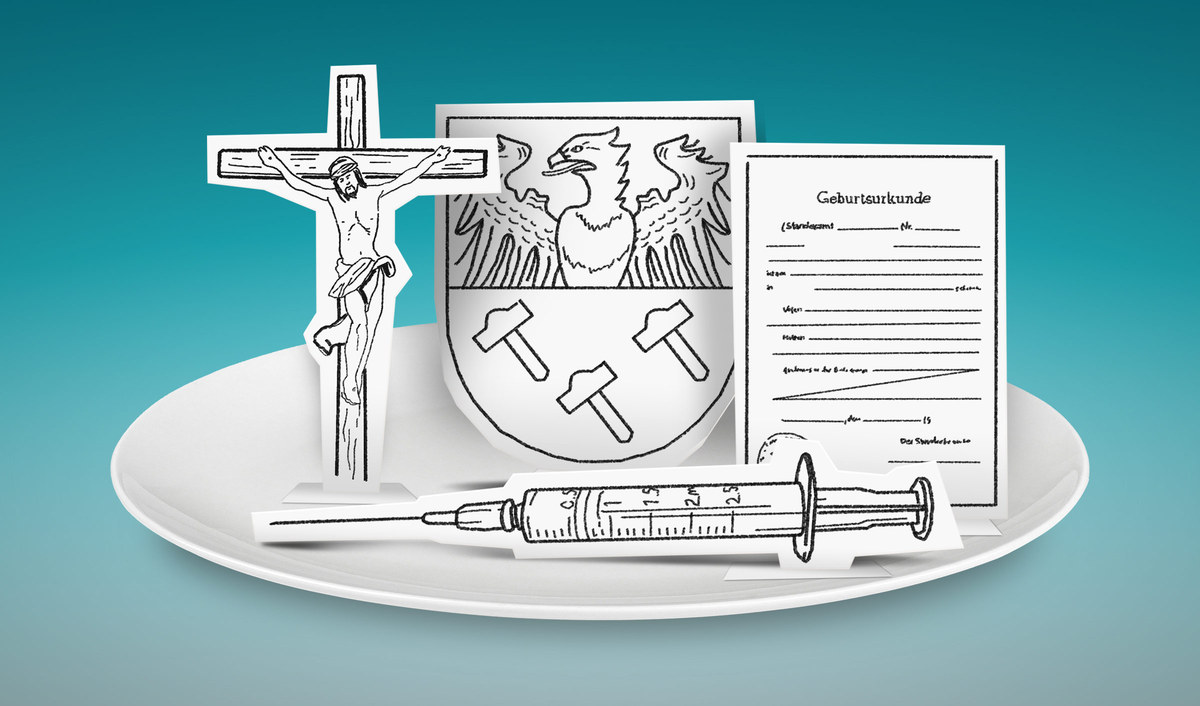


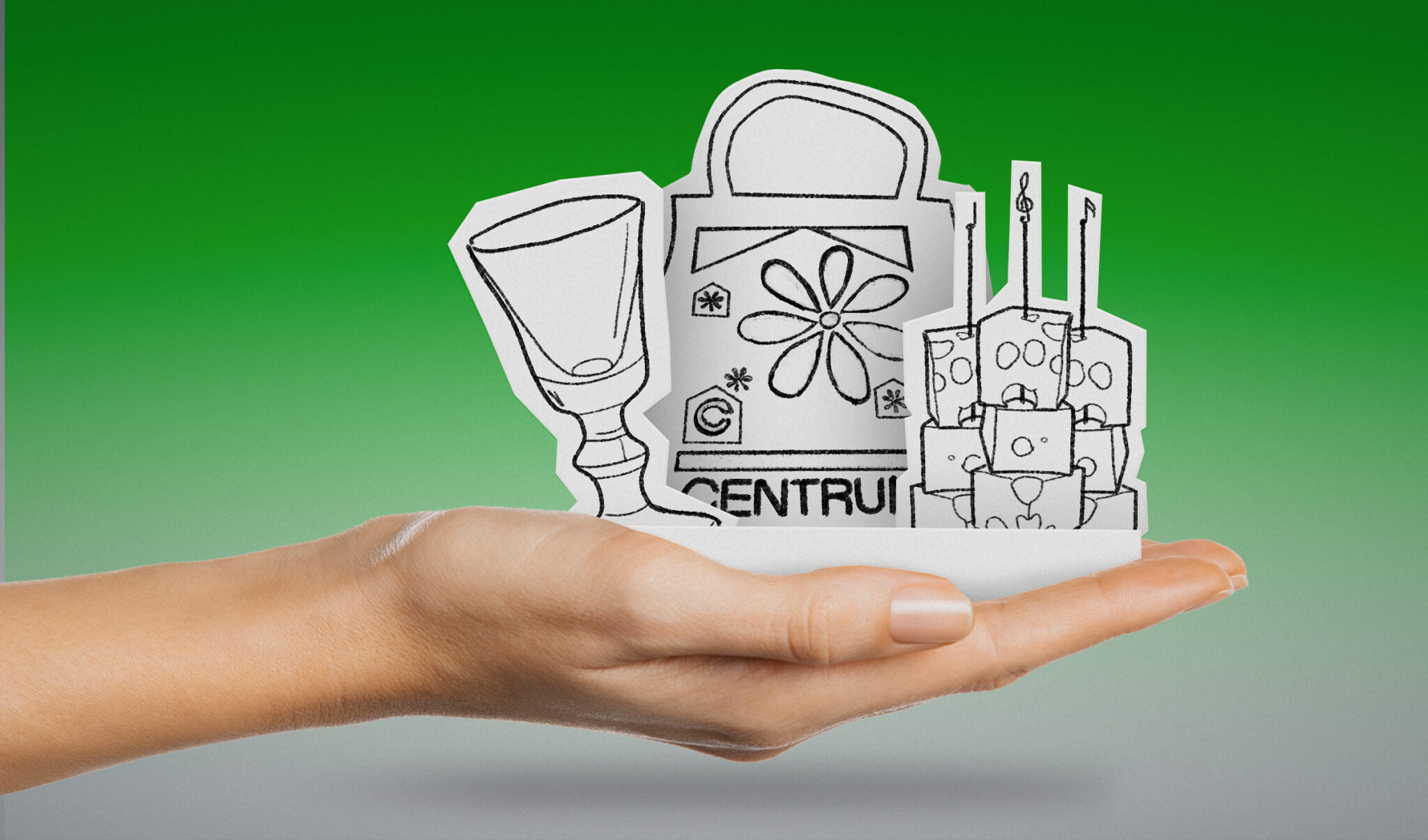






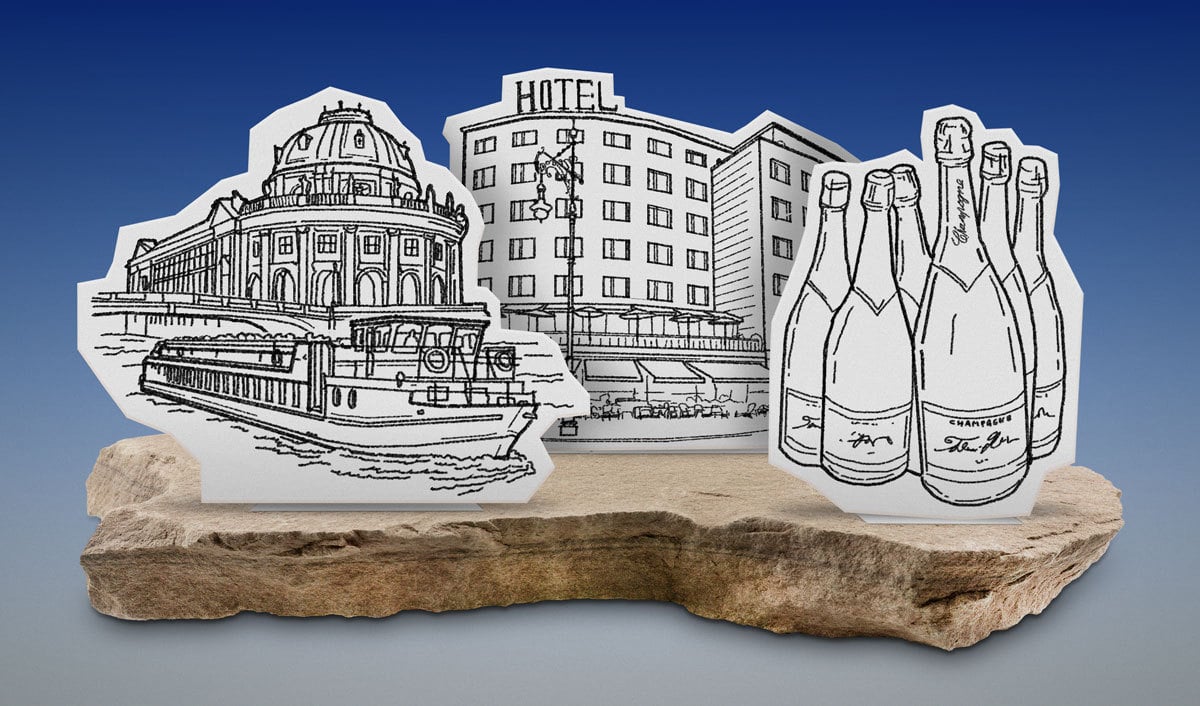


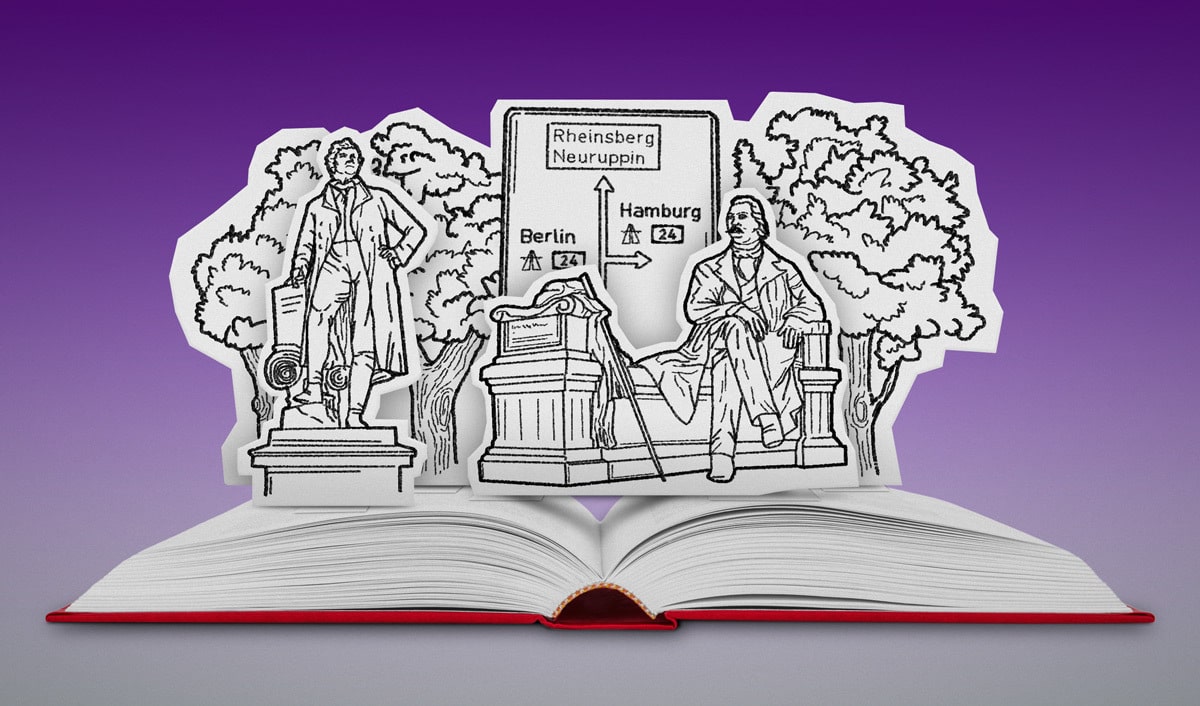
Und wie so oft bei solchen Sachen kommt das Italian Dressing ja auch gar nicht so richtig aus Italien, sondern in dieser Form wohl eher aus Massachusetts.
Auch die Bayrische Creme (zunächst mit Hausenblase oder Kalbsfuß angedickt) ist wohl eher eine französische als eine deutsche Erfindung.
Fies! Also so ein Kalbsfuß im Dessert!
Störblase im Nachtisch klingt auch nicht sehr lecker, aber zum Gelieren brauchte es tierische Proteine. Da haben wir dann halt Rind und Schwein im Pudding. Guten Appetit!
Mittlerweile hört man gar nicht mehr so viel Berlinerisch in der Stadt wie noch vor ein paar Jahren…
Na so geht’s doch überall, oder? Die Dialekte verschwinden langsam. Das lässt sich auch kaum verhindern.
Im ‚Tatort‘ sprechen die Nebenfiguren oft Mundart, damit man auch ohne Rhein, Spree oder Isar im Bild weiß, wo die Leiche liegt.
…und damit man wenigstens ein wenig Abwechslung hat.
Schon das Ohnsorg-Theater sprach fürs Fernsehen etwas weniger platt.
Haha, McDo im Kollwitzkietz wäre wohl etwas. Da wäre wahrscheinlich gleich Krieg angesagt.
Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass es keine Ausschreitungen gab als Starbucks in Italien eröffnet hat 😉
Auch Proteste haben ihre Moden. Wer gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße geht, hat keine Zeit, gegen Wohnungsnot zu kämpfen.
Oh das ist was dran. Stimmt, selbst für Aktivisten gibt es Trends.
Trends würde ich das jetzt nicht nennen. Aber es gibt sicher immer wieder Themen, die in den Vordergrund rücken und andere, die dafür an Aufmerksamkeit verlieren.
Eine Gesellschaft, in der alle gleich sind, kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht wäre es ein Ideal. Ich weiss es nicht. Solche Gesellschaftssysteme scheinen aber nie wirklich zu funktionieren. Egal wie idealistisch man das sieht.
Weil eine kleine Oberschicht dann eben doch ganz schnell etwas weniger gleich ist als der beherrschte Rest.
Es ist ja wirklich interessant, wie sich dieses Muster immer wieder wiederholt. Das fängt im Kommunismus an und zieht sich bis in kleine alternative Lebensgemeinschaften.
Das Problem ist eventuell, dass eben nicht jeder Mensch von Hause aus gut ist, und was die Gene nicht verbockt haben, das schafft dann die Umwelt. Dies wäre die konservative Sicht der Dinge. Der fortschrittliche Standpunkt ist: Die Menschheit wird immer gebildeter, vernünftiger, besser.
Wie erklärt sich denn eigentlich ein Kapitalismus, in dem die Kellner trotzdem recht genervt auf Kundschaft reagieren? Das kommt mir ja trotzdem manchmal so vor…
In solchen Fällen ist dem Kellner eben egal wie das Geschäft läuft. In den meisten von solchen Fällen ist er wohl auch nicht auf Trinkgeld angewiesen. Trotzdem bleibt es natürlich ein Rätsel warum man im Service arbeitet wenn man eigentlich gar keine Menschen mag.
Diese Leute lassen sich dann wohl nur fürs Geschirr tragen bezahlen. Bei manchen Köchen hat man übrigens auch den Eindruck, dass sie Menschen nicht leiden können.
Ob schlechte Köche selbst gerne Essen?
Ja, unterwegs.
Eigentlich ist das ja schlimm, wenn man eigentlich einen guten Geschmack hat und trotzdem schlechtes Essen kocht.
Auch Menschen mit schlechtem Geschmack werden Köche oder Innendekorateure. Auch Menschen ohne Einfühlungsvermögen werden Politiker.
…die meisten Menschen interessiert nun mal mehr, wie sie wohnen, was sie anzuziehen und zu essen haben als…
Dahinter könnte man fast alle Themen setzen. Klimaschutz, Tierquälerei, soziale Ungerechtigkeit, Politik ganz allgemein usw.
Das ist etwas, was die meisten Politiker gerne vergessen.
…oder es ist etwas, dass die Politiker ziemlich gewieft ausnutzen. Das ist nämlich etwas, dass die Wähler ab und an vergessen.
Es war erstaunlich, wie wenig Außenpolitik im Bundeswahlkampf 2021 eine Rolle spielte. Jetzt fällt sie der deutschen Regierung auf die Füße.
So ist es ja oft. Die meisten Wähler interessieren sich halt eher für die eigenen Geschicke. Da fällt die Außenpolitik gerne als erstes unter den Tisch.
Eisbein mit Erbsenpüree klingt so viel leckerer!
Erbsenpüree ist o.k. Bei ‚Eisbein‘ fühlt sich bestimmt schon wieder jemand beleidigend (ein veganer Grönländer oder so).
Das sowjetischem Ehrenmal in Treptow ist immer einer meiner liebsten Orte in Berlin gewesen. Es wirkt so surreal und besonders.
Hmm, speziell ist es allemal. Aber schön wäre doch nochmal etwas anderes, oder?
Der steinerne Riese sieht sehr nach SS aus. Ob er das Kind auf seinem Arm vor einfallenden Russen schützen will? Die Anlage vor ihm ist allerdings imposant.