

Nachdem Dorothee die Beköstigung ihrer Pariser Freundin plus Anhang mit Bravour gemeistert hatte, galt die nächste Einladung ihren ehemaligen Kollegen von den Festwochen und ihrer Französisch-Lehrerin. Ich hatte die Freude, wieder mit gebeten zu sein.
Das Essen hatten wir rechtzeitig abgeklärt. Die Hauptspeise ‚Französisches Kaninchen‘, die Dorothee drei Tage zuvor aus Feigheit vor der Freundin nicht hatte zubereiten mögen, sollte für diese vergleichlose Crew auf den Tisch. Ein – geringes – Problem bestand nur darin, dass in Frankreich Feiertag war und deshalb das KaDeWe nicht zusichern konnte, dass am Sonnabendmorgen Kaninchen aus Paris eingeflogen würden. Für diesen Notfall war ich gehalten, Kaninchen bei Lafayette zu ergattern, weil das zwar offenbar weniger erstrebenswert, dafür sicher und bei mir vor der Tür war.
Aber – Dorothees Standleitung zum KaDeWe brachte die Entwarnung. Am frühen Samstagvormittag konnte sie mich fernmündlich informieren, dass die Karnickel-Leichen im Kaufhaus des Westens für sie bereitlagen. Schon Tage zuvor hatten wir miteinander sinniert, wie man wohl ein unaufwendiges Vorgericht herstellen könnte. Ich zeigte mich in dieser prekären Situation erbötig, Salami und Ardenner Schinken nebst Artischocken-Herzen und Oliven vom Lafayette mitzubringen. Doch auch in dieser Hinsicht wollte Dorothee nicht klein beigeben. Warum auch? Da sie sowieso zum KaDeWe musste, konnte sie so was auch dort kaufen und die Umsetzung meiner Anregung ganz für sich verbuchen, natürlich auch finanziell.
Ich schrieb zu lange, um noch Blumen erstehen zu können, und weil es Sonnabend war, gab es gegen neunzehn Uhr auch sonst nichts. Ich packte also seufzend meine letzte Flasche Aldi-Wein in die Lafayette-Tüte und fuhr mit Bahn und Bus zur Bleibtreustraße. An der Pforte stieß ich auf drei aufgeräumte Frauenzimmer, von denen die alleraufgeräumteste zielsicher tippte: „Sie wollen doch sicher auch zu Frau Koehler!“ Mir war klar, dass man mir das ansah, und ich werde mich auch nicht wundern, wenn jemand in Potsdam sagt: „Also, so wie Sie aussehen – wann haben Sie denn Ihre nächste Verabredung in der Bleibtreustraße?“ Backfischhaft giggelnd, aber nicht ganz so behände erklommen wir die Stufen zu Dorothees Wohnung, in der schon ein Mittvierziger lächelte, der so aussah, dass man ihn in Potsdam gefragt hätte: „Wann haben Sie denn Ihre nächste Verabredung in der Bleibtreustraße?“
Es gab also die Salami aus dem KaDeWe und eine angeregte Unterhaltung. ‚Machen‘ muss man ja leider alles selber. ‚Reden‘ kann man auch über das, was man bloß gesehen oder gelesen hat. Bei Leuten, bei denen ich nicht verkehre, mutmaße ich, dass man über TV-übertragene Sportereignisse und Urlaubsfreuden, die Geschäfte und den Wahlausgang Austausch hält.
Bei Dorothee geht es eher ums Kulturelle, und um Bayreuth abzuwenden, neige ich dazu, Kinematografisches in den Vordergrund zu rücken. Das ist bei Angestellten der Filmfestspiele kein ungefährliches Terrain, so dass Dorothees sich streckenweise auf eine einzige, allerdings mehrfach wiederholte Aussage beschränkte: „Man müsste viel mehr ins Kino gehen!“
Auch ich musste dabei mein ganzes dialektisches Geschick aufbringen, damit wir uns an dem roten Faden ‚Hollywood‘ orientieren konnten, denn die ganze Zeit drohte das Gespräch in so Weitläufiges abzudriften wie: „Neulich gab es in Prenzlauer Berg diesen nordkoreanischen Film über den Gewissenskonflikt der nudelessenden Reisbauern, über den so viel in der ‚Woche‘ stand. Wer von euch hat den auch gesehen?“
Es war zweifellos ein anregender Abend, und ich war ehrlich begeistert davon, wie viele Kenntnisse ich auch über das Trivial-Kino im Dunstkreis von Meg Ryan und Al Pacino vorfand. Das Kaninchen war etwas trockener als die Konversation (ich hatte Dorothee gewarnt, den Rücken gleichzeitig mit den Keulen zu schmoren), aber mit Zimt und Nelken angemacht, so dass Dorothees Tischnachbarin mir aus der Seele sprach, als sie aufmerkte: „Es schmeckt so nach Weihnachten!“
Zum Nachtisch gab es Apfelmus mit Preiselbeeren und den Grappa von Sabine Tomzig, die früher fürs ‚Abendblatt‘ Konzertkritiken schrieb und jetzt gerne bei Dorothee logiert, wenn sie in Berlin weilt. Dorothee ist es einfach wichtig, Gutes zu tun. Da kriegt der eine ein Bett, der Zweite Ermahnungen und die Dritte Kaninchen mit Zimt. Ich würde mir wünschen, dass Dorothee kein so guter Mensch wäre und dass gute Menschen nicht so sind wie Dorothee.
Natürlich habe ich nicht nur Dorothee in Berlin getroffen.
Michael Zachow traf ich nicht nur zum ‚Galileo Galilei‘, sondern auf seinen Vorschlag hin zu der im ‚Theater am Kurfürstendamm‘ gebotenen Bühnenfassung von ‚Bullets Over Broadway‘ mit dem Travestie-Star Georgette Dee in der weiblichen Hauptrolle. Ich ärgerte mich, dass er schon Karten ganz hinten gekauft hatte, aber mein Ärger verflog, als wir über die Sitze in die vierte Reihe stiegen. Ich konnte ja nicht wissen, dass man das so macht.
Das Stück war ganz gefällig und wurde dadurch aufgewertet, dass Michael mir verriet: „Mit Jürgen könnte ich in so was nie gehen. Das wäre ihm nicht ernsthaft genug.“ Wir gingen nach der Vorstellung zu den Bögen der S-Bahn zwischen Zoo und Savignyplatz, wo derzeit etwas stattfindet, das Marina1, ihre Kinder nachahmend, ‚Da steppt der Bär‘ nennt.
Wir aßen was, redeten und ließen um uns herum den Bären steppen.
Und sonst? Ich bin viel und gern allein, aber nie einsam. Alles ist so lebendig. Mal frage ich mich, wie sich so viele Völker von solchen Spießer-Cliquen bevormunden lassen konnten, wenn ich die SED-Hinterlassenschaften betrachte. Gleichzeitig frage ich mich, ob die Frage des Sozialismus endgültig mit ‚Nein‘ beantwortet ist. Siebzig Jahre für Russland und vierzig Jahre auf deutschem Boden. Ist mit dem Zusammenbruch des Systems die Frage für immer vom Tisch? Wären andere Führer als Breschnew, Ulbricht und Ceaușescu denkbar gewesen? Hier in Berlin, im früheren Ostberlin, ist das Flair maßvoll großstädtisch, deutlich europäisch, eindeutig westlich – nein, ich glaube nicht, dass die Geschichte dem Sozialismus eine zweite Chance zubilligen wird: Das Spiel ist aus.
Mal gehe ich zu ‚Möhring‘ am Gendarmenmarkt, mal zu ‚Dressler‘ Unter den Linden; ich schreibe und beobachte zwischendurch Passanten. Die kaffeetrinkenden Leser von ‚taz‘, ‚Zeit‘ und ‚Tagesspiegel‘ haben neben dem Getränk noch etwas gemeinsam. Sie verfolgen aufmerksam Politik und Kultur in ihrem Blatt und sagen höflich: „Nein, danke“, wenn jemand, der zuvor mit der Ziehharmonika belästigt hat, den Hut hinhält. Ich habe immer Markstücke dabei, wie alte Frauen Taubenfutter. Der Klarinettenspieler kriegt eins, der Obdachlosenzeitungsverkäufer kriegt eins, ein Duo Geige/Cello kriegt eins, bloß die schmutzige Zigeunerin mit Kleinkind vor der Brust und ausgestreckter Kralle, die kriegt gar nichts.
Einmal war ich auch mit mir allein bei ‚Lutter & Wegner‘, abends gegen zehn, und wurde prompt an einen Katzentisch am Gully gebeten. Am nächsten Tisch, hart am Rinnstein, nahm ein etwa Sechzigjähriger Platz und bestellte ein Bier, gewiss nicht sein erstes. Einer von uns warf dem anderen einen Satz herüber, ein Gegensatz kam dazu, es entstand ein Gespräch, und er fragte, ob er sich einen Augenblick zu mir setzen dürfe. Er war Bauingenieur und überwiegend mit Restaurierungen befasst. Er erzählte davon, wie er Lärchenholz für die Marienkirche in Frankfurt an der Oder beschafft hatte und wie die Stahlbetonpfeiler des Viadukts der Warschauer Brücke konstruiert sind.
Zum Berliner Schloss fragte er sich, was denn da wohl reinsolle, wenn man es wiederaufbauen würde. „Der Alte Fritz kommt nicht zurück.“
Dorothee ist auch ganz gegen das Schloss, weil sie fürchtet, sonst als altmodisch zu gelten. Klar, die Loveparade findet sie ‚ganz, ganz wichtig‘, weil sie gelesen hat, es gäbe so wenig junge Leute und die müssten sich doch irgendwie artikulieren. Wichtiger, als eine eigene Meinung zu haben, ist es für Dorothee, eine moderne Meinung zu haben, da ist ihr dann von Donaueschingen bis zum Kulturzentrum Tacheles alles recht.
Der Bauingenieur sagte: „Früher, in der DDR, wusste man, wogegen man kämpfte: Das war die Partei. Heute ist der Behördenapparat so undurchsichtig, dass man nicht mal mehr erkennbare Gegner hat.“
Einmal hatte er einen Vortrag über Saint-Exupéry halten sollen und dessen Satz zitiert: ‚Wenn einer einen Spatenstich tut, dann will er wissen, wofür.‘ Daraufhin wurde er stundenlang von der Stasi verhört, was er damit gemeint habe. Das klänge nach Kritik.
Am Nebentisch knutschte ein junges Paar. Das unterhielt sich leise, plötzlich schrie er: „Wie kommt es dann, dass ich diese Sehnsucht hab’, hör mir zu, wie kommt es?“
Der Bauingenieur erzählte von der Ausbildung in der DDR: Vor dem Diplom musste jeder kuschen. Wer seine Staatstreue nicht bereit war zu dokumentieren, bekam seinen Abschluss nicht, ganz einfach. So log man eben. Plötzlich sagte er: „Ich würde gerne mal die letzten drei Sätze hören, die Sie geschrieben haben.“ Ich dachte: „O Gott, was hab’ ich denn gerade den Rechenkästchen anvertraut?“ Ich sah auf meinen Block und las beherzt laut, was da stand.
„Oh, entschuldigen Sie!“, sagte er, „Sie sind Schriftsteller. Das wusste ich ja nicht.“
Es war schon nach Mitternacht, das Paar neben uns knutschte wieder, dann brüllte er noch mal.
Die Kellner hatten kassiert, uns vieren unsere Gläser belassen und die Tür abgeschlossen.
„Schriftsteller“, sagte der Bauingenieur, „jede Aufführung musste bei uns genehmigt werden. ‚Anatevka‘ war sehr kritisch wegen ‚If I were a rich man‘. Bei ‚Mahagonny‘ gab es Szenenapplaus an der Stelle gegen die Obrigkeit, daraufhin wurde das Stück abgesetzt – schreib das auf, Schriftsteller!“
Die Gebäude standen hoch und still. Das Paar stand auf, es nickte uns zu und ging, eng umschlungen.
Es war halb zwei, warm und ganz ruhig. Wir tauschten Namen und Telefonnummern, aber wir haben nichts mehr voneinander gehört und gewollt.
Who is who (Akkordeon)
1 – Marina
[maˈʁiːna]
Marina ist die ältere Tochter von Guntrams Bruder Hasso, also meine Cousine ersten Grades. Sie lebt mit ihrem Mann in Zehlendorf.

Titelgrafik mit Material von Shutterstock: Alexxx Shmel (Farbpalette)
#1.10 | Auf der Straße und auf Besuch#1.12 | Ein schönes Geschenk


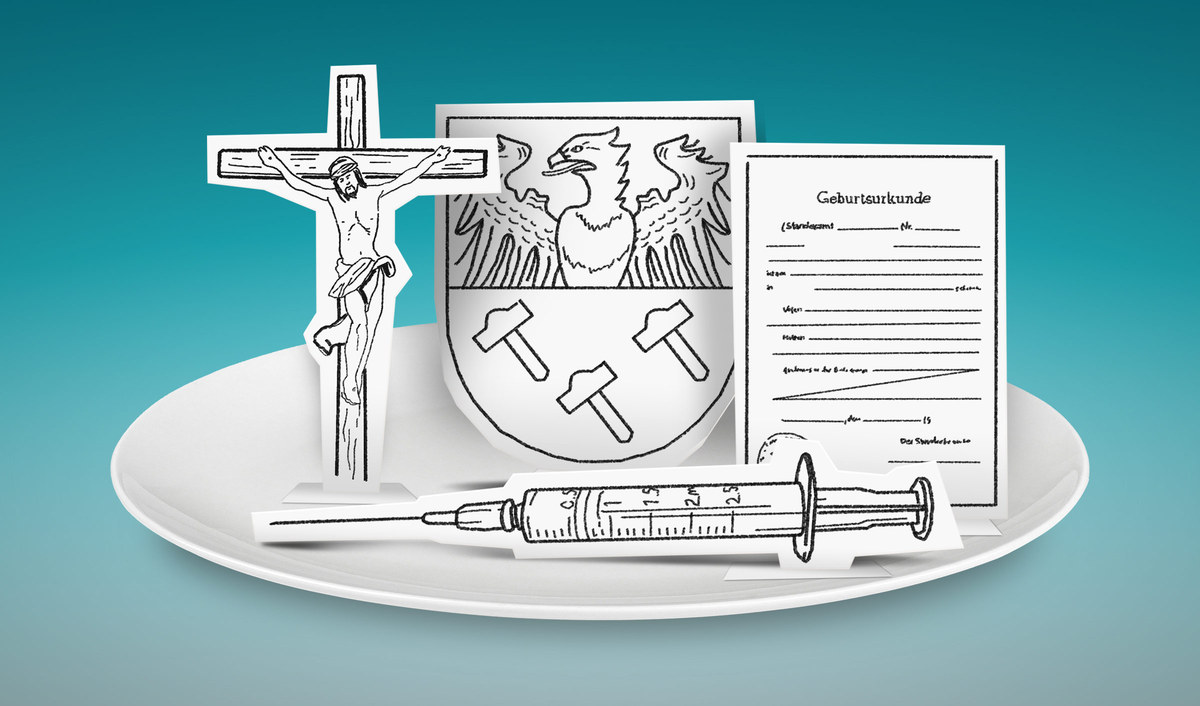
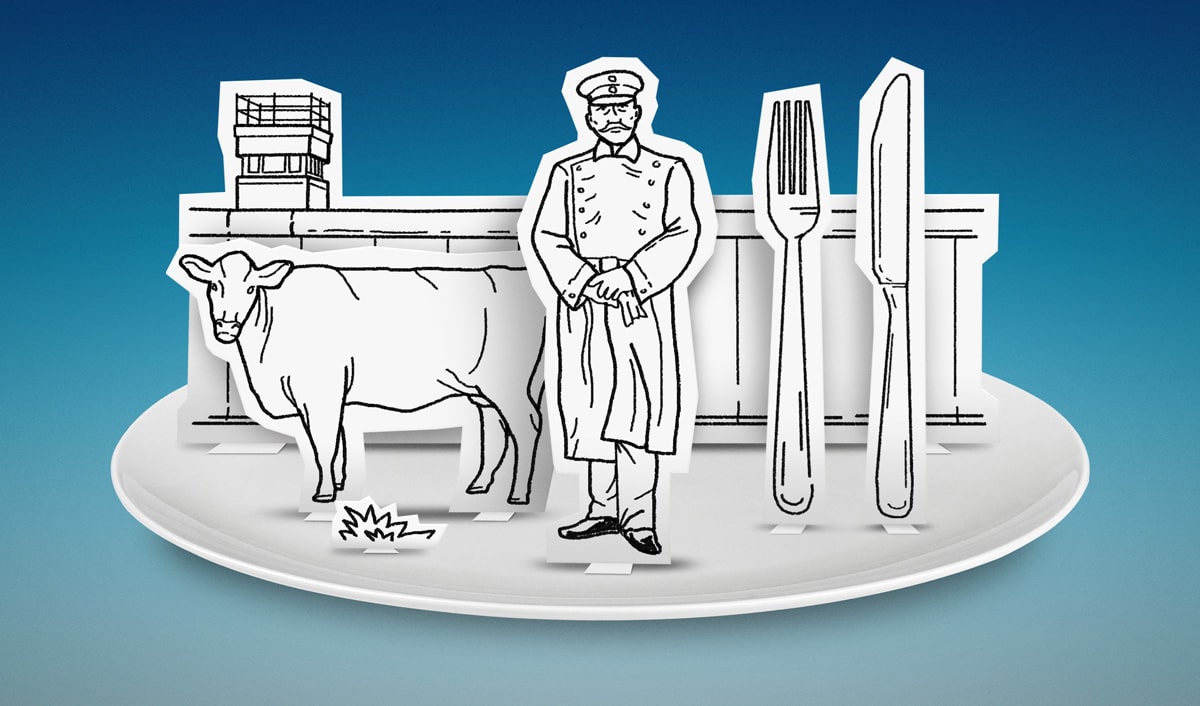


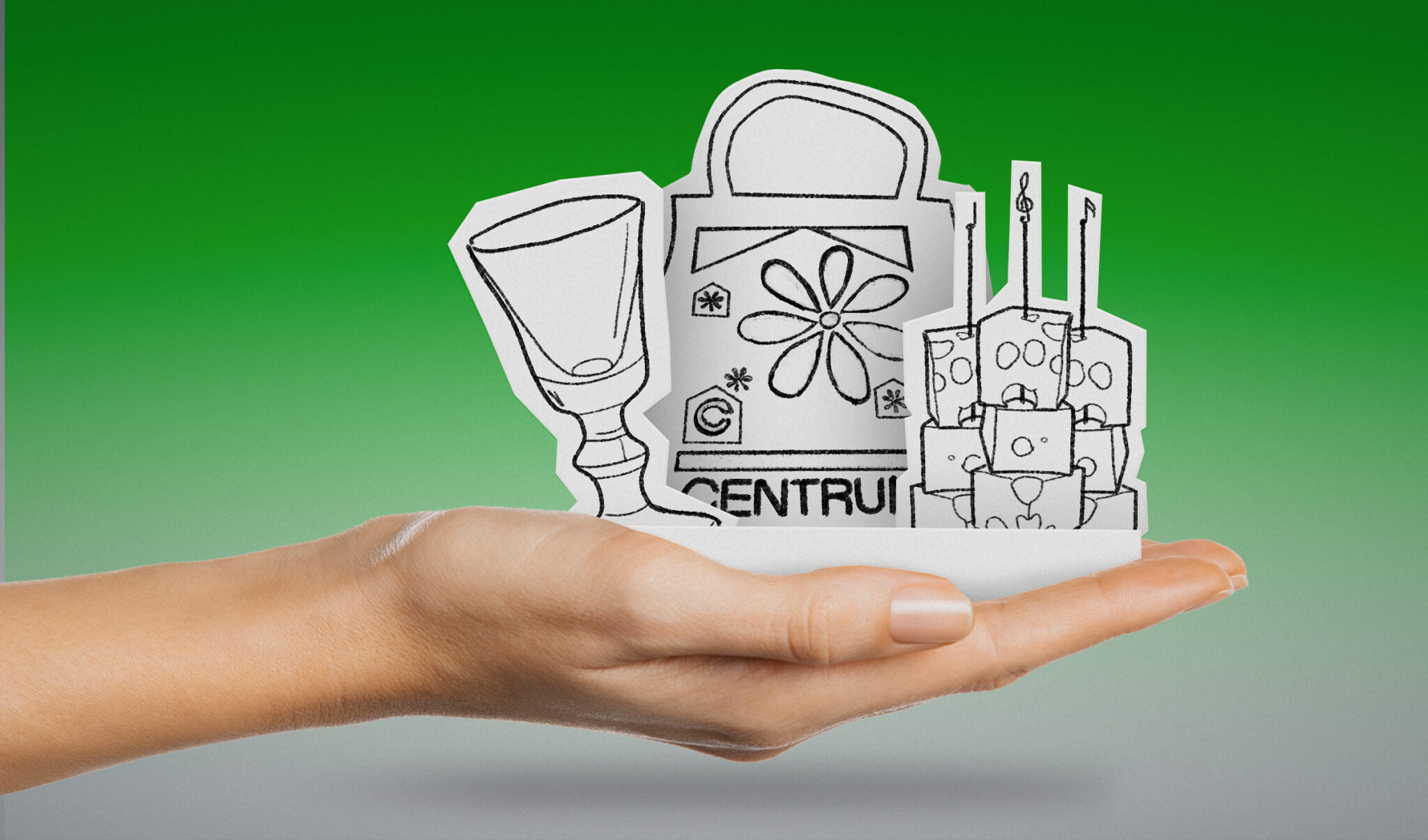





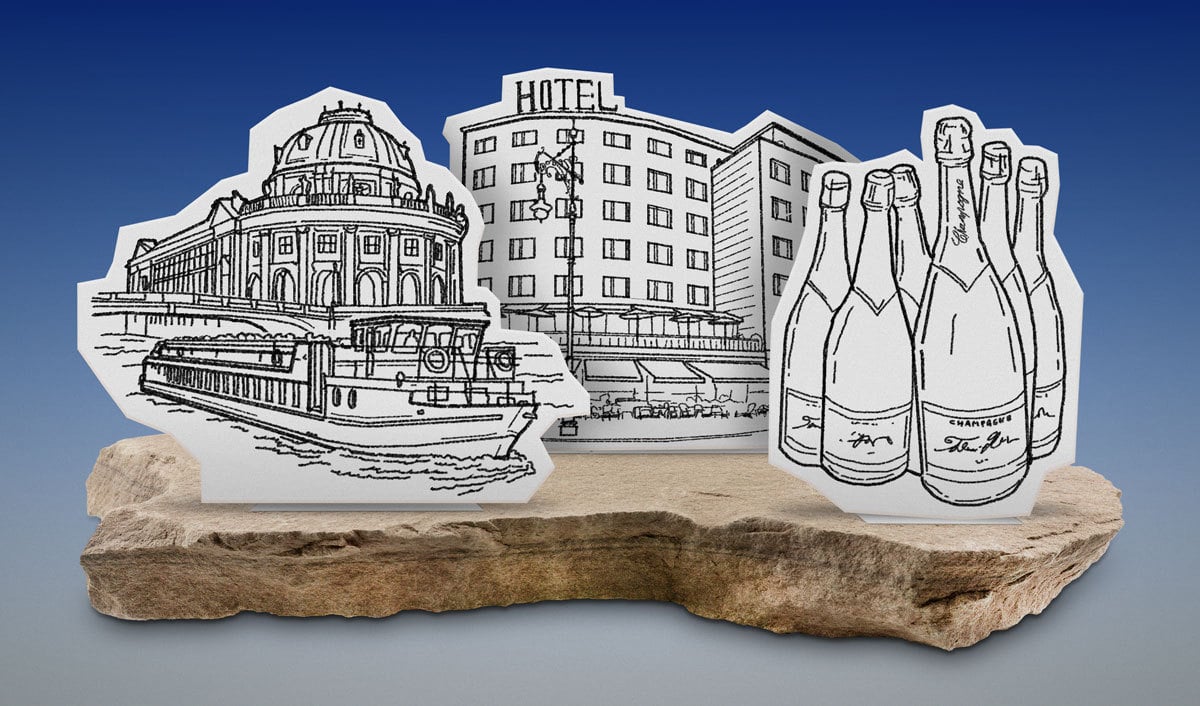


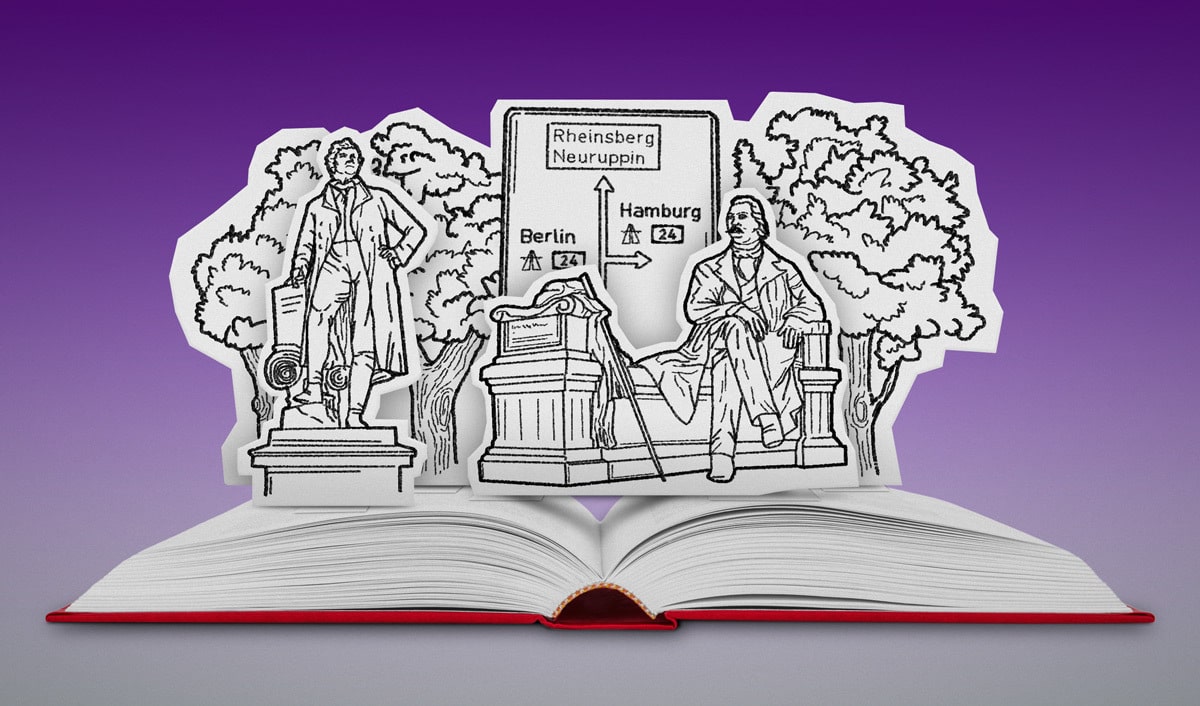
Man müsste wirklich wieder viel mehr ins Kino gehen! Jetzt wo man endlich wieder kann.
Ich war ja überrascht, dass in Berlin sogar das Filmfestival stattgefunden hat. Und das ohne größere Zwischenfälle oder Corona-Dramen. Vielleicht kommt die Normalität ja doch langsam zurück.
Frau Huppert konnte wegen COVID nicht anwesend sein. Das war sicher nicht geplant. Aber Sie haben ja schon recht. Es hätte schnell zu einem Fiasko werden können. Das wurder der Berlinale zum Glück erspart.
Die Notmalität kommt leider so bald nicht zurück. Für keinen von uns.
Ich wollte auch schon sagen … gerade mit Hinblick auf Russland und die Ukraine … das sieht momentan in keiner Hinsicht nach Normalität aus.
Der Alte Fritz kommt wirklich nicht zurück und Dorothee scheint recht behalten zu haben. Schließlich ist das neue Berliner Stadtschloss zwar ganz hübsch und bietet sich für das ein oder andere Touristenfoto an, aber letztendlich braucht man es für in der Stadt wirklich nicht. Bisher gab es dort außer Menschenmengen nichts interessantes zu sehen.
Das war der Herr aus dem Lutter & Wegner, nicht Dorothee. Aber ansonsten gebe ich Ihnen recht.
Ich finde das Fake-Schloss einfach hübscher, als ich den Palast der Republik fand.
Hübsch finde ich es eigentlich auch. Aber reicht das als Grund um so einen riesigen Kasten aufzubauen?
Wo soll denn der ‚Prachtboulevard Unter den Linden‘ hinführen? Ins Nichts?
er führt doch schon zum brandenburger tor. und auf der anderen seite gibt es die museumsinsel und den berliner dom. alles sehr viel eindrucksvoller.
Manchmal reicht ein nettes Gespräch und das Austauschen der Nummern ja auch schon. Alleine als Zeichen was alles sein könnte, wenn man denn wollte.
So eine Situation hatte ich viel zu lange nicht mehr.
Man muss sich drauf einlassen.
Wohl wahr. Und dafür muss nicht zuletzt auch einfach der Moment stimmen. Nicht jede Situation lässt so etwas zu.
Der Sozialismus wird sicher nicht wiederkommen. Die Gefahr des Faschismus bleibt dagegen immer bestehen. Auch wenn man es sich viel zu lange in falscher Sicherheit gemütlich gemacht hat.
Kann das bei uns auch noch einmal passieren? Die Republikaner in den USA zeigen ja, dass vieles möglich ist, was man für unmöglich gehalten hatte.
Was versteht man denn heute unter Faschismus? Übersteigerten Nationalstolz und Fremdenfeindlichkeit mit Gewaltbereitschaft. Ja, das wird es wohl überall immer wieder geben..
Gepaart mit ein bisschen Diktatur und Größenwahn. Siehe Erdogan, Orbán, Trump.
Meistens ist Reden tatsächlich leichter als Machen. Vor allem wenn man nicht mal selber denkt, sondern nachplappert, was jemand anderes vor einem bzw. für einen gedacht hat. Aber irgendwann muss man schon auch selbst ran.
Nein, Feiglinge müssen erst gezwungen werden.
‚Allein, aber nicht einsam‘ ist mir auch lieb. Es gibt ja so viel zu tun und zu sehen und zu denken, auch oder gerade wenn man alleine ist.
Das funktioniert allerdings besser, wenn man weiss, dass man Freunde und Familie hat, auf die man bei Bedarf zählen kann. Damit man eben nicht einsam ist.
Ja klar. Es macht natürlich einen Unterschied ob man sich entscheidet allein zu sein oder ob man alleingelassen wird.
Es gibt Menschen, die es nicht ertragen können, allein zu sein. Die werden in (schlechter?) Gesellschaft auch nicht glücklich.
Dann gibt es Menschen, die können Gesellschaft nicht aushalten. Auch schlimm, aber besser.
Das ist ja ein wichtiger Grund für viele Ehen. Alleine geht irgendwie nicht, der Partner ist auch schwer auszuhalten … und trotzdem bleibt man zusammen, weil dann alles zumindest ein wenig einfacher ist. Oder vielleicht nicht alles, aber vieles.
Ich finde man macht sich da auch oft etwas vor. Vieles ist nämlich auch deutlich komplizierter, wenn man sich nonstop mit jemandem gegen das eigene Empfinden arrangieren muss.
Wenn man sich die meisten Straßenmusiker anhört, dann trifft belästigt es ziemlich genau auf den Punkt. Ich habe nichts dagegen ein bisschen Kleingeld abzugeben. Aber oft sind die Musiker so penetrant mit ihrer schlechten Musik, dass mir die Laune vergeht auszuhelfen.
Die Musik ist da doch auch nur Mittel zum Glück. Die Leute brauchen Geld und Unterstützung. Ich glaube nicht, dass sie in ihrer Situation Muße haben an ihrer musikalischen Performance zu arbeiten.
Es gibt darunter wahre Künstler und Nichtskönner. Ich finde es ehrenwerter, mit einer mittelmäßigen Darbietung auf sich aufmerksam zu machen, als bloß die Hand aufzuhalten.
Hmm, es kommt wirklich drauf an. Aber manchmal ist es mir lieber man spricht mich einfach freundlich an anstatt z.B. in der U-Bahn oder während eines Restaurantbesuchs zu musizieren. Das ist mir oft zu aufdringlich.
Im spanischen Lokal passt Flamenco. In der U-Bahn ist Fly Me To The Moon etwas viel verlangt.