1Ausführlicher Wortlaut: zeno.org

Ich war zu früh an der Deutschen Oper an der Bismarckstraße, die drei Minuten später eintreffende Dorothee bloß überpünktlich. Endlose Schlangen vor der Kasse. „Siehst du“, sagte Dorothee, „war doch gut, dass ich schon gestern hier war.“ Dann begann Dorothee sofort mit dem Feilschen um das Eintrittsgeld.
„Was bekommst du?“, fragte ich.
„Nein. Ich lade dich ein.“
„Nein, auf keinen Fall! Ich bezahle dir die Karte und hinterher lad’ ich dich zum Essen ein.“
Dieser Streit ging nach der Vorstellung über der Speisekarte weiter, bis ich nachgab und sagte: „Also gut! Ich lasse mich zähneknirschend von dir zum Kulturprogramm einladen. Und jetzt lade ich dich zum Essen ein.“ Dieser Kompromiss wurde murrend akzeptiert, aber gleich wieder infrage gestellt durch die Bemerkung: „Ich esse aber höchstens einen Salat.“
Der an einer auch im juristischen Sinne gültigen Bestellung interessierte Kellner wurde nun Zeuge unserer Auseinandersetzung, als dessen Ausgang ich ihn bat, uns eine Dorade (Dorothee: „Mein Lieblingsfisch, aber das ist mir zu viel.“) zu teilen und anschließend der Dame Spagetti mit Pilzen und mir Kaninchen im Kräutersud zu bringen. Bevor ich dann das erste Stück Karnickel in den Mund schob, sagte Dorothee schon: „Ich werd’ dir mal Kaninchen machen.“
„Wie ist denn nun deine Deutung der Inszenierung?“, fragte ich sie.
„Ja, also es war sehr eindrucksvoll. Man soll das auch gar nicht zerpflücken.“
„Und was hast du dir bei der Inszenierung vorgestellt?“
„Na ja, Boatpeople.“
„Und der Granitquader mit den eisernen Sprossen?“
„Ja, das war das Schiff.“
In der Tat hatte auch in der Zeitung das Wort ‚Boatpeople‘ gestanden. Ich denke dann eigentlich an Vietnam.
Begonnen hatte das Spektakel damit, dass, nachdem der Beifall für Christian Thielemann abgeebbt war, sich sofort der Vorhang geöffnet hatte und eine sehr, sehr dicke Frau auf die Bühne gekommen war, mit diesem verzögerten, ahnungsschwangeren Gang, wie ihn nur Opernsänger haben, die bereits wissen, dass sie den letzten Akt nicht überleben werden. Die hatte nun das gesamte Vorspiel lang in die Rauchschwaden des Trockeneises gestarrt und war dann, gerade noch rechtzeitig, bevor das Gesinge losging, hinter den Vorhang verschwunden.
Im zweiten Akt war sie dann aber als Senta wieder zur Stelle, und man fragte sich: Was macht die fette Matrone bloß zwischen all den jungen Mädchen, wenn sie nicht mal mitsingt, sondern bloß spinnt?
„Also, ich glaube, dieses steinerne Viereck sollte die Rampe von Auschwitz sein, und die Menschen, die aus dem Innern quollen, waren die Verschleppten, die zum Schluss, von Senta befreit, ins Licht traten“, riet ich.
„Ach!“, sagte Dorothee perplex. „Da muss doch was im Programmheft stehen.“ Sie blätterte es auf. Erster Beitrag – Shelley: ‚Der ewige Jude‘. Zweiter Beitrag – Gershom Scholem: ‚Über die Erlösung‘.
Das machte meine Hoffnung zunichte, ich hätte unrecht.
„Gefallen tut mir das nicht“, sagte ich, „denn das heißt ja, dass die Juden durch das reine, germanisch-gotische Mädchen erlöst werden.“
„Warum nicht?“, fragte Dorothee. „Es gab auch sehr anständige Deutsche, die den Juden sehr geholfen haben.“
Dazu fiel mir dann nichts mehr ein. Erst heute schlug ich selbst das Programmheft auf und las ein Nietzsche-Zitat: „Irgendwer will bei Wagner immer erlöst sein: bald ein Männlein, bald ein Fräulein – dies ist sein Problem. Wer lehrte uns, wenn nicht Wagner, daß die Unschuld mit Vorliebe interessante Sünder erlöst? […] Was wird aus dem ‚ewigen Juden‘, den ein Weib anbetet und festmacht? Er hört bloß auf, ewig zu sein. Er […] geht uns nichts mehr an. – Ins Wirkliche übersetzt: Die Gefahr der Künstler, der Genies – und das sind ja die ‚ewigen Juden‘ – liegt im Weibe […] Fast keiner hat Charakter genug, um nicht verdorben – ‚erlöst‘ zu werden, wenn er sich als Gott behandelt fühlt […]“1 – Christian Thielemann schon. Oder doch nicht? Er kam im Sweatshirt ins Lokal, ließ sich beklatschen und ging zu einem Tisch außerhalb meiner Sichtweite.
„Er geht überall mit seiner Mutter hin. Und sie sagt überall: ‚Ich bin die Mutter‘“, klärte Dorothee mich auf. Als ich später vom Klo kam, sagte Dorothee: „Er ist gerade gegangen. Mit seiner Mutter und vier alten Frauen, schrecklich.“ Dann ging sie selbst aufs Klo.
Zum selben Zeitpunkt löste sich der Tisch neben uns auf. Der am wenigsten Hübsche drehte sich zu mir um, begrüßte mich stürmisch und sagte: „Das ist Herr Rinke!“ So identifiziert schwante mir, dass auch ich ihn schon mal gesehen hatte. Während er unaufhörlich auf mich einredete und die drei anderen Herren längst vor die Tür gegangen waren, festigte sich in mir der Verdacht, dass es sich um den Gatten einer Sängerin handelte, die mein für Aufnahmen zuständiger Kollege Aman mal als die Callas des Jahres 2000 sah. Dieser Verdacht erhärtete sich noch, als er sagte: „Wir machen ja gerade den ‚Holländer‘ in Bayreuth. Ich bin heute extra rübergekommen, um die Vorstellung zu sehen.“
Inzwischen war Dorothee zurückgekehrt und hatte, obwohl eigentlich auch wir hatten gehen wollen, angesichts des auf mich einströmenden Wort-Wasserfalls erneut Platz genommen. Ich machte gar nicht erst den Versuch, originell zu sein, sondern griff zum ältesten Trick der Welt: „Sie kennen sich doch?“
„Nein.“
„Nein.“
„Das ist Dorothee Koehler.“ (Ich wusste zwar, welche Reihenfolge in der Vorstellung sich gehört, aber nicht seinen Namen. Ich war froh, dass ich wusste, wie Dorothee hieß.)
„Aah, ich hab’ schon viel von Ihnen gehört. Schwarz. Ich bin der Ehemann von Cheryl Studer“, beeilte er sich.
„Ach, singt die noch?“, fragte Dorothee irritiert. „Aääh“, fuhr ich dazwischen, „grüßen Sie Cheryl ganz herzlich von mir, falls sie sich noch an mich erinnert.“
„Aber ich bitte Sie, Herr Rinke! Wenn ich mich sogar an Sie erinnere!“
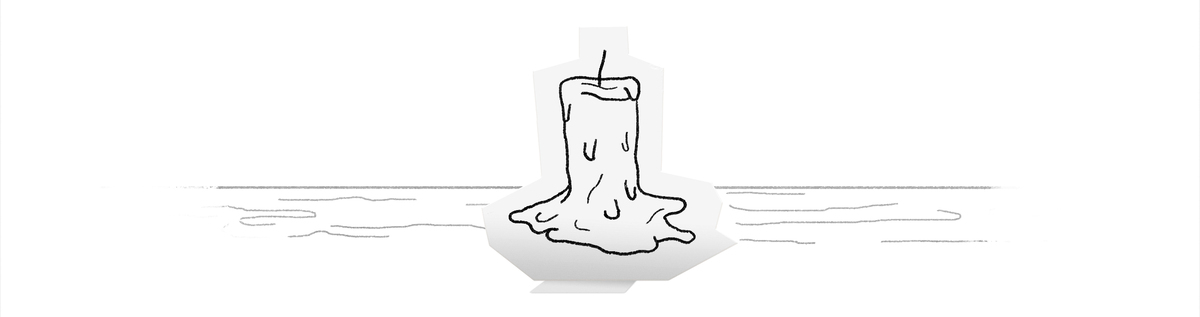
Titelgrafik mit Material von Shutterstock: Zyn Chakrapong (Bühne)

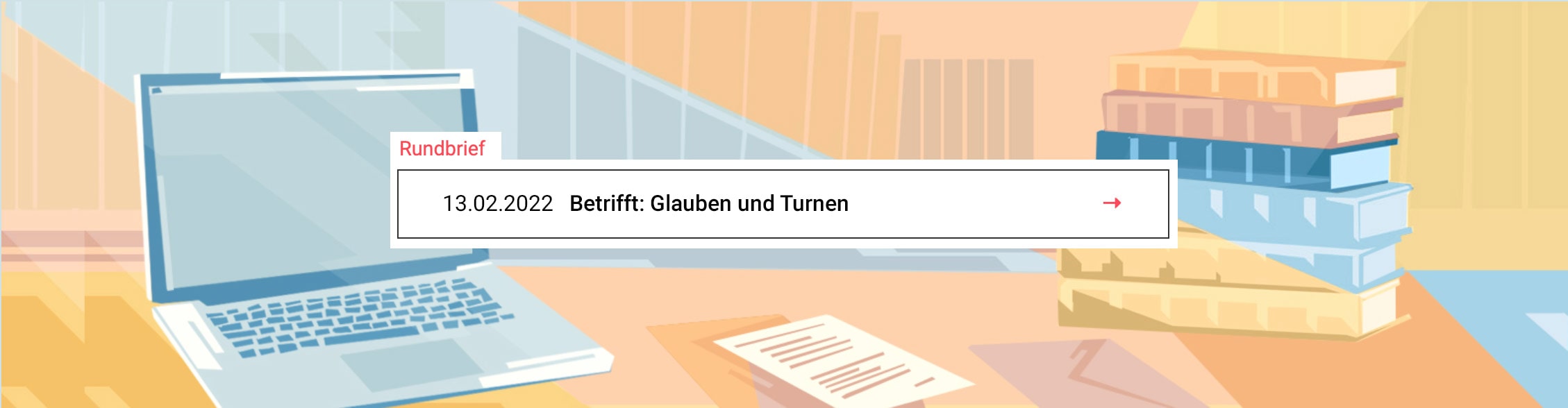
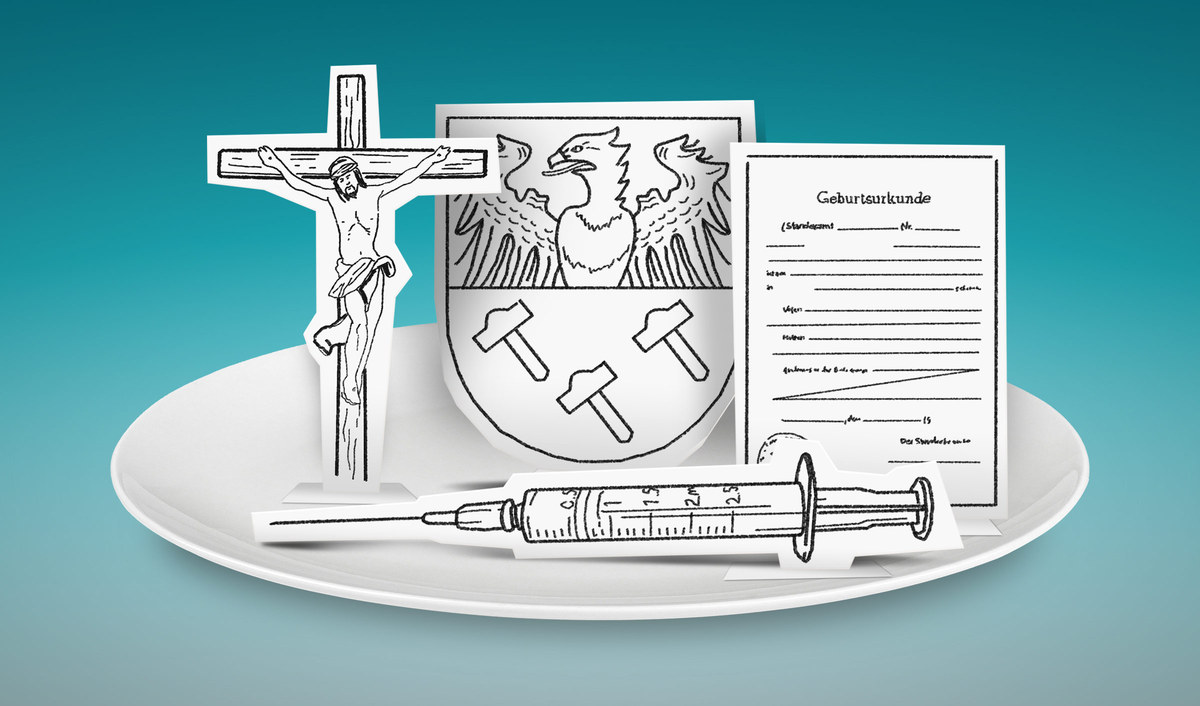
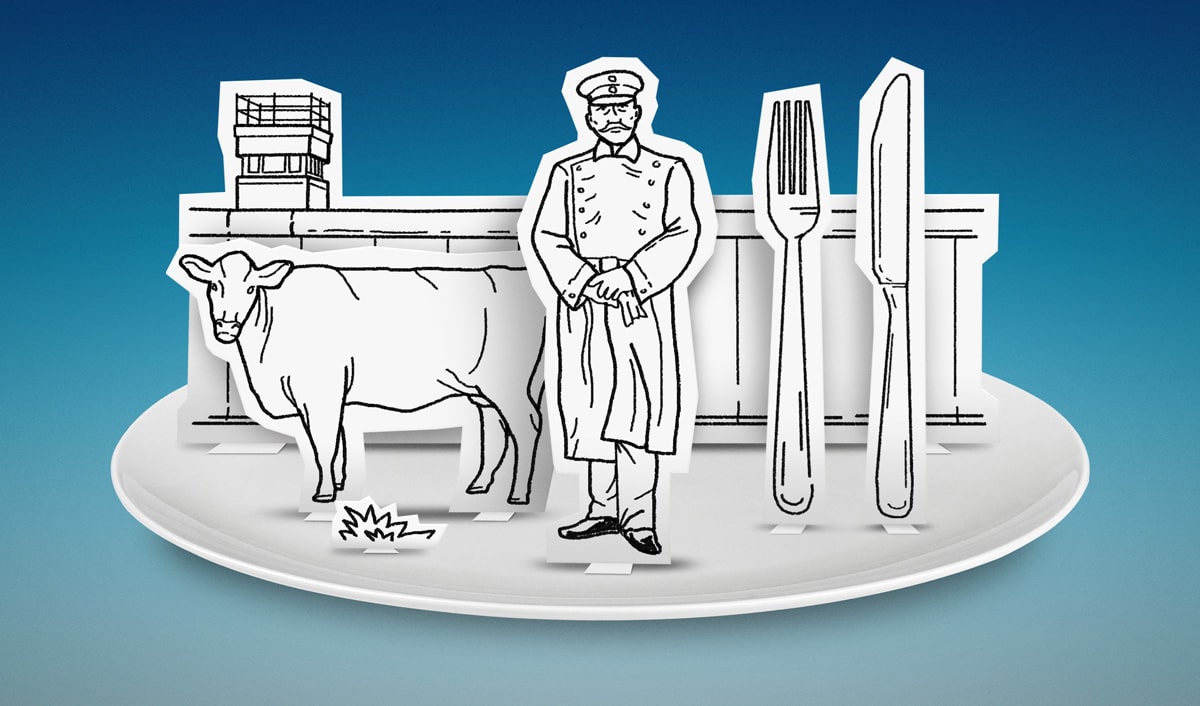


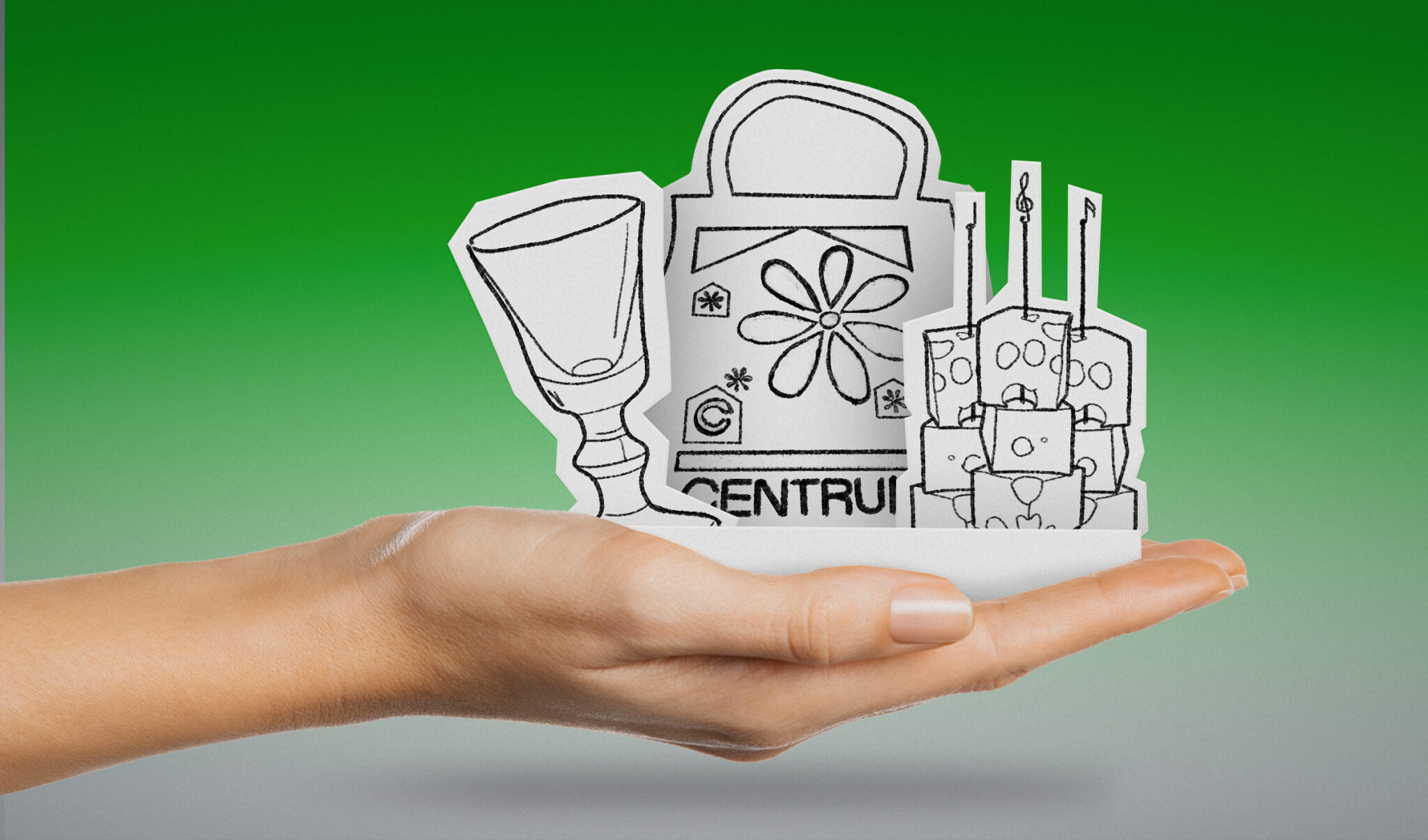





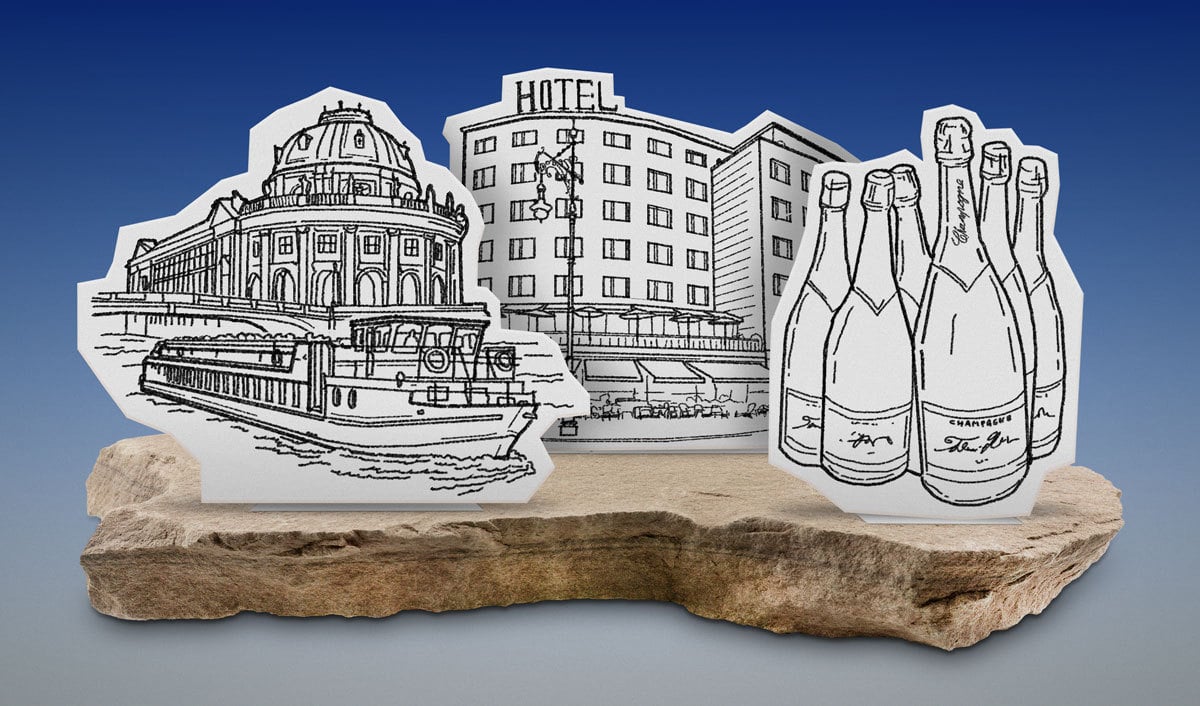


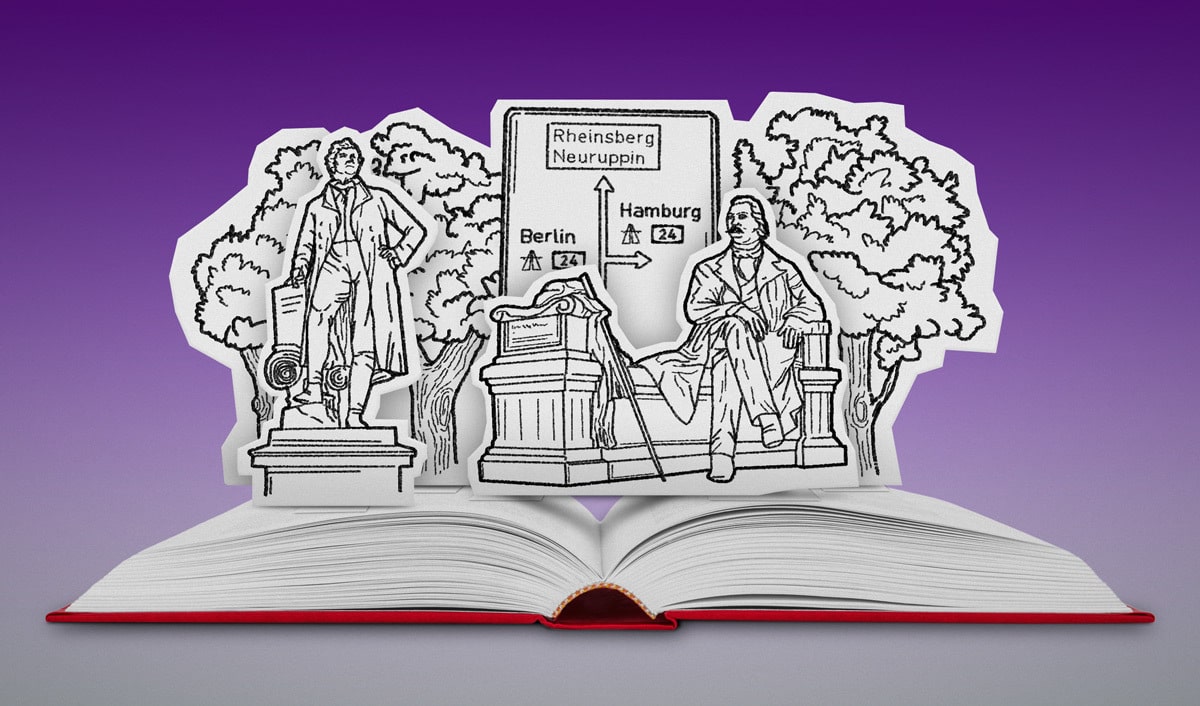
Mir fallen beim Vorstellen von Bekannten, die untereinander keinerlei Verbindung haben oft die Namen nicht ein. Einzeln ist das kein Problem, aber die Kombination überfordert mich. Keine Ahnung was das ist.
Wenn ich die Menschen wirklich kenne, passiert mir das nicht. Aber wenn es sich nur um eine ganz flüchtige Bekanntschaft handelt, ja das kann mitunter unangenehm werden.
Der Leisungsdruck lähmt bisweilen das Hirn. Ich kannte Gedächtniskünstler, gerade in meiner Branche, die jeden Namen sofort behielten. Ich selbst habe mir manchmal Zettelchen ins Jacket gesteckt, um Backstage präpariert zu sein.
Auch keine schlechte Methode. Da muss man aber wirklich gut vorbereitet sein. Also in der Hinsicht wen man möglicherweise alles treffen könnte.
Naja, man weiss ja vorab zumindest auf welche Veranstaltung man geht. Das grenzt die möglichen Gäste ja ein.
Schlimm sind ja nur die, die erwarten können, dass man ihren Namen weiß. Aber Opus-Zahlen liegen wir offenbar mehr.
Am schönsten ist es doch sogar wenn unterschiedliche Deutungen so einer Inszenierung möglich sind. Was kümmert es denn am Ende ob man eine bestimmte Variation hätte sehen und verstehen sollen.
Ich habe schlüssige Erklärungen ganz gern. Ich möchte wissen, was sich Beethoven bei einer Sonate gedacht hat und was der Interpret. Für durchrauschende Fahrstuhlmusik bin ich nicht so empfänglich.
Da schließe ich mich an. Ansonsten wäre das alles ja auch reichlich beliebig.
„Mit seiner Mutter und vier alten Frauen“ 😂
Naja, vielleicht war das eine bessere Gesellschaft als man auf den ersten Blick denken würde.
Als Dorothee das sagte, war sie stramm über siebzig.
Die Deutsche Oper ist so riesig und unpersönlich. Es hat mir nie so richtig gefallen dort…
Der Charme der sechziger Jahre. Wenn es dann auf der Bühne auch monumental trostlos zugeht, hat man die perfekte Einheit von Inszenierung und Umgebung.
Solche Unorte gibt es ja überall. Nicht nur in Berlin. Da kann man sich wieder streiten was man davon abreißen will und was (wenn auch hässlich) geschichtlich doch noch interessant bleibt.
Dass sich eine moderne Inszenierung sich nicht auf die Nazis bezieht, ist ja auch die große Ausnahme.
Ach was. Die Aussage ist genauso klischeehaft wie der Nazibezug selbst.
Der Bezug auf etwas zeitgeschichtlich Bedeutungsvolles wirkt aber in seiner belehrenden Attitüde oft mehr verkrampft modern als schlüssig.
Da gibt es wohl kein grundsätzliches richtig und falsch. Wer Don Giovanni auf dem Parteitag der AfD spielen lässt hat sicher einen Knall. Wer dagegen behauptet wir lebten immer noch im Jahre 1787 wohl auch.
Rokoko-Kostüme wirken auf mich zeitloser als T-Shirt und Jeans, wenn es um 250 Jahre alte Musik geht und nicht um Rap.
Vor allem wenn ein fünfzigjähriger gesetzter Bariton in zerrissenen Jeans auftritt…
Was wäre eine Oper ohne bedeutungsschwangere Auftritte. 😉
Ist das das, was die Traditionalisten bei modernen Inszenierungen vermissen?
Dass Opernsänger nicht fett sein müssen und wie Jahrmarktsfiguren agieren, hat sich glücklicherweise durchgesetzt. Bei meinen frühen Opernerlebnissen Anfang der sechziger Jahre habe ich noch manche Vorstellung durchgelacht bis zum Ende, wenn massige Violettas an Schwindsucht starben.
haha! manchmal sind die besetzungslisten wirklich etwas seltsam. auch heute noch. gerade was das alter angeht, passt da ja oft so einiges nicht. aber man hat wohl auch wenig auswahl an ganz jungen und dennoch unglaublich ausgereiften opernsänger*innen.
Wenn ich nur höre, erlebe ich natürlich nur die Stimme, aber wenn ich auch eine Bühne gucke, ist mir Banausen die glaubhafte Darstellung wichtiger als der Belcanto.
Im Programmheft steht nur leider nicht immer was man auf der Bühne sieht. Es passiert ja gerne, dass man nach dem Lesen noch ratloser als vorher ist.
Ratlos bin ich eigentlich nie. Meine Irrtümer nehme ich dabei in kauf.
So mache ich das auch. Man sieht und versteht und empfindet und denkt sich doch immer etwas. Oper und Theater sind ja keine Rätsel, die man entschlüsseln muss sondern eigentlich überaus sinnliche Veranstaltungen.
Rätsel nicht, aber man will ja auch nicht völlig daneben liegen. Der Regisseur denkt sich ja etwas bei dem was er da auf die Bühne bringt.
Ich bin so eitel zu denken, wenn ich etwas gar nicht verstehe, liegt es weniger an meiner Blödheit als an der Verblasenheit des Regisseurs.
Auch wieder wahr. Schließlich sollte man ja meinen, dass so ein Regisseur im Sinn hat, das Publikum auf seine Reise mitzunehmen und nicht verdutzt im Saal sitzen zu lassen.