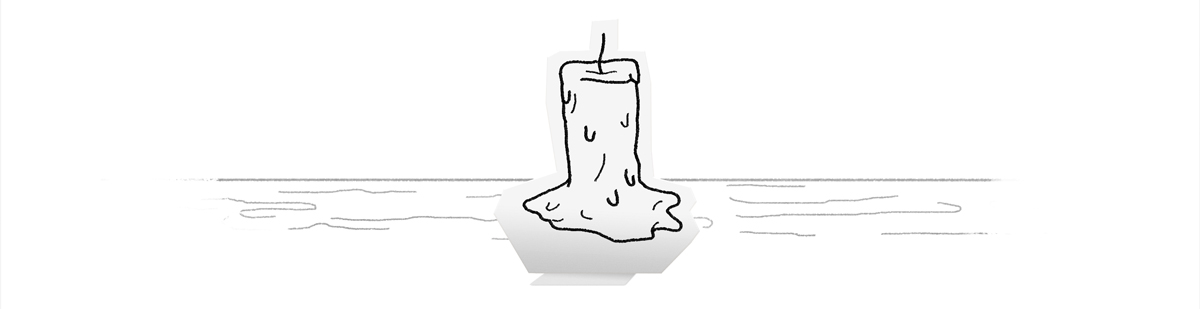

Das eigentliche Berlin-Erlebnis besteht darin, auf den Fahrstuhlknopf zu drücken, acht Sekunden abwärtszufahren, einen acht Meter langen Gang zu überwinden und durch eine Tür zu treten. Dann bin ich in Berlin. Geld krieg’ ich gleich im nächsten Eingang, eins weiter ist der Bäcker, auf dessen Tüten steht, wie toll seine Brote und Kuchen seien. Ich weiß es zwar besser, aber er ist immer noch im selben Haus, in dem mein Bett steht, und hat das Glück großer Beliebtheit. Büroangestellte tragen tablettweise seinen Bienenstich weg, der mit einer feisten, gelblichen Masse gefüllt ist, die entfernt nach Leim schmeckt, und an kleinen Tischen hocken Menschen, die sich die Zeit nehmen, seine mit Lieblosigkeit belegten Brötchen zu zerkauen.
Auf die Straße zu treten und gleich in der Stadt zu sein!
An jeder Ecke ist noch was abgebröckelt, an jeder Kreuzung fehlt noch ein Haus, Fußgängerwege und Fahrbahnen enden immer in was Aufgebuddeltem, wo Rohre verlegt werden. Die Friedrichstraße erinnert an ein potemkinsches Dorf, weil nach vorn und nach hinten, nach rechts und nach links alle Bemühungen im Sande, in Ruinen oder in Plattenbauten versinken. Aber: Was für ein Aufbruch! Nichts ist, aber alles wird. Meine Ungeduld strebt immer nach Fertigem, das es hier nicht gibt, doch wie wunderbar, dass es meine Ungeduld wieder gibt! Kein besseres Klima, um Hand anzulegen, hochzubauen, den Verstand und die Seele aufzurüsten, ist denkbar. Die Lethargie des Hoffnungslosen ist überwunden, die Befriedigung des Fertigen noch nicht erreicht. Heute muss mehr sein als Gestern, und Morgen darf sich nicht auf dem Heute ausruhen. Weiter, weiter! Das steckt an.
Es ist das Gegenteil von Othmarschen, wo man jeden Morgen nur hofft, dass alles beim Alten bleibt, denn Neues hieße dort: mehr Fahrbahnverengungen, mehr Ampeln, mehr Dreifamilienhäuser. Hier heißt Neues: mehr Abschaffung von Zerstörung, mehr Leben, mehr Stadt.
Noch läuft man ein bisschen wie durch Kulisse, aber man weiß: Die Komparserie steht schon bereit, um die Bühne zu überschwemmen, nicht um im Häusermeer abzusaufen, sondern um wiederzuerwecken, was scheintot gewesen war.
Dafür, dass ich nicht in Selbstanbetung versinke, sorgt Dorothee. Sie deckt einen so mit Göttern, Götzen und Goldenen Kälbern ein, dass es Mühe macht, die Sündenböcke und die Trojanischen Pferde auseinanderzuhalten.
Das prominenteste Pferd in ihrem Stall war Bert Brecht, wer traut sich da im Jubiläumsjahr, hinter seinen Mauern der Ignoranz auszuharren? Man lässt Pegasus eintraben, und aus seinem Bauch steigt Dorothee und überwältigt einen mit Theaterbesuchen und Ausstellungen. Sich da nostalgisch an den Belagerungszustand zurückzuschwärmen, währenddessen man sich noch wüstere Abenteuer hat ausmalen können als den Genuss spröder, von der Wirklichkeit überholter Lehrstücke, untergräbt bloß das Hochgefühl aufnahmebereiten Lebens.
Wir saßen in der ‚Maßnahme‘. Zum ersten Mal im Theater am Schiffbauerdamm, inzwischen Brecht-Ensemble. Ich wusste, woher auch immer, dass dieses erst von Brecht selbst und dann von seinen Erben bis vor Kurzem gesperrte Stück die Bibel von Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof gewesen war. „Woher weißt du so was immer?“, fragte Dorothee hinterher neidisch; sie hatte meine Deutung des ‚Holländers‘ noch nicht ganz überwunden, und ich verstehe sie, schließlich liest sie täglich fünf Zeitungen und ich keine. Das ist, als ob ein Archäologe jahrelang Erdschichten abträgt und ein Tourist stolpert über die Mumie.
‚Die Maßnahme‘ ist streng und pausenlos, sympathisch kurz und ein Oratorium. Gut in sehr frugale Szene gesetzt, die Eisler-Musik atmet – präziser: erstickt – unsinnlichen Kurt Weill.
Sartre hat das Thema des zum höheren Wohl der Partei mit seiner Auslöschung einverstandenen Genossen bühnenwirksamer abgehandelt, weil er nicht nur schulmeistern, sondern auch unterhalten wollte, aber ich fand’s interessant, natürlich auch den Ort, den ich mir immer karg vorgestellt hatte und nicht wilhelminisch überladen.
„Ja“, sagte Dorothee auf den Stufen, „das ist eben vernichtend für den Sozialismus. Klar, dass es verboten war.“ Das Drollige ist, dass Brecht sein Werk wohl nicht, wie Dorothee vermutete, ironisch und anklagend gemeint hat, sondern ernst und Verständnis heischend. So müssen es auch seine Erben und die RAF ausgelegt haben, und diese Argumentation behagte Dorothee so wenig, dass sie es bei „Ach!“ beließ.
Der Häuserblock gleich neben dem Brecht-Ensemble ist frisch renoviert. Das DDR-exklusive Restaurant ‚Ganymed‘ hat die Preise abgesenkt, vermutlich die Küche auch, es war aber so leer, dass wir nicht stören wollten. Dorothee begnügte sich damit, mir zu erzählen, dass sie sowohl mit Generaldirektor Költzsch vom VEB Deutsche Schallplatten als auch mit Harry Kraut (Executive Vice President of Amberson) dort getafelt habe, und führte mich zur ‚Ständigen Vertretung‘ nebenan. Da war es irrsinnig voll und laut und groß und holztischig. Ich sah auf die riesigen, vollen Teller, schmeckte Mehltunke und sagte: „Hier kann man sich nicht unterhalten.“ Das ist immer meine unschlagbare Waffe, wenn Dorothee mich an Schauerorte verschleppt und mitteilt: „Das ist jetzt ganz in.“ So aßen wir in was Kleinerem, Bescheidenerem, was Kleineres, Bescheideneres, sannen der Begegnung mit Brecht nach und verabschiedeten uns auf dem Bahnhof Friedrichstraße, von dem aus ich früher immer unter Mühsal und Herzklopfen zurückgefahren war in den Westen, während ich nun Dorothee leichten Herzens zum Savignyplatz ziehen ließ und die Linden kreuzend die Friedrichstraße entlangglitt: Stadtmitte, Hanno-Mitte.
Zwei Tage später hatte ich mein nächstes Brecht-Erlebnis. Dorothee hatte mich am Morgen nach unserem Brecht-Abend früh geweckt, um mir telefonisch mitzuteilen, dass am Donnerstag noch mal ‚Galileo Galilei‘ gegeben würde. Sie fand die Inszenierung sehr sehenswert, und ich hatte immer gefunden, dass das Brechts bestes Theaterstück ist.
Ich konnte meinen Freund, den Studienrat für Kunsterziehung Michael Zachow dafür gewinnen, mich zu begleiten. Er ist ja auch so kulturbewusst. Sein Partner Jürgen Haug hatte ursprünglich das Parterre meines Kutscherhauses für den Umzug meiner Eltern umbauen sollen, aber seine kleinteiligen Pläne sagten Irene nicht zu. Mir auch nicht. Irgendwie murkelig. Michael ließ mich unverblümt wissen, dass Jürgen Haug derzeit nichts mit mir zu tun haben möchte, obwohl ich ihm noch vor meiner Ankunft in Berlin so einen verständnisheischenden Brief geschrieben hatte. Es ginge nicht so sehr ums Architektonische als ums Menschliche, wurde mir bedeutet, und das mag ja sein, aber wenn er sich anders verhalten hätte, wäre die Sache anders gelaufen, mehr Kastanien hole ich nicht aus dem Feuer, und wenn mich das die Freundschaft von Jürgen kostet, dann ist das der einzige Preis, den noch zu bezahlen ich bereit bin.
Dafür kaufte ich teure Karten für Michael und mich: zweite Reihe, mitten drin im Geschehen und nicht wie bisher mit Dorothee immer auf Guckkastenentfernung. Insofern konnte ich auch Galileis Genital noch von der Bauchfalte unterscheiden, als er sich eine Minute nach Beginn des Stückes den Bademantel abstreifte.
„Doch, ich fand das sehr gut“, sagte Dorothee am nächsten Tag. „Er ist ganz entblößt und verwundbar. Der Papst ist ja im zweiten Akt auch nackt.“ Selbst mir war diese Parallele als Konzept nicht entgangen, ich konnte sogar Dorothee darauf aufmerksam machen, dass unmittelbar vor der Pause Galileis Tochter nackert auf die Bühne gesprungen war; auch sie war entblößt und verwundbar, weil ihr Verlobter aus Ärger darüber, dass die Welt rund sei, der Braut die Hochzeit aufgekündigt hatte. Ansonsten war bis zur Brandmauer hin auf der Bühne nichts zu sehen als alte Gartenstühle. Da tat es wohl, Gesichtsausdrücke und Geschlechtsteile hautnah erleben zu dürfen.
Anschließend gingen wir – mehr, weil alles andere voll war, als weil ich von der Gastronomie so begeistert gewesen wäre – wieder in das Lokal, in dem ich mich schon zwei Tage zuvor mit Dorothee über die ‚Maßnahme‘ auseinandergesetzt hatte. Als ich nach einer halben Stunde fragte, ob wir nicht zumindest unser Getränk bekommen könnten, blaffte mich der hübsche, junge Mann, der wohl das erste Mal in seinem Leben versuchte, Kellner zu spielen, an: „Glauben Sie, ich bin faul?“ – Nein, nein, er rannte emsig hin und her, er war bloß dumm, aber ich fürchtete, ihn mit dieser Auskunft zu kränken, und ließ deshalb die Frage lieber im Raum stehen – und ihn auch. Irgendwann kamen dann doch der Wein und das Essen. Wenn was Kurzgebratenes in Soße ertrinkt, dann fragt man sich ja immer: Wo kommt die bloß her? – Ein interessanter Abend.
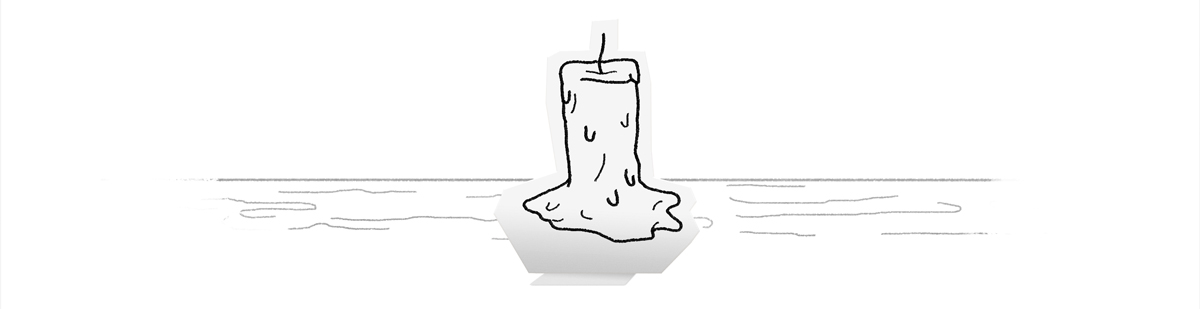
Titelgrafik mit Material von Shutterstock: Mumemories (Bühne)

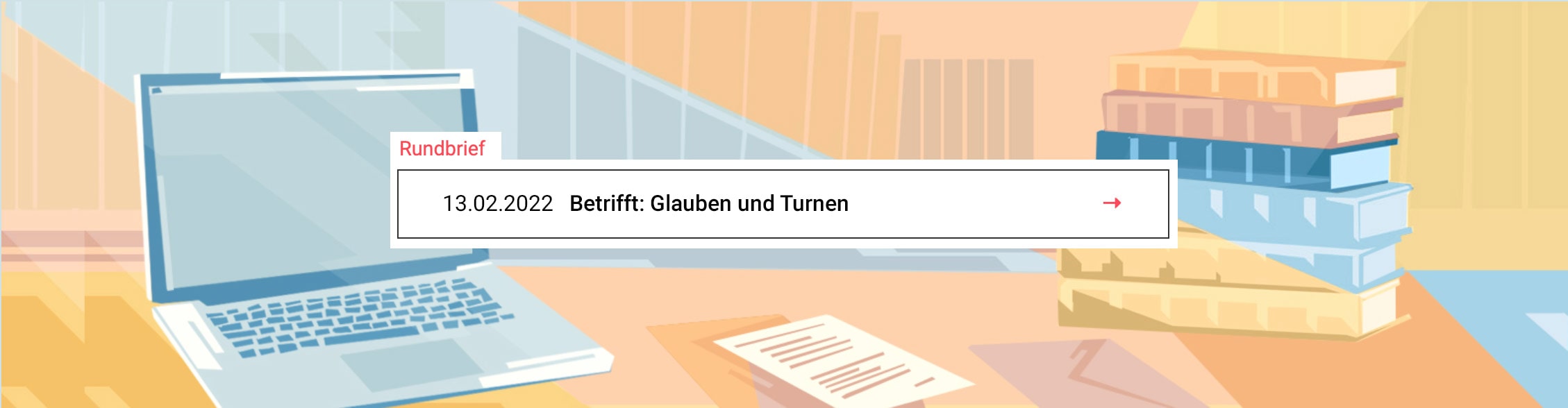
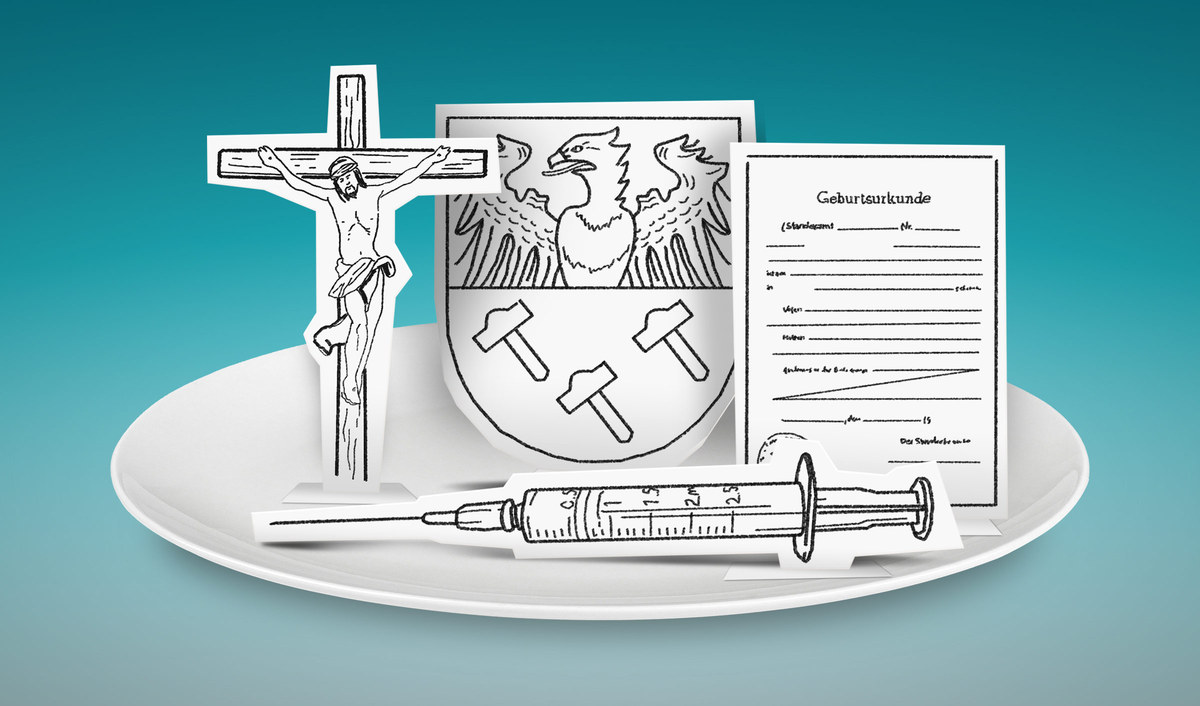
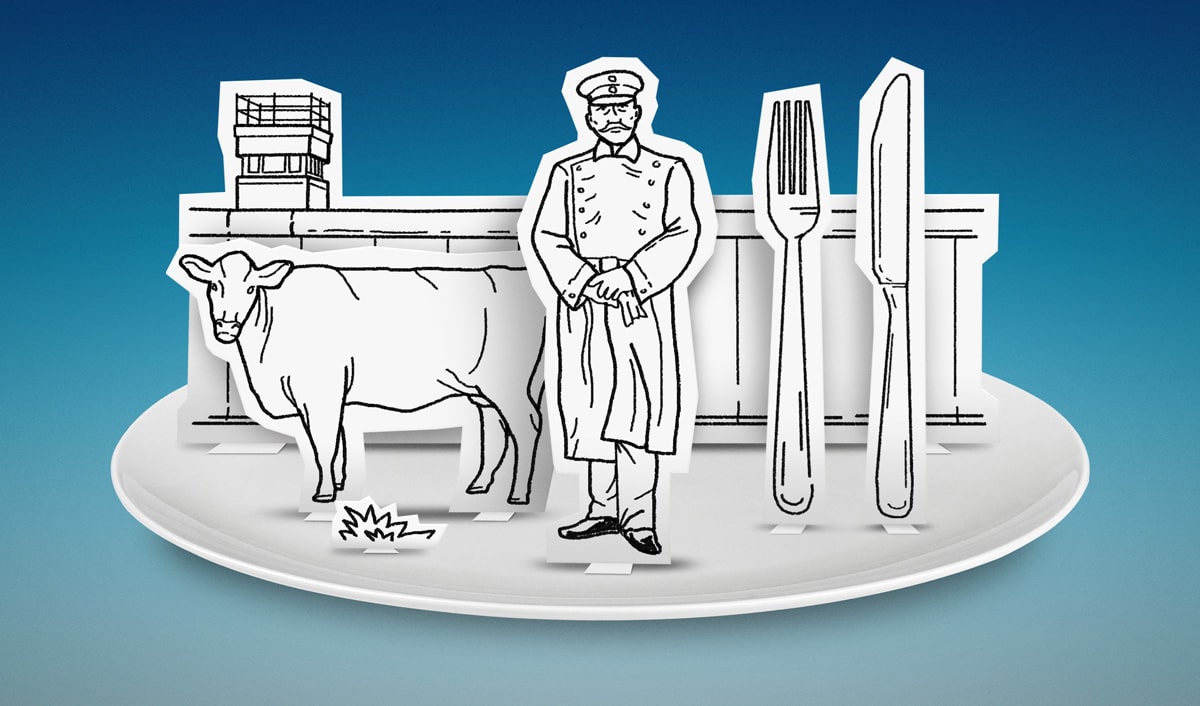


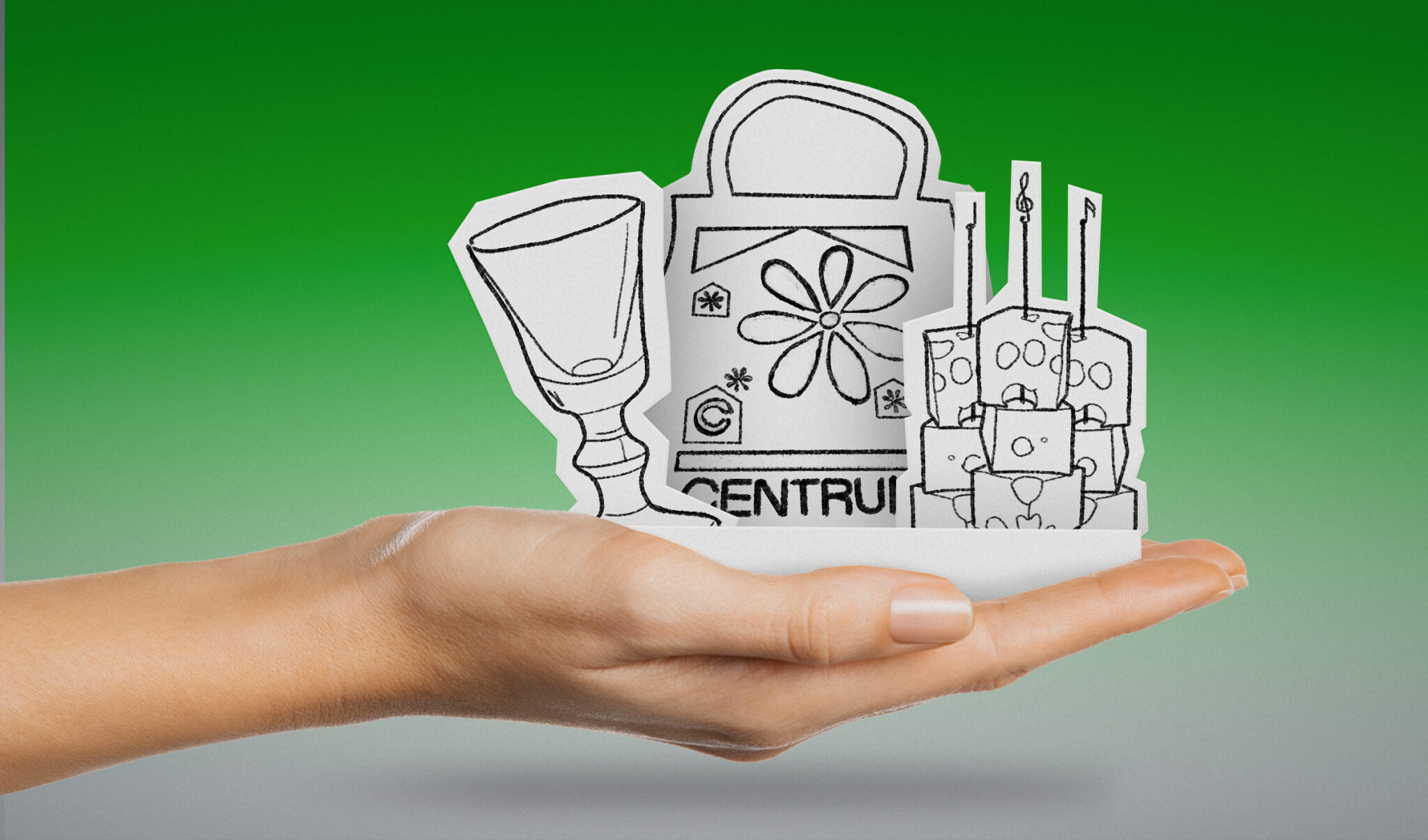





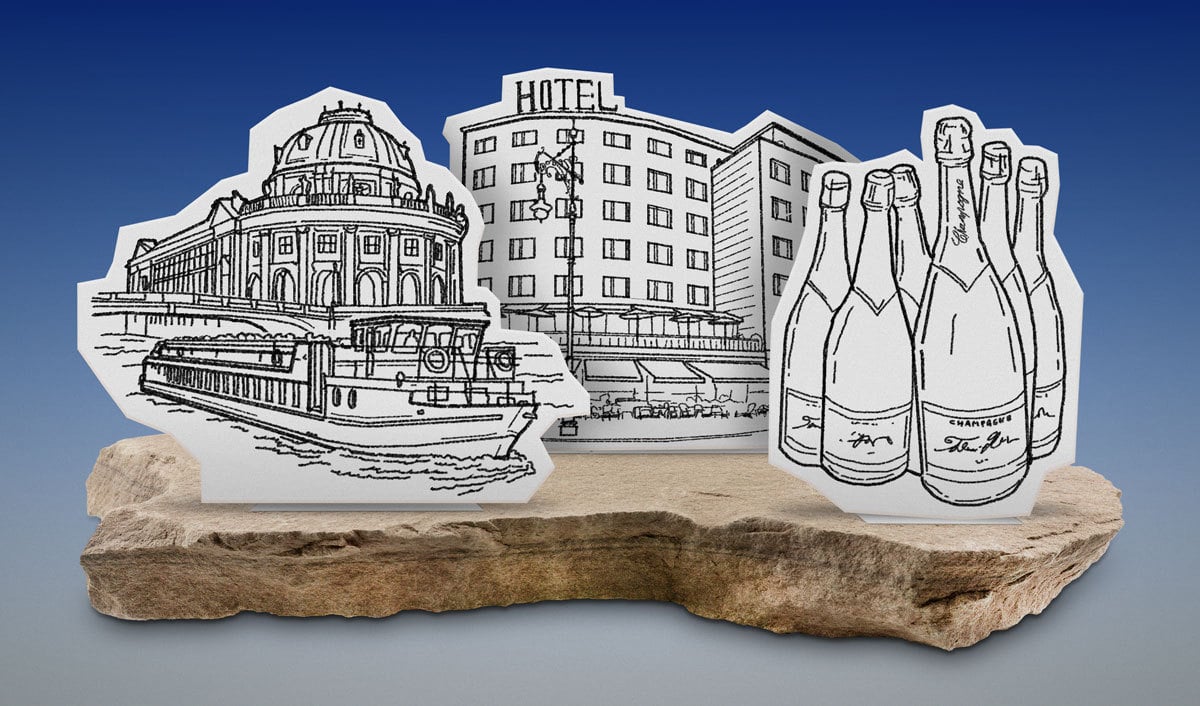


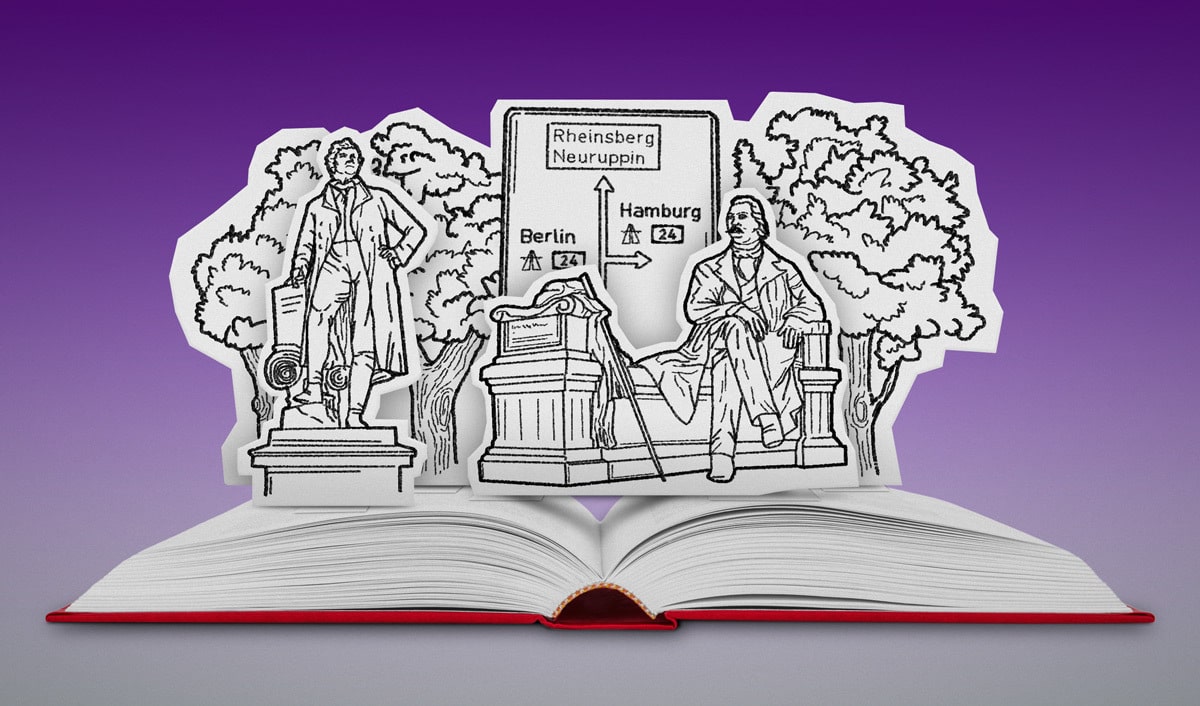
An jeder Ecke ist noch was abgebröckelt … und zwar auch 2022 noch.
Na so schlimm ist’s doch auch nicht.
Berlin? Es verändert sich auf jeden Fall weiter. Die einen vermissen da die guten alten Zeiten, wo nach der Wende alles billig und aufregend war, den anderen ist es immer noch zu chaotisch.
Die Berliner Innenstadt war besonders stark zerstört und blieb besonders lange verwahrlost. Aber es ist Kennzeichen jeder Weltstadt, dass an ihr dauernd gebaut wir. Das ist auch in London, Paris und New York so.
Ich finde das auch ziemlich normal und auch richtig so. Man darf bei so etwas nicht sentimental sein.
Das sagt sich einfacher als es getan ist. Man verbindet eben bestimmte Erinnerungen mit einer Stadt. Gerade wenn man nicht dort lebt. Wenn diese Erinnerungen (und Erwartungen) dann beim erneuten Besuch enttäuscht werden, ist das traurig.
Man darf halt nicht in Nostalgie verharren, sondern sollte sich auf Neues freuen. Wenn das dann gar nicht den eigenen Erwartungen entspricht, kann man immer noch sentimental werden.
…und das tut man dann am Besten zuhause oder in einer anderen Stadt, in der man sich wohl fühlt. Ansonsten ist sowas doch nur deprimierend.
Ich fand Brecht immer erstaunlich unterhaltsam. Bin ich da alleine?
Es wird ja immerhin viel gesungen 😉
Auch nur in Mahagonny und bei den Drei Groschen. Wie ich schrieb, schätze ich den Galileo Galilei. Die Lehrstücke finde ich ziemlich fad. Die Gedichte sind großartig.
Und beim Happy End. Wobei das ja eher ein Theaterflop war.
Man könnte ja meinen das ganze Leben, oder zumindest das ganze menschliche Miteinander, ist mit diesen zwei Dingen zusammengefasst: Gesichtsausdrücke und Geschlechtsteile.
Sehr knapp.
Die ständige Vertretung ist ja auch ein seltsamer Ort. Was soll das in Berlin? Das Lokal ist genauso fehl am Platz wie das Hofbräuhaus am Alex.
Schauerort trifft es wirklich recht gut.
Ach was, auch solche Leute, die dort gerne sitzen, müssen irgendwo essen und plauschen. Umso besser, dass nicht alle denselben Geschmack haben und sich in dieselben Lokalitäten quetschen.
Currywurst als ‚Altkanzler-Filet‘ zu Ehren von Gerhald Schröder steht auch nicht auf jeder Speisekarte. Passt gut nach einer Soljanka vorweg und einem Kölsch zum Nachspülen.
Ich war noch nie dort. Aber der Einblick in die Speisekarte wird eher dafür sorgen, dass das auch so bleibt.
Der Papst ist entblößt. Im übertragenen Sinn funktioniert das ja deutlich besser. Ich möchte nämlich weder Herrn Ratzinger noch Franziskus nackt sehen.
Der Regisseur will ja, dass es ein Ärgernis ist. Allerdings ärgere ich mich mehr über seine plakative Symbolik als über den Anblick welker Schwänze.
Ist die Zeit, in der man sich über nackte Darsteller in der Oper aufregt, nicht lange vorbei?
Das Publikum weiß es, die Regie nicht immer.
Der Kunde ist König. Das Publikum hat immer recht. Außer das Ego des Ladeninhabers oder des Regisseurs lässt das nicht zu.
Das sind wohl zwei unterschiedliche Dinge, aber ja, beides scheint zu stimmen.
Der Ladeninhaber macht pleite, der Regisseur dreht weiter, falls er kunstsinnige Kritiker und Produzenten findet.
So wie das hier beschrieben wird verwirrt mich die Nacktheit der Darsteller auch eher. Aber man muss sich um eine längst abgespielte Inszenierung wohl auch nicht mehr den Kopf zerbrechen.
Das ist der Unterschied zum Film: bei dem bleiben Ruhm oder Schande für die Cineasten-Ewigkeit bestehen.
Es gibt ja sogar einige „klassische“ Aufführungen auf DVD. Aber letztendlich bleibt Theater und Oper natürlich immer ein Produkt des Moments. Das ist eigentlich gar nicht dazu gedacht für die Ewigkeit festgehalten zu werden.
Das Ziel der meisten Künstler ist die Ewigkeit. Dass sich ein Kunstwerk gleich nach der Auktion zerstört ist selten – aber ein PR-Gag für die Ewigkeit.
Aber da unterscheidet selbst ein Sänger zwischen CD und Live-Konzert, oder sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung anders?
‚Live‘ wollen alle Spontanität, im Studio Perfektion. Wenn auf einer CD bei jedem Hören derselbe Fehler auftritt, ist das schon störend. Man wartet direkt darauf.
Harry Kraut muss aber doch ein Künstlername sein, oder?
Nein, das war Leonard Bernsteins Manager, mit dem ich sogar befreundet war. Seine Vorfahren kamen ganz offensichtlich aus Deutschland.
Es ist auf alle Fälle ein Name, den man nicht so leicht vergisst. Bestimmt kein Nachteil in der Branche.
Für dessen Namen brauchte ich in der Tat keinen Zettel im Jacket.
😂