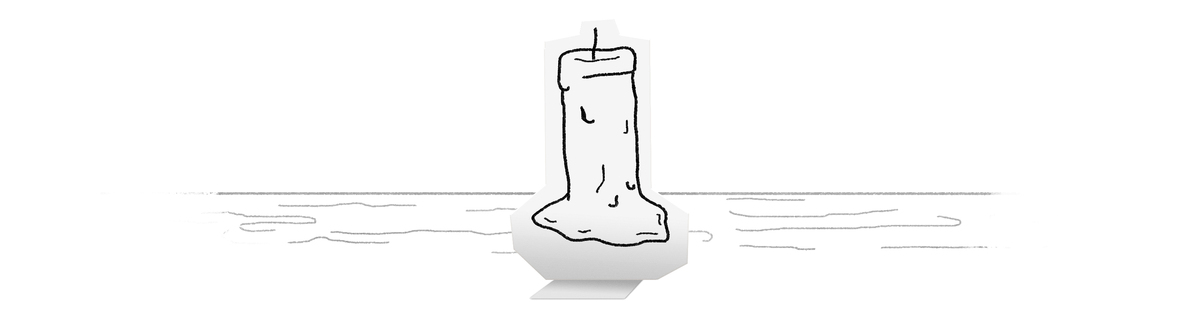

Wie alle preußischen Feldherren, so weiß auch Dorothee, dass Angriff die beste Verteidigung ist: Als das letzte Bild filmischer Böklin-Entwürdigung verflimmert war und die Beleuchtung zuschlug, rief sie gleich aus: „Hochinteressant! Ich fand das hochinteressant.“ Ich stimmte Dorothee durch Kopfnicken zu: Ja, sie fand es hochinteressant. Allerdings kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass Dorothee jemals über irgendetwas zwischen Lessing und Ligeti gesagt hätte, dass es langweilig sei.
Um in eine etwas wirtlichere Gegend zu gelangen, mussten wir an etlichen Ruinen vorbei, zu denen Dorothee anmerkte: „Hier möchte ich wohnen. Aber das ist unbezahlbar.“ Ich ging davon aus, dass sie mit Instandsetzung der Immobilien rechnete.
Kurz vor dem Gendarmenmarkt, den wir eigentlich ansteuerten, passierte es dann: Dorothee entdeckte etwas. In diesem Fall handelte es sich um eine Galerie. Im bodenbelacklosen Erdgeschoss eines noch unbewohnten Hauses war unter Neonbeleuchtung eine Anzahl von Exponaten zu besichtigen.
Im Eingang saß ein mürrischer Rentner, der nur ganz kurz und ganz feindselig aufsah von seiner ‚Bild am Sonntag‘, als Dorothee und ich die Stätte betraten. Sein Haarkranz und sein Anzug hatten dasselbe Grau wie die Objekte, die mal mehr an vergrößertes Nasensekret (im Volksmund: Popel), mal mehr an ausgeschiedenes Kaugummi gemahnten, aber vielleicht nur mich, jedenfalls nicht Dorothee. Sie konnte sich partout nicht losreißen. Ich ging schon mal die drei Schritte zum Gendarmenmarkt und freute mich daran, wie die Fassaden im Gegenlicht in den Himmel gemeißelt waren. Das war wirklich Stadtmitte. Ein klassizistisch entworfener Platz, umkränzt von moderner, unterschiedlich gestalteter Architektur. Cafés, Restaurants, Geschäfte, aber zurückhaltend, kein Rummel, sondern – wie seltsam! – ein Ort der Einkehr und der Würde.
Eine Viertelstunde hatte ich auf dem Platz verträumt und Dorothee geduldig in der Galerie gewähren lassen, dann kam sie heraus und sagte: „Das war der Künstler.“ (Sie meinte wohl den Rentner an der Tür.) „Er hat mir seine Karte gegeben!“ Sie wendete das graue Stück Pappe und steckte es weg, mit einem Gesichtsausdruck, als hätte man ihr den Orden wider die Gleichgültigen verliehen.
Wir gingen zu ‚Lutter & Wegner‘, neben ‚Auerbachs Keller‘ Deutschlands literarischste Kneipe, hat hier doch E. T. A. ‚Hoffmanns Erzählungen‘ versoffen. Dass die Küche jetzt wienerisch ist, die Preise ein ausschließlich gehobenes Publikum zulassen und das Lokal fünfzig Meter weiter links steht, weil an der Originalstelle jetzt das ‚Four Seasons‘ prunkt, tut der Authentizität keinen Abbruch.
Dann kam die protokollgerechte Abfolge von Ich-will-eigentlich-nichts, über ein angeregtes Gespräch, was gut und was schlecht ist, bis zum Aufstehen, nachdem Dorothee die Garnierung weggeputzt und ich gezahlt hatte. Daneben gab es bereits zwei Veranstaltungen, die Dorothee selbst ausgerichtet hatte.
Bei der ersten war unsere frühere Pariser Kollegin Elisabeth Koehler Ehrengast. Im Vorfeld des Abends war zwischen Dorothee und mir ein heftiger Streit entbrannt, ob der Salat vor oder nach dem Hauptgericht zu reichen sei: Dorothee bestand darauf, dass in Frankreich und Italien der Salat ‚grundsätzlich‘ nach dem Hauptgang auf den Tisch käme, und dieses ‚grundsätzlich‘ brachte mich sofort auf die mediterrane Palme, denn es suggerierte: Kulturländer servierten Rucola, Radicchio und Frisée – in Essig und Öl, selbstverständlich – zwischen dem Kalbsfilet an Estragon und den Crêpes Suzette, während in Deutschland, Lappland und Uganda das Bilsenkraut vor dem Mammut auf den Tisch komme. Wir stritten uns wie zwei Spatzen um einen Kuchenrest, und ich ließ auch nicht locker (der Gelangweiltere gibt nach), weil ich erstens nichts Lieberes mit Dorothee tue, als mich zu zanken, und ich mich zweitens mit niemandem auf der Welt lieber zanke als mit Dorothee, so dass ich richtig ein bisschen enttäuscht war, als sie das Verfahren abkürzte und salomonischerweise verkündete: „Elisabeth soll heute Abend entscheiden!“ Dies barg die Gefahr in sich, dass Elisabeth für die Gegenpartei votieren würde. Dorothee schätzte diese Gefahr offenbar nicht geringer ein als ich, jedenfalls ließ sie den Salat innerhalb der Speisenfolge ganz und gar weg. Ich stelle mir mit Genuss vor, dass sie aus Furcht, bei diesem ‚grundsätzlichen‘ Streit zu verlieren, Radicchio, Rucola und Frisée in den Müll kippt, aber ich weiß, dass Dorothee so nicht funktioniert. Entweder sie hatte die Salate noch gar nicht erstanden oder sie isst an ihnen die nächsten drei Wochen.
Stattdessen gab es erst ihre ausgezeichnete, völlig ungebundene Tomatensuppe und anschließend Kassler mit Sauerkraut, denn nachdem sie mit mir alle erdenklichen Hauptgerichte durchdiskutiert hatte, kam sie zu dem Schluss, dass es nichts sein dürfte, was es in Frankreich auch gibt. Ich fand das ein wenig unsportlich. Wenn Dorothee sich schon dem Salat-Urteil verweigerte, so hätte sie sich wenigstens dem (wirklich nicht schwierigen) Wettbewerb mit der Pariser Küche aussetzen können. Aber Dorothee kombinierte Glück und Können. Der Tag war winterlich kalt, und ihre deutsche Mahlzeit war ganz köstlich – ein Genuss. Elisabeth stammt übrigens aus dem Elsass, wo man auch schon mal etwas von Sauerkraut mit Gepökeltem gehört hat.
Etwas aus dem Rahmen fiel dazu ihr Nachtisch: Als das Schweinskarree noch Loup de Mer geheißen hatte und sie über den passenden Nachtisch grübelte, hatte ich ihr angeboten, ein Tiramisu herzustellen. Begeistert ging sie darauf ein. Als Idee. Machen wollte sie es selber. Ich verstand ihren Wunsch, alles Lob selbst einheimsen zu wollen, aber ich ahnte auch, dass sie den Aufwand, wie alle, die denken, man verrührt bloß Eigelb mit Mascarpone, unterschätzte.
So war ich nicht besonders erstaunt, als Dorothee mich gegen Mittag anrief und sagte: „Die Tiramisu ist nichts geworden, aber wir müssen sie trotzdem essen.“ Für den ersten Halbsatz hatte ich mehr Verständnis als für den zweiten, immerhin gab ich Dorothee den Rat, neben Gabeln auch Löffel fürs Dessert bereitzuhalten. Die Ausrede, die Dorothee für ihr Versagen bereithielt, fand ich allerdings unangemessen flau: „Die Eier waren zu frisch.“ Dorothee wollte mir, unter unser beider Niveau, einreden, dass der Schnee frischer Eier nicht steif werde.
Die Wahrheit ist, dass die Masse flüssig wird wie Eis in der Sonne, wenn man zu viel Amaretto zu früh hinzugießt. Ich gleiche solche Pannen mit ‚Sahne-Steif‘ aus, das im Haushalt so wichtig ist wie Maggi oder Wasser; Dorothee empfahl ich, die Angelegenheit sofort in den Kühlschrank zu stellen und ruhen zu lassen.
In der Tat hatten wir alle Glück: Das Tiramisu war fester geworden, die Konversation lockerer.
Was sich Dorothee da immer aufbürdet, mit Einkaufen, Kochen, Tisch nobel decken, Servieren und – das Schlimmste – Abwaschen, ist wirklich bewundernswert. Vermutlich würde ich an ihrer Stelle meinen Lebensabend, die Flasche am Hals, im Bett verbringen.
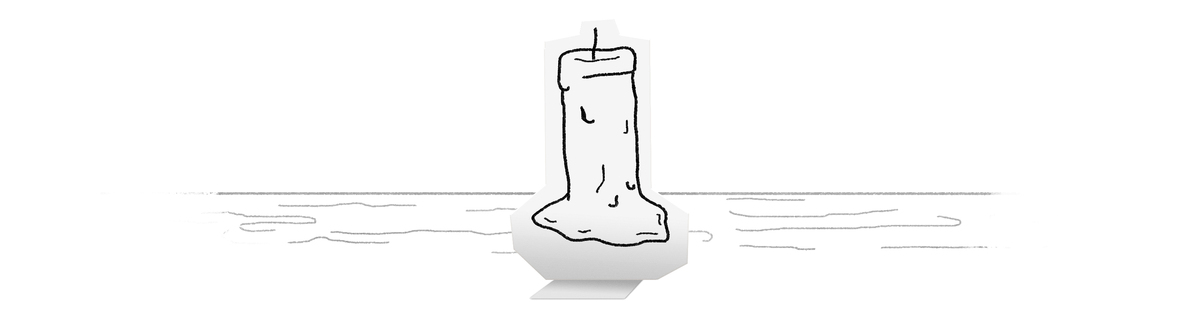
Titelgrafik mit Material von Shutterstock: Ivan4es (Farbpalette)
#1.09 | Ein Maler auf der Leinwand#1.11 | Reden und wissen, worüber

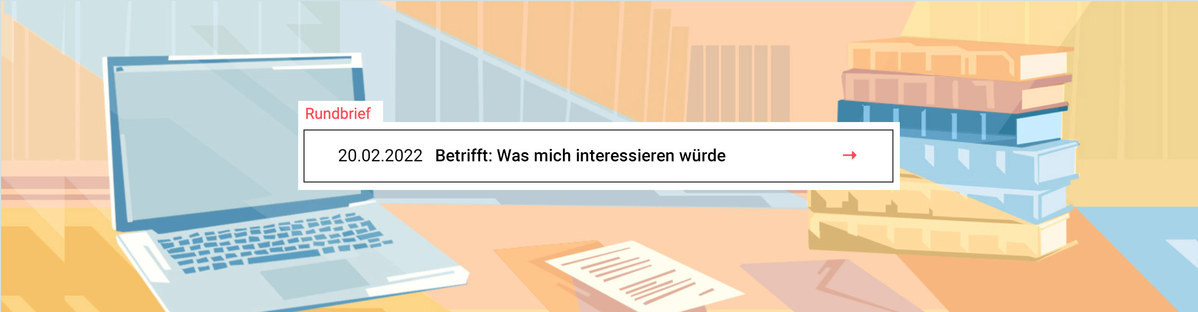
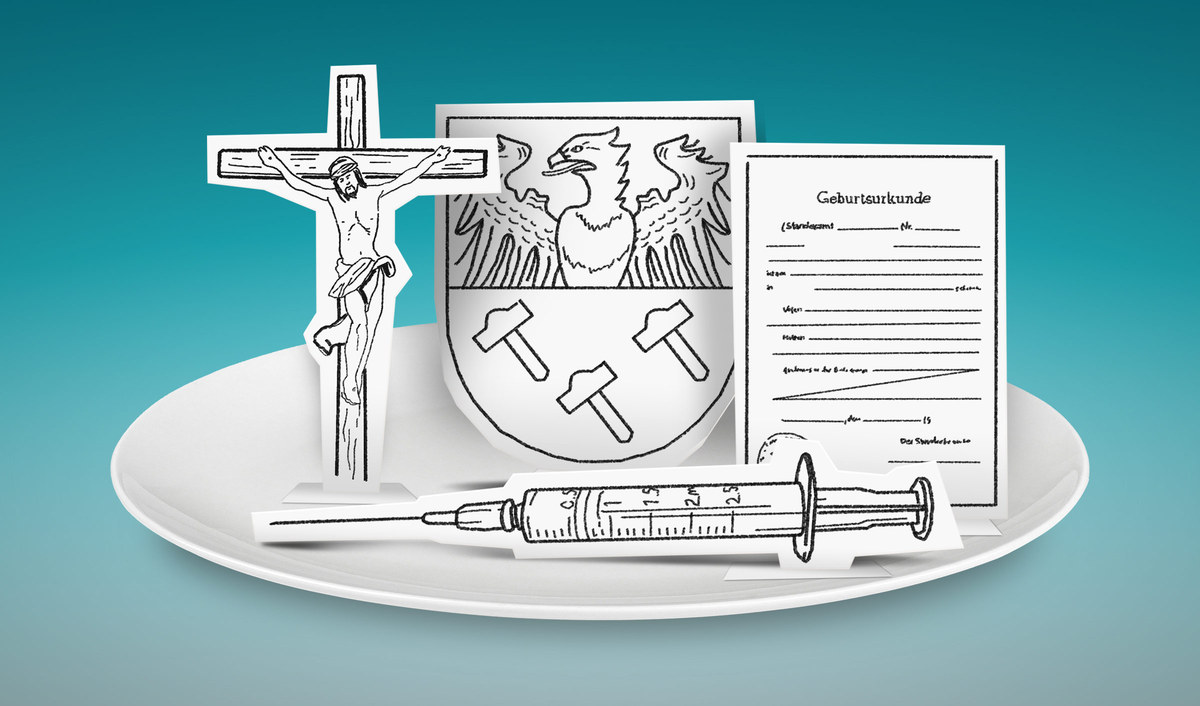
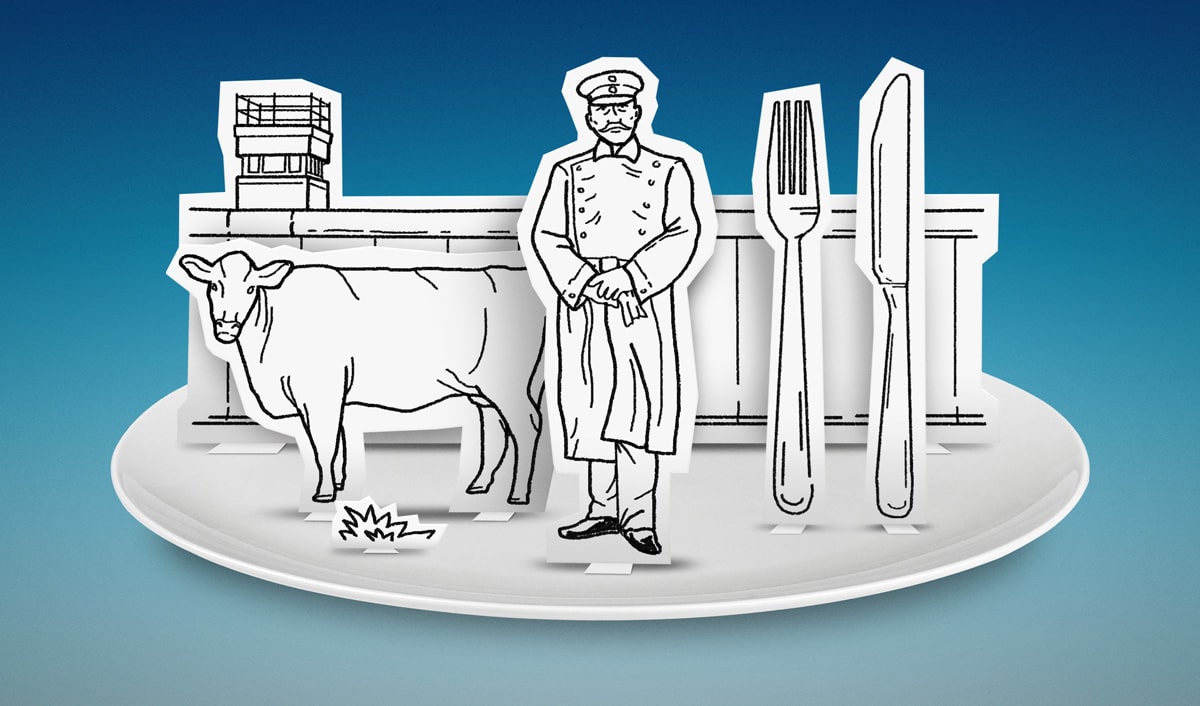


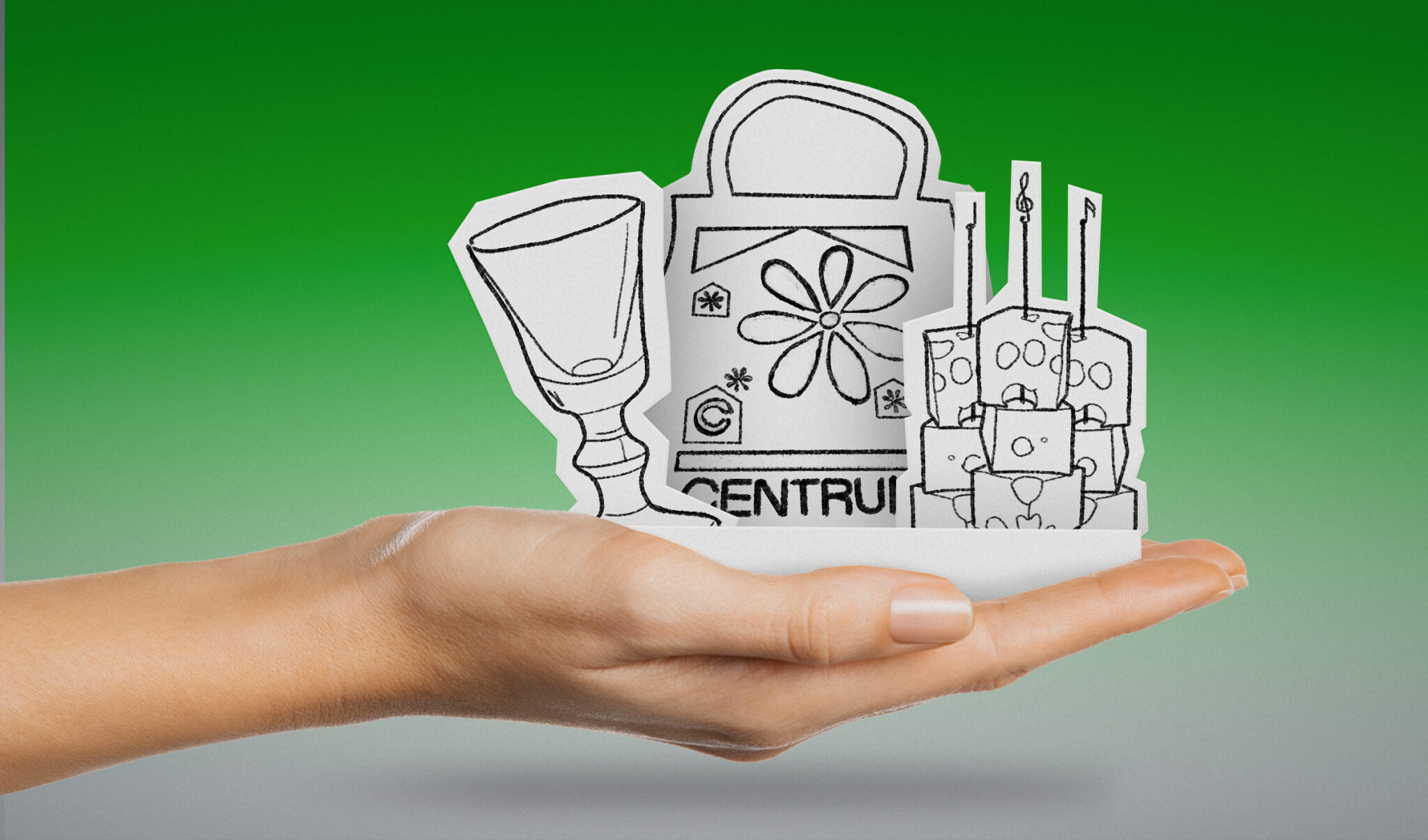





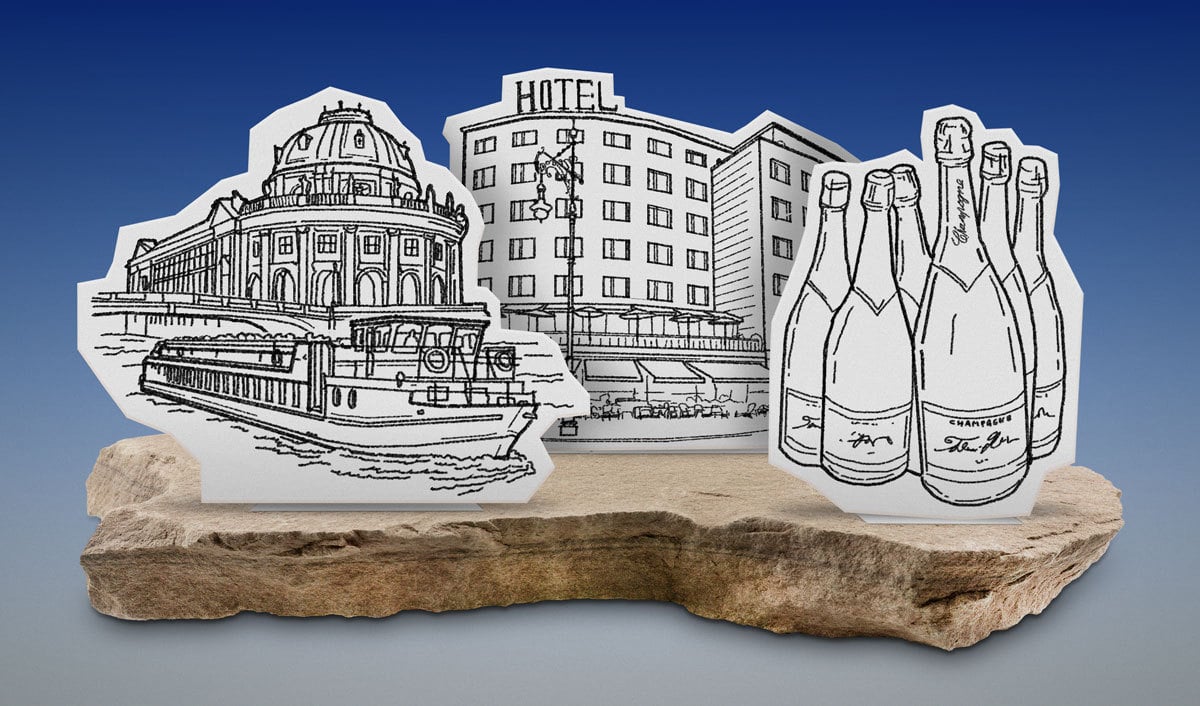


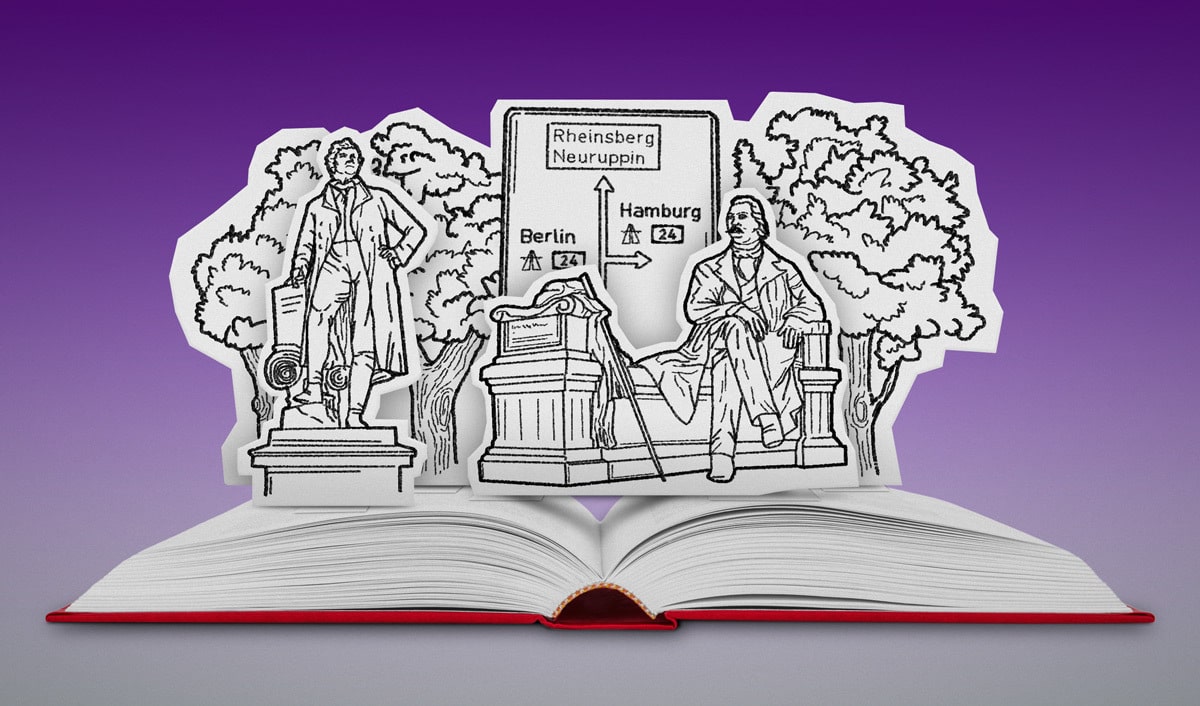
Maggi? Aber wo Geschmack fehlt reicht doch oft eine Prise Salz!
Umami schmeckt einfach voller als Salz.
Ich hoffe, dass Dorothee einen Geschirrspüler hatte. Das würde zumindest einen kleinen Teil des Aufwands verringern.
Ich spüle eigentlich ganz gerne. Aber wenn man viele Gäste im Haus hat, dann wird es natürlich schnell zu viel.
Zuzugucken, wie man etwas sauber kriegt, macht Spaß, sich an verkrustete, verklebte Teller zu begeben, nicht so.
Das ist genau das Geheimnis. Sofort spülen kann ganz meditativ und befriedigend sein. Aber nach einem langen Abend die eingetrockneten Essensreste abzuknibbeln ist etwas anderes.
Ist schon so lange her. Ja, ich glaube sie hatte einen Geschirrspüler (als Maschine, nicht als Gast). Aber das merkte man der Fläche neben dem Herd nicht immer an.
Der Satz „Die Tiramisu ist nichts geworden, aber wir müssen sie trotzdem essen.“ nimmt mich weiter für ihre Freundin Dorothee ein.
Ein schweres Los 😂
Besser als flüssige Götterspeise
Joa dagegen kann man kein Argument bringen
Dass Künstler keine große Lust haben in der Galerie zu sitzen und die Laufkundschaft davon zu überzeugen, dass ihre Kunst großartig ist, kann ich aber auch verstehen.
Warum sitzen sie dann da?
Kein Geld um den Angestellten der Galerie zu zahlen?
Ehrenamtliche suchen.
Oft ist das doch auch so, dass die Künstler da recht widerwillig zusagen. Man versucht gute PR zu generieren. Auf die Kundschaft zuzugehen. Gleichzeitig schwingt das Unangenehme mit. So ungefähr stelle ich mir die Abläufe jedenfalls vor.
Ich glaube viele von ihnen reden sehr gerne über ihre Kunstwerke. Man malt ja nicht nur für sich alleine.
Je berühmter sie sind deso weniger reden sie über ihre Werke.
Es ist doch auch anstrengend, wenn jemand die ganze Zeit erklären muss, was er da tut. Gute Kunst sollte das doch eigentlich gar nicht nötig haben.
Macht aber den Beruf des Kritikers aus.
Ein äußerst seltsamer Beruf. Nicht, dass ich die Kritiken nicht auch lesen würde, aber dass der Arbeitsalltag darin besteht die Kunst anderer zu bewerten – das muss schon ein besonderer Schlag Mensch sein.
Sie müssen sowohl begeistern als auch meckern können – nichts machen, aber alles beurteilen. Und damit Geld verdienen.
Begeistern ist dabei sogar die Hauptsache, meinen Sie nicht? Schließlich will man als Leser ja unterhalten werden. Eine trockene Analyse des Theatergeschehens suche ich in meiner Tageszeitung jedenfalls nicht.
Den Lebensabend im Bett? Aber gerade zum Ende muss man es doch krachen lassen. Zumindest kann man dann endlich die Zurückhaltung ablegen und sich nicht mehr um andere kümmern müssen.
Wie sehr man körperlich, geistig und gesellschaftlich in der Lage ist, es im Alter krachen zu lassen, lässt sich schwer vorhersagen.
Krachen ist da bestimmt nicht unbedingt wörtlich gemeint. Oder? Das wäre ja relativ ungewöhnlich.
Bei manchen kracht da nur noch der Schenkelhals.
Autsch!
Also wie jetzt? Salat erst nach dem Hauptgang? Das habe ich noch nie gehört. Auch in Frankreich nicht.
Darum hatte ich ja so auf das Göttinnen-Urteil von Elisabeth gehofft. Aber dann hat Dorothee gekniffen. Feige!
Das kann ja jeder machen wie er/sie mag. Ich essen den Salat am liebsten zum Hauptgang. Weder davor noch danach. Wenn Dorothee das als kulinarische Regel im Kopf hatte, lag sie aber wahrscheinlich trotzdem falsch.
Zum Hauptgang haben wir Salat früher immer dann gegessen, wenn es kein Gemüse gab, zu Fisch etwa. Heute isst man auch zu Fisch Spinat, Sauerkraut, Fenchel, dann gibt es gemischte Blattsalate vorweg (mit Schafskäse oder Croûtons). Aber: seit ich aufgehört habe zu kochen, esse ich, was auf den Tisch kommt.
So mache ich es auch immer. Salat gibt es, wenn es später kein (grünes) Gemüse gibt.
Dabei ist die Choucroute doch ein sehr traditionelles Gericht aus dem Alsace. Da war Dorothee aber noch nicht in Straßburg.
Tja, da vermischt sich natürlich die deutsche mit der französischen Küche. Das Sauerkraut ist aber wohl trotzdem eher dem deutschen Einfluss zuzuschreiben.
Dorothee verband mit Pariser Küche wohl mehr Coq au Vin nach Austern.