

Silke fand – nach kurzer Bestürzung im Hirn – im aufgeweckten Netz als Ersatz für die Pension ‚Dittberner‘ das Hotel ‚The Dude‘, und wir fanden es nach einigen Navi-Umwegen auch und angenehm dort. Das Hotel behauptet ‚Mitte‘ zu sein, na ja, es liegt im allerletzten Abschnitt der prolligen Köpenicker Straße, unmittelbar vor Kreuzberg, aber man ist schnell an der Spree und an der Schloss-Attrappe und wird freundlich bedient. Wie immer bekam ich ein Zimmer neben dem Fahrstuhl, aber es war das einzige Mal auf der Reise, dass ich deswegen Raum und Stockwerk wechselte. Ich stelle mich ungern an, aber noch weniger gern zähle ich schlaflos die letzten Nachtschwärmer und wenig später die ersten Frühstücker, wenn sie alle im Lift durch meine Ohrmuscheln rauschen.

Foto: daizuoxin/Shutterstock
Am mittigsten ist Mitte auf dem Gendarmenmarkt. Da saßen wir in der Abendhitze auf den Stufen des Schauspielhauses, sahen auf Schiller herab und feixten in Martins Kamera, halb vergnügt, halb verlegen. Pünktlich um acht nahmen wir, wie gebucht, unsere Straßenplätze bei ‚Lutter & Wegner‘ ein. Seit ich den Osten meinem Berlin angegliedert habe, gehört diese Örtlichkeit ins Programm, und ich finde immer noch Neulinge, denen ich dort ‚Hoffmanns Erzählungen‘ erzählen kann. Dass das ehrwürdige Haus an etwas anderer Stelle stand als seine beliebte Kopie, sage ich nicht. Weglassen kann ich ganz gut. Wirklich! Weniger gut kann ich die knappe Hälfte des obligatorischen Wiener Schnitzels verdrücken und mag auch nicht Silkes noblen Handtaschen immer die in Servietten eingewickelten Reste zumuten. Aber da Wien sowieso auf dem Reiseprogramm stand, durfte ich mich stattdessen für Gänseleber entscheiden, zweifellos nicht sehr ethisch, aber das merkte die Gans ja nicht mehr.


Foto oben links: H. R./Privatarchiv | Foto oben rechts: Victority/Shutterstock | Foto unten: M. D./Privatarchiv H. R.

Rafał und Giuseppe gingen auf die Piste, ich ins Bett, Silke wahrscheinlich auch, Martin schwirrte mit der Kamera durch die Nacht: Zeitraffen im Dunkel ist seine Spezialität: Da kann man mit viel Geduld dem Leben beim Vorbeilaufen zuschauen, und hinterher sieht alles ganz schnell aus.

Foto: Sebastian Rittau/ Creative Commons Attribution 4.0 International/Wikimedia Commons
Am Montag sollte nun das volle Programm beginnen. Tat es auch. Ich hatte Schmerzen da, wo ich die Galle vermutete, entweder, weil mir mein Leibarzt H. J. Roemmelt kurz vor der Abreise im Ultraschall einen Stein dort diagnostiziert hatte, vor dem ich mich seither fürchte, oder der Filterkaffee war schuld. Mein Hotelzimmer war farbig-gediegen, der Ventilator sah schön nach Kolonialzeit aus, und auch temperaturmäßig erinnerte alles an Indien. Rafał legte die von mir für angemessen empfundene Kleidung über den Sessel, imperialistischer ging es nun nicht mehr, zumal ja auch Wilhelms Schloss im Juni seinen Turm zurückbekommen hat. Das Berliner Schloss wurde 1442 in Auftrag gegeben, 1950 abgerissen und soll 2019 wieder stehen. Unsere Enkel werden gar nicht mehr wissen, dass es zwischendurch siebzig Jahre lang weg war. Das würde ich Ulbricht zu gern wissen lassen. Gott, würde der sich ärgern!


Foto oben links: gemeinfrei/Wikimedia Commons | Foto oben rechts: Bundesarchiv, Bild 183-11424-0001/CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons | Foto unten: pixelklex/Shutterstock

Meine mir ansonsten gewogene Umgebung macht sich gern lustig über meine Berlin-Empfindungen. Hier in Berlin fühle ich mich so eingebunden, auf wohl schwer nachvollziehbare Weise zu Hause. Ihr habt recht, als ich sieben war, sind meine Eltern mit mir nach Hamburg gezogen, und wenn ihr mich daran erinnert, komme ich mir auch gleich wie ein sudetendeutscher Landsmannschaftler vor. Und doch! Das Preußische, das Slawische, das Jüdische, das Romanische – Nichtzutreffendes bitte streichen! Alles trifft zu. Als reinrassige Promenadenmischung streife ich durch den Wildpark und schnüffle an jeder Markierung.


Fotos (2): H. R./Privatarchiv | Foto links unten: atiger/Shutterstock

Foto: Javier Brosch/Shutterstock
Schon den Weg über den wieder ansehnlichen Leipziger Platz grenzenlos ins alte Westberlin zu fahren, vorbei an der Philharmonie, in der ich in den 70er- und 80er-Jahren dauernd zu Konzerten und Aufnahmen war, zum Kurfürstendamm, in dessen oberen Seitenstraßen meine Tante mit ihren Töchtern wohnte und in ihren letzten Lebensjahren auch meine Großmutter, die ich in den 50er- und 60er-Jahren so häufig besuchte. Hier haben mein Hamburger Busenfreund Harald und ich mit meinen Cousinen Marina und Dagi die Nächte durchgefeiert und, wenn es nicht weiter auffiel, die Zeche geprellt. Hier wurde ich in einem sechswöchigen Volontariat bei Arthur Brauner kein Regisseur, aber nach einer Lehre in Siemensstadt Industriekaufmann. Hier bin ich vom Bahnhof Zoo aus in den düsteren Osten gefahren und am Bahnhof Friedrichstraße, von mürrischen Grenzbeamten taxiert, ‚eingereist‘, um im ehemaligen Reichspräsidentenpalais mit den Genossen Direktoren des ‚VEB Deutsche Schallplatten‘ Verhandlungen zu führen. Hier habe ich während einer Karajan-Aufnahme Roland kennengelernt, mit dem ich jedes Jahr mindestens einmal zurückfuhr von unserem Othmarscher Festland auf die Insel Westberlin. Hier habe ich nicht nur Laufen, Lesen und Schreiben gelernt, sondern auch Leben und Lieben. Also erzählt mir nicht, ich sei noch heuchlerischer als Kennedy, wenn ich behaupte, ich sei ein Berliner!


Foto links oben: Rhede von Kennedy, 1963/gemeinfrei/Wikimedia Commons | Fotos (2): H. R./Privatarchiv
Nun waren wir schon über die Halenseebrücke gefahren, die für mich immer die Grenze zwischen damaliger Innenstadt und unserem Grunewald war. Die Witwe des Architekten Peter Poelzig lebte wie wir im Grunewald. Eines Abends glitt sie auf der Brücke aus und verstauchte sich den Knöchel. Danach setzte sie nie wieder über die Halenseebrücke ins Zentrum. Die Halenseebrücke ist ein Nadelöhr. Frau Poelzig musste große Umwege in Kauf nehmen und zahlte zehn Mark mehr Taxengeld, egal. Nie mehr Halenseebrücke, das nicht von ihrem Mann geschaffene Bauwerk musste bestraft werden. Mein Freud Pali nahm diese Geschichte immer zum Beweis seiner Behauptung ‚Jeder ist genau so verrückt, wie er es sich leisten kann‘. Dabei war Pali selbst manchmal noch verrückter, und dann musste er Schulden machen.

Foto oben: gemeinfrei/Wikimedia Commons | Fotos (2): H. R./Privatarchiv


Von der Halenseebrücke ist es nur noch ein kurzes Stück über die Koenigsallee bis zur Wissmannstraße. Dort stand das herrschaftliche Wohnhaus des Physikers Hans Geiger, der zwar den nach ihm benannten Zähler erfunden hatte, aber nach dem Krieg nicht nur ausgebombt, sondern darüber hinaus auch noch tot war. Mein Vater hingegen hatte als Verantwortlicher für die Energieversorgung Berlins nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Beziehungen. 1948 ließ er die gut erhaltene Beletage und das ramponierte Stockwerk darüber mit einem zweckdienlichen, wenn auch ästhetisch unbefriedigenden Dach versehen. Das Obergeschoss und das ursprüngliche, gaubenverzierte Walmdach lagen links neben dem Gebäude, als Schutthaufen, und diese wilden Brocken waren als Spielplatz gut geeignet, als Augenweide weniger. Frau Poelzig wäre gestolpert. Der Garten verlief abschüssig zum Koenigssee hin, der anfänglich auch voller Schutt war und seinen Namen genauso wenig wie die Allee dem preußischen Herrscherhaus verdankt, sondern Felix Koenigs, der die Gegend 1890 vom Sumpf- zum Villenviertel umgestalten ließ.


Fotos (3): H. R./Privatarchiv
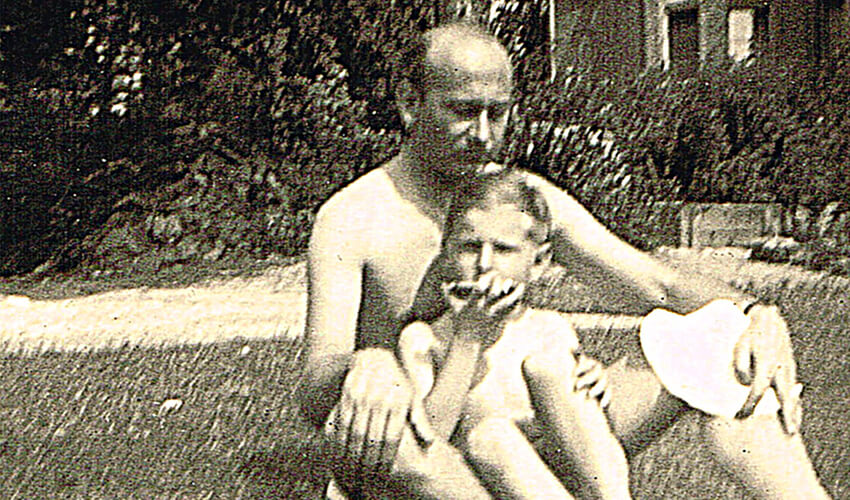
Da also kam ich zu Bewusstsein: vom Baby zum Kind. Ruinen, Kiefern, Bombentrichter. Unten der schwarze See, oben ein verbotenes Stockwerk. Später wurde der See entmüllt, aber nicht so ganz, jedenfalls schnitt sich meine Mutter beim Schwimmen an einer Konservendose, während mein Vater bloß beim Schlittschuhlaufen ins Eis einbrach, was aber meinem ohnehin nicht besonders ausgeprägten Ertüchtigungsbedürfnis zusätzlich schadete. Auf dem grauen Holzsteg zu liegen und den Duft von Schilf einzuatmen, Wasserflöhe und Libellen zu beobachten – das reichte mir.


Foto oben links: JLevitt/Shutterstock | Foto oben rechts: Kuzmenko Viktoria photografer/Shutterstock | Foto unten: Matthias Brix/Shutterstock










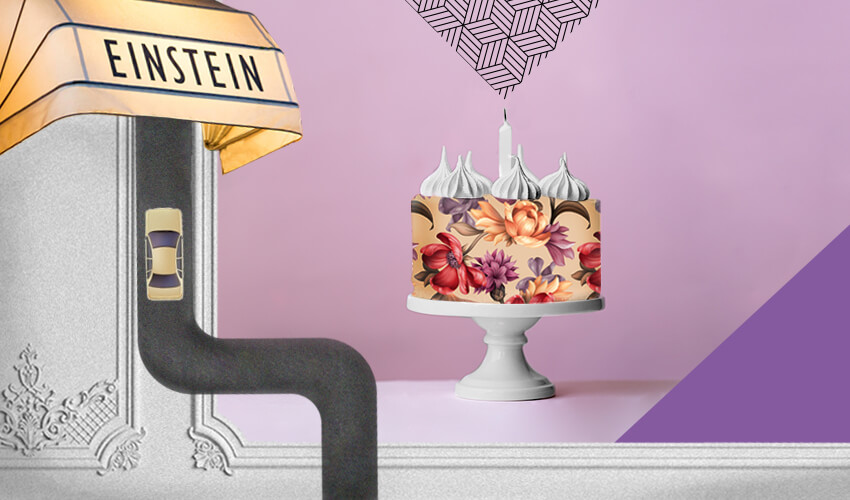
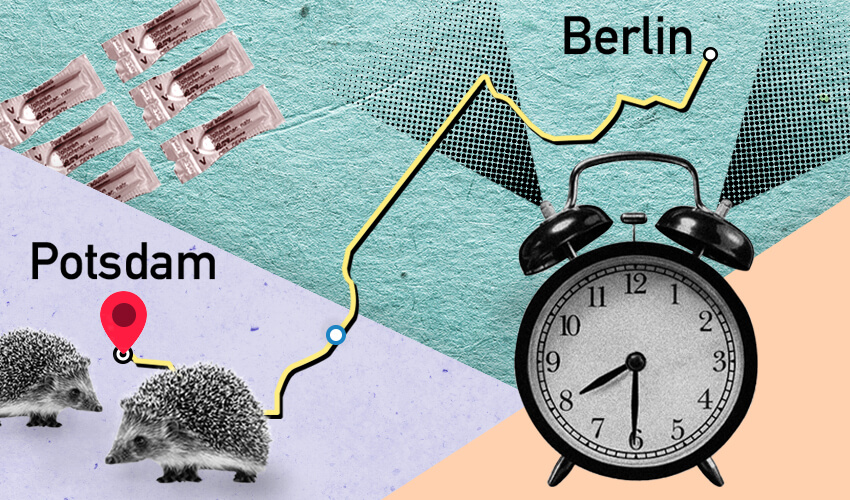


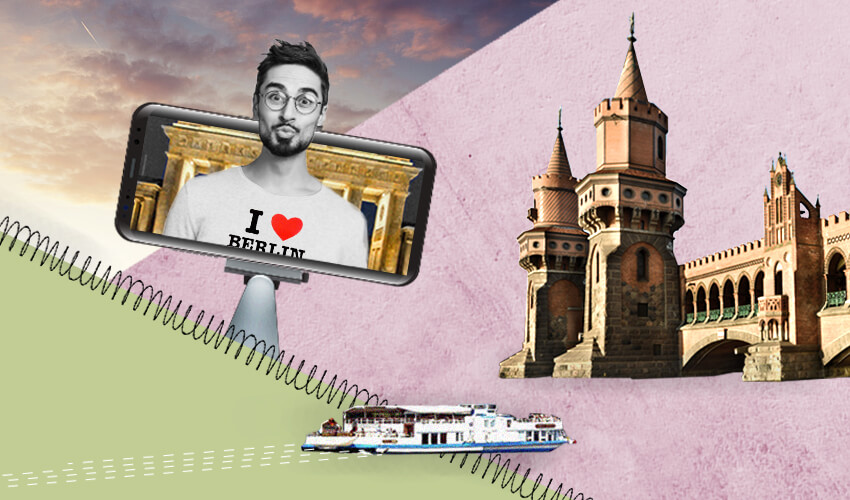



Ich bin vielleicht einer der wenigen, aber ich bin tatsächlich sehr gespannt auf das neue alte Stadtschloss. Sehr gespannt.
Noch nicht ganz überzeugt, aber gespannt bin ich auch. Hoffentlich lohnt sich das ganze Geldverschleudern am Ende wenigstens.
Die „offene Baustelle“ scheint ja schon jetzt große mengen an Menschen anzulocken. Das Schloss als Publikumsmagnet funktioniert wohl.
…und im Gegensatz zu manch anderen Berliner Großprojekten soll es sogar pünktlich (genau zu Humboldts 250tem Geburtstag) fertig werden.
No Fire, The Dude… Herr Rinke, dass Sie als pensionierter Hamburger coolere Orte kennen als mancher Jung-Berliner ist ziemlich klasse.
Pensionierter Berliner. Im Sinne Kennedys zumindest. Haben sie denn den Text micht gelesen?! 😉
Bei dem kreativen Output kann man nicht mal von pensioniert sprechen. Herr Rinke schreibt und veröffentlicht ja ohne Pause…
Kann ich nachempfinden. Film, Fauna Vergisstmanicht. Und beim Sommerplanschbesuch vom grauen Bootsteg aus, sah ich Fischlein versehentlich unter Wasser. An den Haaren hat sie mich rausgezogen – gerettetet, die Erika.
Die Haare. Wie weg sie sind!
zahm und langweilig
Der Westen? Zahm und lahm wäre dann aber eine schönere Bewertung gewesen 😉
Das titelgebende Wortspiel bezieht sich auf mein Leben grunewaldseitig der Halenseebrücke. Richtung Kurfürstendamm, Kreuzberg war es zum Teil schon recht rau – bis es jenseits der Mauer befohlenermaßen wieder spießig wurde.
Bis Halensee habe ich es sogar schon mal geschaft. Weiter raus bisher noch nicht. Soviel zu tun und seh’n in dieser großen Stadt.
Ein wunderbares Beispiel dafür, dass Heimat nicht unbedingt der Wohnort sein muss.
Vielleicht lag Humboldt gar nicht so falsch: Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Sie bestimmt die Sehnsucht danach, und die Entfernung vom Heimischen geht immer durch die Sprache am schnellsten.
Ich kenne aber auch den Verdacht, dass einem ein Mensch deshab sympathisch bleibt, weil man ihn – fremdsprachlich – nicht so genau versteht. Umgekehrt kann weniges trennender sein, als jemandes Worte genau zu verstehen, seine Haltung aber zutieft abzulehen.
Vielleicht ist das zu kryptisch… aber wenn man’s im übertragenen Sinne nimmt, also man ganz unabhängig von Worten „dieselbe Sprache“ spricht, stimmt’s wieder.
Und wie immer: wieviel Phantasie und Wahnsinn in diesen Filmausschnitten!
Man nennt es wohl Hannomanie. Oder zumindest rinkesk.
Schon auch ein klitzekleines bischen pretentiös. Aber zumindest sympathisch.
Prätenziös ist effekthascherisch. Ich hasche aber nicht bloß, ich fange auch.