

Als besonders gut und schön gelegen hatte ich das ‚Katz Orange‘ ergoogelt. Dahin fuhren wir nun nicht. Man hatte Silke dort vor vierzehn Tagen einen Tisch um sieben oder um halb neun angeboten. Solche Einschränkungen kann ich nicht besser ausstehen als Frühstücksbuffets. Da gefiel mir das ‚Brecht’s‘ dann schon besser. Den amerikanisierenden Namen des Autors, dessen Lebenswandel mich nichts angeht, dessen Theaterstücke mich nur zum Teil begeistern und dessen Gedichte ich schätze, fand ich doof-modisch, aber die Tische direkt an der Spree gegenüber dem Bahnhof Friedrichstraße gefielen mir auf dem Foto, und die Speisekarte auch, obwohl ich durchaus gern mal in ein Lokal gegangen wäre, das nicht von sich behauptet, die authentischsten Wiener Schnitzel außerhalb des ‚Ersten Bezirks‘ anzubieten.

Foto oben: Privatarchiv H. R. | Foto unten: Bundesarchiv, Bild 183-W0409-300 / Kolbe, Jörg / CC BY-SA 3.0 DE, Bertolt-Brecht, CC BY-SA 3.0 DE/Wikimedia

Zu unserem Abendessen hatte ich auch Peter Böhme gebeten. Sein langjähriger Lebensgefährte Wilfried war Rolands Liebhaber in den 60er-Jahren. Dass Roland nach den Trennungen von Tisch und Bett seine vielen in die Brüche gegangenen Beziehungen weiterhin freundschaftlich pflegte, hat mir zu vielen neuen Bekanntschaften verholfen. Ich hatte es ja 1972 mit Pali genauso gehalten, und mehr feste Liebesbeziehungen hat es in meinem Leben nicht gegeben. Auch sonst war der Unterschied nicht groß: Roland war seinen Partnern davongelaufen, und ich Pali. Als ich Roland 1975 kennenlernte, begann er, sich nach der endgültigen festen Bindung zu sehnen und ich mich danach, täglich die Sau rauszulassen. Dass das bis zu Rolands Tod gut gehen würde, war nicht zu erwarten. Tat es auch nicht, nicht immer. Aber Treue spielt sich nicht im Schwanz ab, sondern im Kopf, und da bin ich Roland bis heute auf eine törichte Weise treu geblieben.
Peter war allein gekommen. Winfried löste gerade den Nachlass seiner Mutter in Braunschweig auf. Immer noch sah Peter aus wie von El Greco gemalt: schmal und ernst, aber seine Züge können vorhersehbar ihre Weichen ins ironisch Verschmitzte stellen. Seit Peter nicht mehr für die Berliner Festwochen arbeitet, sondern pensioniert ist, hat er sich kaum verändert. Hektisch wirkte er nie. Ich platzierte Peter neben mich, damit seine Gemessenheit mir nicht unter Brisuppes und Rafałs Quirligkeit verloren ging. Martin filmte die Spree und die Anwesenden, bestellte, wie immer unbekümmert, das Teuerste von der Karte und verschwand in die hereinbrechende Nacht. „Die dunklen Wolken … das gibt Regen“, hatte ich, wie immer misstrauisch, bevor er ging, vermutet. „Nein“, sagte Martin mit Blick auf sein Smartphone, „das zieht da hinten weg“, er wies nach Nordosten. Meine Angewohnheit, Vorhersagen keinen Glauben zu schenken, überspielte ich so, wie ich das seit dem Kommunionsunterricht gewohnt war, und bestellte Nachtisch, den einzigen Gang, vor dem ich keine Angst habe. Dann fing es wie verrückt an zu gießen.

Foto oben: Wikimedia Commons/gemeinfrei | Foto unten: hlphoto/Shutterstock

Wir flohen nach drinnen, das war ganz herrlich! Szenenwechsel liebe ich auf allen Bühnen: Im halb leeren, schummerigen Lokal ein wunderschön gerichteter Sechsertisch mit Blick auf den zugeregneten, scheinwerferglänzenden Bahnhof Friedrichstraße, den ich als widerlich abstoßendes Symbol der Hässlichkeit von Unterdrückung in meiner Erinnerung gespeichert hatte – jetzt strahlend schön. Das Dessert krönte die süße Stimmung. Eine Taxe brachte ‚Brisuppe‘, die so anreden zu dürfen nur ich das Privileg genieße, und Peter, der in Görlitz geboren ist, nach Westen, eine andere Droschke beförderte Giuseppe, Rafał, Silke und mich tiefer in die Mitte, Carsten fuhr mit Sally. Es war warm geblieben, hatte aufgehört zu regnen und wurde allmählich Zeit für die drei Fremdheimischen zu erkunden, was eine subtropische Dienstagnacht Männern zu bieten hat, denen Frauen keine Verlockung darstellen.

Foto: Kadmy/Fotolia
Giuseppe ist (späte) Anfang sechzig und immer froh, etwas zu erleben. In seinem Dorf erlebt er nichts. Carsten ist 51, schlank, groß, hat viel an den Seiten kurz geschorenes, aschblondes Haar, war bei ‚Del Monte‘, das ich seit meiner Kindheit von den Dosen-Ananas kenne, die es bei uns an Festtagen mit Schlagsahne gab, und ist jetzt selbstständig im Lebensmittelbereich, den man bestimmt ‚food‘ nennt.

Foto: Privatarchiv H. R.
Rafał ist 37, drahtig, flink und absolut zuverlässig. Das war Roland auch. Aber Roland war verträumter, verschlossener, hörte jeden Tag Klassik und las im Urlaub Proust.

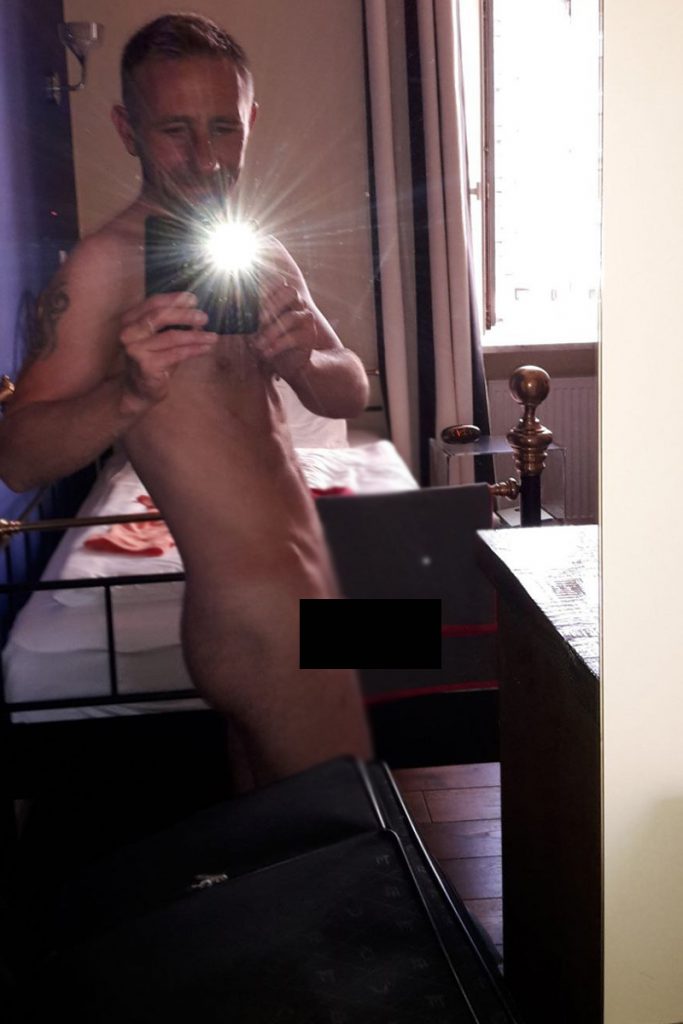
Fotos (3): Privatarchiv H. R.
Ich lag im ‚Dude‘-Bett, es war schon zwei nach neun am Morgen, und Rafał war nicht wie verabredet um neun erschienen. Er sitzt noch mit Silke und Giuseppe beim Frühstück, wusste ich, aber im Dunkel meiner Seele blitzte der Gedanke auf: Sie sind ohne mich abgereist. Warum ich solche unsinnigen Ideen nicht loswerde, hat mir mal jemand, der für Seelen zuständig ist, erklärt. Es liegt eigentlich an Beckers Kohlenbalkon.

Foto: Privatarchiv H. R.
Kurt Becker rief eines Morgens bei meinem Vater an und sagte: „Ich bin heute Nacht ausgebombt, kann ich zu dir kommen?“ Guntram antwortete in seiner lakonischen Art: „Kannst du machen, musst dich aber beeilen. Mein Haus steht maximal noch zwei Stunden.“ Das war im Sommer 1944. Da hatte mein Vater im Zug von Posen nach Berlin schon meine Mutter kennengelernt. Er kam von Verhandlungen mit der SS und wollte nach Hause. Sie wollte in der Türkischen Botschaft Asyl beantragen, weil sie witterte, dass man ihrer Herkunft auf die Schliche gekommen war. Statt zu den Türken ging sie dann aber lieber zu Guntram, und nun konnte auch sie nicht mehr in dessen zerstörter Grunewald-Villa Unterschlupf finden.

Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Der ‚Prokurist‘ (schon wieder) Jacoby hatte ein Haus in Frohnau, aber sich mit seiner Frau zu deren Eltern aufs Land abgesetzt. So zogen Guntram und Irene bei ihm ein. Irene hat dort das Kriegsende erlebt, ohne dass eine Bombe gefallen wäre. Bald darauf kehrte Guntram aus seiner zweitägigen russischen Gefangenschaft zurück (die Hintergründe dafür lasse ich mal weg). Er hatte sich als ‚letzte Goebbelsspende‘ sowieso keine Illusionen gemacht, sondern gewusst: „Wenn die erst mich brauchen, ist der Krieg verloren.“ Von da an lebten beide arm, aber glücklich im Grünen, bis zuerst die Franzosen kamen, gleich die schöne Jacoby-Villa beschlagnahmten – und dann kam ich. Da waren Guntram und Irene bei Kurt Becker und seiner Frau Carola in der Reichsstraße in Neuwestend untergekommen. Carola war nach Irenes Ansicht eine ‚typische Berlinerin‘, worunter meine Mutter eine Frau verstand, die sehr schnell spricht und ziemlich wenig sagt. Als sich Carola 1956 umbrachte, weil Kurt mit Gerda ins Bett ging, weinte Irene, inzwischen in Hamburg, trotzdem sehr, aber damals, 1946 erlaubte Carola nicht, dass mein Kinderwagen ‚nach vorne raus‘ stand. Ich musste auf den Küchenbalkon, neben die Kohlen. Mein Vater saß im Gefängnis (warum, lasse ich hier auch weg), Herr Schönhorst ließ meine Mutter hungern, obwohl er selbst das Geld auf dem Schrank stapelte; nur einmal brachte er ihr eine Ladung Grünkohl, weshalb später dem Grünkohl der Weg in unsere Küche und Herrn Schönhorst der Weg in unser Wohnzimmer versagt blieb – und ich war schwarz, wenn meine Mutter mich abends vom Balkon holte. Das war zu viel! Im Juni 1947 gab mich Irene zu ihrer Schwiegermutter nach Schmalkalden. Dort traute meine Mutter der Luft zu, gesünder zu sein als im rußgeschwärzten Berlin.


Foto oben links: Barbro Bergfeldt/Shutterstock | Fotos (2): Privatarchiv H. R.

Zunächst mal sorgte meine Großmutter dafür, dass ich getauft wurde. Nun wurde ich im protestantischen Thüringen katholisch und war es später vorübergehend so sehr, dass ich den Papst im Glauben hätte bestärken können. Dann aber reichte mich die praktische Oma durch zum Bahnwärter, der sowieso schon fünf Kinder hatte, da kam es wohl nicht mehr so darauf an. Ob es im Bahnwärterhäuschen nicht vielleicht doch von den Lokomotiven her genauso kohleschwanger war wie bei Beckers oder ob mir (vermutlich sexuelle) Gewalt angetan wurde, konnte ich seither werden erinnern noch herausfinden, jedenfalls schrie ich so unerträglich, dass meine Mutter Ende Oktober kategorisch aufgefordert wurde, mich wieder abzuholen.


Foto links: Privatarchiv H. R. | Foto rechts: Von Halfpoint
Noch ein paar Monate später kam Guntram aus dem Gefängnis, erzwang, wie schon erwähnt, die Scheidung von seiner ersten Frau, heiratete Irene und ließ auf dem Standesamt meine Geburtsurkunde fälschen, so dass ich ehelich wurde. Gleichzeitig zogen meine Eltern mit mir in die aufgehübschte Geiger-Ruine am Koenigssee, und von da an war ich behütet. Die Wochen nach Schmalkalden seien die einzigen gewesen, in denen ich vernünftig gegessen hätte, erzählte Irene später. „Die haben dich hungern lassen“, vermutete sie entrüstet. (Oder ich habe die Nahrung verweigert, wie ich es schon mit der Brust meiner Mutter getan hatte. „Sie haben mir die schöne Milch abgepumpt!“, lautete später ihr Vorwurf an mich.)

Foto: Privatarchiv H. R.
Die Fürsorge war groß, die Angst blieb. Immer wenn meine Eltern weggingen, befürchtete ich, sie kämen nicht wieder. Nachts lauschte ich noch an ihrer Schlafzimmertür, als die schon nicht mehr, Ende der Fünfzigerjahre, allzeit für mich offenstand: ein Geräusch, eine Drehung – Erleichterung. „Klar“, fand der Experte für psychische Störungen, „die Zeit in Schmalkalden damals hat Ihre Verlassensängste programmiert.“ Weiß ich. Wissen ist nicht Verstehen.


Fotos (2): Privatarchiv H. R. | Foto oben rechts: RedlineVector/Fotolia











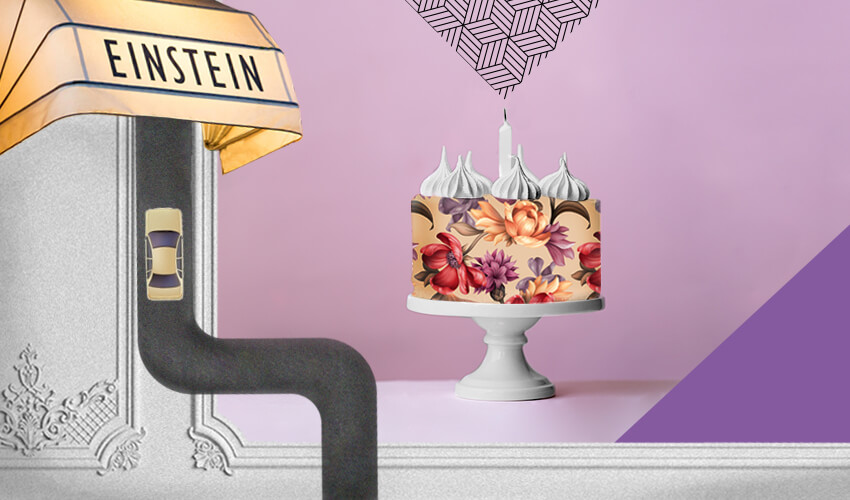
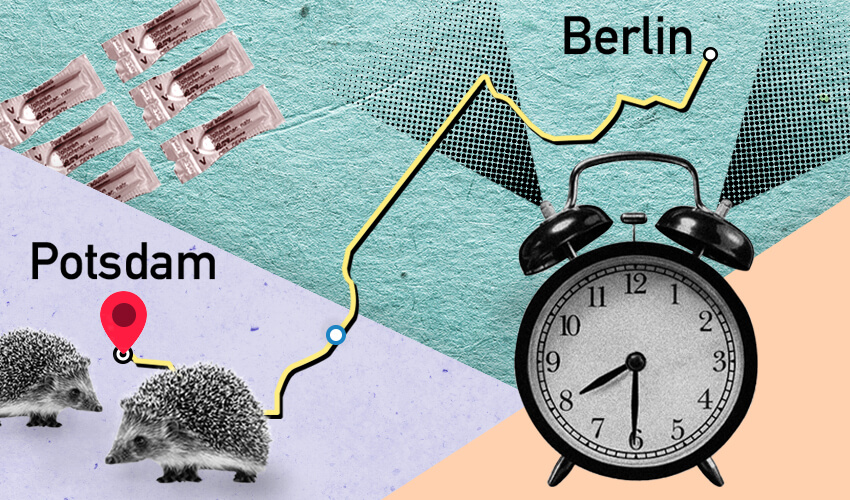

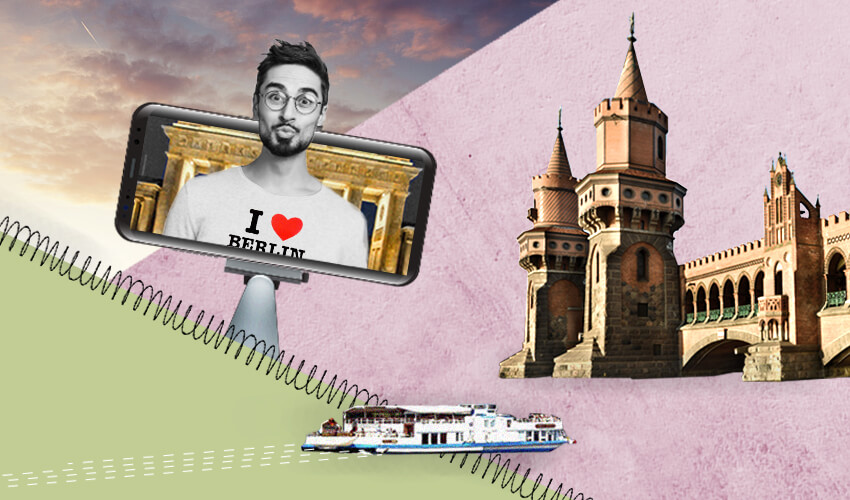



Ah wie Schade, dass sich das Katz Orange quer gestellt hat. Das hätte es ihnen sicher auch mit kleinem Appetit gefallen.
Überhaupt nichts gegen hochpreisige Restaurants, aber ist das Katz für die gebotene Qualität nicht doch ein wenig überteuert?
Am liebsten bin ich im „Cassambalis“, und vielleicht hat ja Angela Merkel auch demnächst wieder mehr Zeit, dorthin zu gehen …
Wenn Wissen = Verstehen wäre, wären ja auch alle Psychiater arbeitslos. So einfach geht‘s dann eben doch nicht.
Die Psychiater sind für‘s Verstehen ja gar nicht unbedingt zuständig. Geht also schon in Ordnung.
Ach so ist das, ihr eingeschränkter Appetit geht sogar bis in‘s Babyalter zurück?! Interessant, interessant!
Geht nicht sowieso immer alles auf unsere Kindheit Zurück?
Auf die Kindheit und die Eltern. Vor allem das Verhältnis zur Mutter ist ausschlaggebend. Immer. Gnadenlos.
Das teuerste von der Karte … kann ich sehr nachempfunden. Mich zieht es auch immer instinktiv dorthin.
Über Geschmack lässt sich halt nicht streiten, nicht wahr?!
Über Geschmacklosigkeiten aber doch. Was mir teuer ist, ist mir nicht automatisch auch lieb.
Oh über Geschmacklosigkeiten kann man sogar stundenlang streiten. Und zwar mit großer Leidenschaft.
Wunderbar späte Anfang Sechzig kommt auf meine persönliche Liste an Rink’schen Bonmots! 🙂
Besser später Anfang als frühes Ende 😂
Und ich dachte immer ein typischer Berliner ist jemand, der eher wenig spricht. Und wenn, dann auch nur widerwillig…
Sprechen tun sie schon ganz gerne. Nur grantig können sie sein…
… die Bayern doch erst recht. Die „Berliner Schnauze“ zeichnet sich nicht durch Schweigsamkeit aus.
Das Gute an solchen Klischees ist ja, dass sie sich in der Regel eh von alleine wiederlegen. Bayern wie Berliner sind besser als ihr Ruf.
Täglich die Sau rauslassen ist ambitioniert Herr Rinke. Sind Sie sich da über die Jahre treu geblieben?
Die Ambition ist geblieben. Die Säue haben gewechselt.
Inzwischen sind sie sehr vergeistigt. Vergreisigt.
Hahahaha das Mirror-Selfie habe ich gerade erst gesehen. Super! Und zack sind die privaten Nacktbilder für immer im World Wide Web.
Ob der arme Rafal von seinem Glück weiss? Oder freut er sich sogar? Erweitert ja auch die Reichweite…
Der schwarze Balken, den meine Agentur spendiert hat, der schützt doch alle Beteiligten: rechtlich und religiös. Dabei brauchte Rafal sich wirklich nicht hinter diesem Balken zu verstecken.
LOL, das ist gut zu wissen. Social Media bietet dem eingefleischten Exhibitionisten jedenfalls unbegrenzte Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist das sogar gut so. Vielleicht macht es den ein oder anderen glücklicher. Sich austoben ist immer richtig.
Die Sozialen Netzwerke bieten vor allem Gelegenheit. Ansonsten verändern sie unser Leben bzw. die Menschen gar nicht so sehr wie alle immer sagen.
Gelegenheiten verändern aber unser Leben!