

Auch für Koenigssee und Wissmannstraße hatten wir gutes Wetter im 19er-Bus, in dem schon meine Großmutter die Halenseebrücke zwischen Kurfürstendamm und Grunewald überquert hatte.
Mit der Halenseebrücke hat es folgende Bewandtnis: Palis Vater war Architekt und befreundet mit dem prominenten Architekten Hans Peter Poelzig, dessen Frau in den Siebzigerjahren über die Halenseebrücke ging, umknickte und sich den Knöchel brach. Seither weigerte sie sich beharrlich, je wieder die Halenseebrücke zu betreten. Das kostete Zeit und Geld. Die Halenseebrücke ist zwischen Grunewald und Stadtzentrum genauso ein Nadelöhr wie die Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam. Der strikte Vorsatz der Gestrauchelten ist vergleichbar mit dem Prinzip, auf dem Weg von Calais nach Dover den Ärmelkanal zu vermeiden: Busse kamen nicht infrage, Taxen kosteten zehn Mark mehr, und der Fußweg über die Paulsborner Brücke dauerte zwanzig Minuten länger. Frau Poelzig hatte Zeit und Geld. Palis Pointe: ‚Jeder leistet sich genau die Verrücktheiten, die er sich leisten kann.‘ Da habe ich in meinem Berufs- und Privatleben eine Menge Erfahrungen gesammelt, und der symbolische Wert der Halenseebrücke, die zu überschreiten man bereit oder nicht bereit war, überflügelte den historischen Wert der Ost-/West-Gefangenenaustausch-Brücke von Glienicke in Palis und meinem Sprachgebrauch beträchtlich.
Die mildernde Natur hat den Beton unseres ehemaligen Grundstücks so gütig-üppig überwuchert, dass die Anlage zum See hin jetzt auch im Tessin liegen könnte und ich meinen Frieden mit ihr gemacht habe. Am Hasensprung stand die Zeit still: Das tut sie dort immer, und die steinernen Hasen springen vergnügt in beide Richtungen, mit heilen Ohren und unbeschmiert. Das war nicht immer so. Das Gepflegte ist in Berlin noch gepflegter geworden, das Verrottete verrottet ärger als zuvor: Bis die Individualisten kommen und die Avantgardisten und die Kapitalisten. Oder die Anarchisten.
Vorbei an meinem Kindergarten fuhren wir zurück zur Halenseebrücke. Ich war nicht gern Kind und ich war nicht gern im Kindergarten, denn ich mochte Kinder genauso wenig wie meine Eltern sie mochten: Kinder sind unbarmherzig. Brutal quälen sie jeden Außenseiter: wegen seines Namens, seiner Kleidung, seiner Haar- oder Hautfarbe. Jede Schwäche nutzen sie aus. Es dauert Jahre, um aus den alles andere als unschuldigen Wilden erträgliche, stille, angepasste Zahme zu machen. Bei manchen gelingt es nie. Sie werden Helden oder Narren.
Was Theater, Revuen, Museen und Ausstellungen anbetraf, so ließe sich vieles aufzählen, dem wir fernblieben. Trotz eifriger Suche im Internet und Befragung aller Eingeweihten fand sich zwischen Friedrichstadt-Palast und Theaterkeller nichts, was unseren Anforderungen an abendlicher Unterhaltung oder Überhöhung entsprach. Vielleicht ist Berlin doch immer noch nicht der Broadway oder das West-End. Vielleicht waren wir durch Schwerin einfach zu verwöhnt. Eine Stadt mit drei Opernhäusern ist einmalig. Die Programme waren es nicht.
Das Korrekturlesen meiner von Silke aufopfernd in den Computer getippten Briefe nahm viel mehr Zeit in Anspruch, als ich mir ausgemalt hatte. An das Schreiben eines Resümees war schon deshalb nicht zu denken, weil wir uns, um auch nur einigermaßen vorwärtszukommen im Text, nur knappe Ausflüge in die Wirklichkeit erlauben konnten, die zu flüchtig blieben, um substanzielle Schlussfolgerungen zu ziehen. So hatten wir außer zu dem Herrn hinterm Bier im ‚Marché‘ auch keine weiteren Kontakte, wenn man von ‚Motz‘-Verkäufern absieht. ‚Motz‘ ist die Berliner Nichtsesshaften-Zeitung, die ihre prominenteste Doppelseite im Mai einer farbig gestalteten Auswahl von Hundehaufen widmete. Solche Begleiterscheinungen der Tierliebe mögen Obdachlose auf der nächtlichen Suche nach einem Lager noch mehr beeinträchtigen als behauste Gehwegtreter bei Tag.
Wir hatten großes Glück, dass das Restaurant schräg gegenüber von ‚Dittberner‘ schon um neun zum Frühstück geöffnet hatte, sodass Silke bereits übers Papier gebeugt saß, wenn ich mich irgendwann nach zehn aufraffte und das schwarze Tuch vom Gesicht zog. Auf meine elf Stunden Schlaf ließ ich nichts kommen – bis auf ein Morgenschlückchen. Das ‚Keno‘ war ansprechend, die Bedienung auch: Sie fragte immer, ob sie noch was bringen könne. Einmal haben wir sogar abends dort gegessen, war auch gut. Die Speisenden waren nett angezogen und die Atmosphäre gefiel uns. Den bei Weitem größten Vorteil aber bot die Lage des ‚Keno‘: Weiter hätten wir unsere Aktenordner unmöglich schleppen können.
Am Mittwoch ging mir der Sprit aus. Ich ließ Silke sitzen und erwanderte mir, den Ku’damm kreuzend, in der Mommsenstraße eine Weinhandlung. Vorbei an weiß gedeckten Tischen, an denen kurzhaarige, beschlipste Jungmanager miteinander lunchten, die Finanzmärkte erörterten und stilles Mineralwasser tranken. Sie hatten Sonnenbrillen auf und saßen im Schatten von Akazien oder Markisen. Die Bestecke und Gläser flirrten dazwischen, die Hauseingänge waren wuchtig und dezent lackiert. Es war alles sehr schön. Für eine Flasche Gin musste ich in der erlesenen Weinhandlung 22 Euro zahlen. Meine entleerte Toom-Gin-Flasche hatte 6 Euro gekostet. Ich fand, das geschah mir recht. Silke hatte es inzwischen geschafft, ihren Hotelschlüssel in die Ritze zwischen Flur und Fahrstuhltür fallen zu lassen. Das gelingt nur in nüchternem Zustand.
Blieben von meinem Programm noch die Freunde und Verwandten: Hanno und Christine waren gleich am ersten Abend vorgekommen. Marina und Florian luden uns ein, den katholisch bedeutsamen Fronleichnamsdonnerstag bei ihnen prozessionslos zu verbringen und auch in ihrem Haus zu übernachten. Als sich abzeichnete, dass Irene mit Hilfe von Herrn Teßmer, Frau Bernstein und Kontrollanrufen unser Fernsein überleben würde, sagten wir freudig zu.
Dorothee klagte am Telefon, dass es ihr nicht gut ginge und sie zu viele Gäste und Logierbesuche habe. Es klang glaubhaft, immerhin ist sie 86! Aber bei Mittwochabend mit Dorothee und Anette sollte es bleiben, und im Übrigen könnten wir jederzeit bei ihr klingeln, die andern täten das auch ‚alle‘. Wir taten das nicht. Erstens wegen der zu erwartenden Schlangen vor ihrer Eingangstür und zweitens hatte ich ja ‚Dorothee satt‘ virtuell: beim Korrekturlesen. So brauchte ich ihr nicht die reale Zeit zu stehlen, von der hat man ja in ihrem Alter wenig zu verschenken. Aber dann sagte sie mir auch noch wegen – bei Dorothee eigentlich undenkbar – Überlastung den Mittwoch ab. Da war ich dann doch traurig.
Am folgenden Sonntag fragte sie meinen Anrufbeantworter empört, wieso ich mich noch nicht zurückgemeldet habe. Seither schweige ich eisern. Ich rede mir ein: aus Trotz, weiß aber, dass ich Angst vor ihr habe. Das kommt davon, wenn man Freunde bedroht: Am Ende kriegt man noch weniger ab, als man einfordern wollte.

Titelbild (Foto mit Halenseebrücke): gemeinfrei/public domain

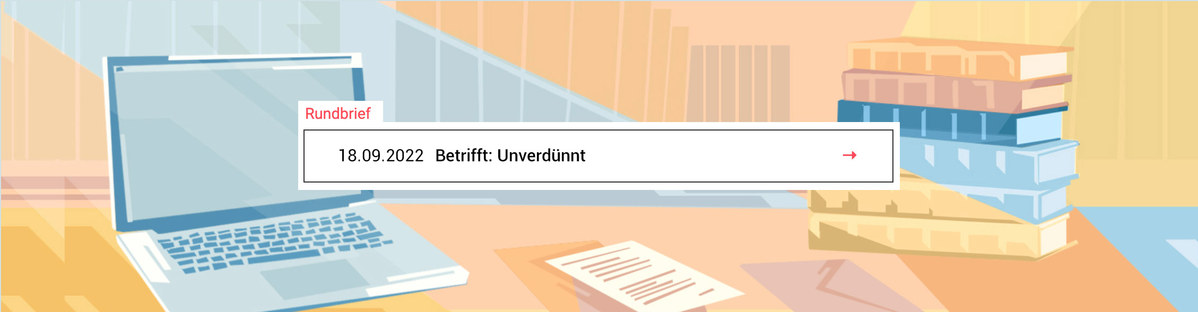








Wer sich auf Anrufbeantworter verlässt, der braucht sich auch nicht wundern, wenn er keine Antwort bekommt.
Man kann ja einfach nochmal zurückrufen, wenn es dringend ist.
Früher verbrachten Tatort-Kommissare die Hälfe ihrer Sendezeit am Schreibtisch. Jetzt können sie sich per Handy über die nächste Leiche unterrichten lassen, während ihnen auf der dekorativen Müllhalde ein Verdächtiger durch die Lappen geht oder sie mit einer interessanten Frau in einem betont unauffälligen Lokal etwas betont Unauffälliges zu sich nehmen.(Dass sie die Täterin ist, weiß der angeschäkerte Beamte erst kurz vor Schluss, der ergriffene Zuschauer auch nicht erheblich viel früher.)
Seitdem Handys so richtig verbreitet sind, gibt es auch deutlich weniger Anrufbeantworter. Oder kommt mir das nur so vor?
Voice Mails gibt es aber auch auf Smartphones noch.
Und sie nerven nicht weniger als die Festnetz-Variante.
Kann man die Voicemail nicht sogar deaktivieren?
Deaktivieren kann man so gut wie alles, nur traut man sich meist nicht.
Oh, dass ihre Freundin Silke sich auch noch um die Digitalisierung ihrer Briefe und Aufzeichnung kümmert …. das muss ja wirklich eine noch engere Freundschaft sein, als man eh schon vermuten konnte.
Beste Ergänzung, ähnlicher Geschmack.
Ich erinnere mich zwar nicht so wirklich, aber trotzdem scheint mir die Kindergartenzeit immer positiver im Gedächtnis verankert zu sein als die Grundschule. Es mag aber sein, dass sich das mit der Zeit einfach verklärt hat.
Die Zeit im Kindergarten war sicher noch einmal unbedarfter und sorgenfreier. In der Schule wird es ja dann quasi schon zum ersten Mal ernst.
Ich weinte, als ich (als Einzelkind berechtigterweise) in den Kindergarten geschickt wurde. In der Schule war ich (als Klassenjüngster bis zum Abitur) tränenlos stolz, wenn auch zwischendurch ziemlich mittelmäßig.
Also bei mir haben weder Schule noch Kindergarten haben einen großen Eindruck hinterlassen. Klar, man wird schon irgendwie geprägt in dem Alter. Aber wenn ich auf mein Leben heute und meine Freunde schaue, dann sehe ich ganz ehrlich keinerlei Verbindung zu dieser Zeit.
Zumindest die Oberstufe legte den Grundstein zu dem Bildungsbau, den ich jetzt bewohne.
Unbeschmiertes wird wirklich seltener. Wenn die Schmierer doch wenigstens etwas einfallsreicher werden würden.
Ich finde Graffiti selten schön. Aber dass in letzter Zeit noch mehr geschmiert und gesprayt wird als bisher schon, das würde ich auch nicht sagen.
Graffiti kann toll sein. Meistens ist es aber nur selbstsüchtiges Geschmiere. In gefährdeten Gegenden: Video-Überwachung, Bestrafung der Täter. Ich wäre ja für Hand abhacken, aber Wände streichen zu müssen, reicht vielleicht. In den Ostblock-Staaten gab es Graffiti nicht. Wohlstandsverwahrlosung.
So oft kann man ja gar nicht hinterherstreichen wie wieder neu besprüht wird. Leider ist das so.
Elf Stunden Schlaf?! Das ist respektabel. Ich denke ja selbst immer, dass ich mehr schlafen sollte. Aber dann schaffe ich es abends doch wieder nicht zeitig ins Bett und am nächsten Morgen werde ich trotzdem früh wach. Da hilft auch keine Schlafmaske um mir vorzugaukeln, dass es noch immer Nacht wäre.
So viel Schlaf, das ist nur mal eine Phase. Meistens schlafe ich von zwei bis zehn. Aber wenn ich weiß, ich muss um sieben raus, bin ich schon um sechs wach.