

Ich möchte meinen Berlin-Zyklus ‚WACHS!‘ mit den beiden letzten Briefen beenden, die ich je von einer Berlin-Reise geschrieben habe. Seit den ersten Briefen von 1967 kam da schon eine ganze Menge Text zusammen. Silke und ich nahmen die Ordner mit den ausgedruckten Abschriften im Jahr 2005 mit, als wir wieder mal nach Berlin fuhren.
Mein Vater hatte mir, als ich fünf war, etwas beibringen wollen und mir erklärt: „Wir sind in Berlin. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.“ Das stimmte damals nicht, aber er war es so gewohnt. Ich wollte interessierter erscheinen, als ich war, deshalb fragte ich zurück: „Und was ist die Hauptstadt von Berlin?“ Mein Vater hat noch schlimmere Enttäuschungen mit mir erlebt, mehr sportliche als intellektuelle, aber ich hatte sechzig Jahre später die Idee ‚Die Hauptstadt von Berlin‘ zur Überschrift meiner Berlin-Sammlung zu machen. Dann habe ich sie aber doch nicht veröffentlicht, sondern brüte noch von Zeit zu Zeit an der Auswahl.
2008 waren Silke und ich wieder in Berlin: Der letzte Brief, inzwischen nicht mehr wie früher an meinen Freund Pali, er war tot, sondern an die nichts ahnende Menschheit. Danach gibt es noch einen Berlin-Ausschnitt in meinem Film von 2015. Den bringe ich als Abschluss dieses Projekts. Seit 2014 sind meine jährlichen Berlin-Aufenthalte in den jeweiligen umfangreichen Reiseberichten im Blog festgehalten. Mehr geht nicht. Und muss auch nicht.
Mai 2005
„Siehst du“, sagte ich zu Silke, „das hier war die ‚gute Stube‘.“ Ich war mir nicht völlig sicher, aber der Raum war mit Möbeln und Tapeten derart als ‚gute Stube‘ hergerichtet, dass es einfach stimmen musste. Und selbst wenn das Berliner Zimmer nachgebaut sein sollte, so war es doch weniger verrückt als das Stück vom Kaisersaal des Hotels ‚Esplanade‘, das die bedauernswerten Sony-Eigentümer mit riesigem technischen Aufwand um 50 Meter verschieben und in ihr Center eingliedern mussten – um der Denkmalpflege willen; genauso wie die ‚Victoria‘ das Tortenstückchen ‚Kranzler‘ hatte stehen lassen müssen. Lutter & Wegner liegt jetzt 150 Meter weit weg vom Stammplatz, aber neu gebaut, das geht ja noch.
Gibt es eine andere Stadt, die so gnadenlos in Trümmer gelegt, so gnadenlos entrümpelt, so gnadenlos wieder aufgebaut wurde und in der gleichzeitig so verbissen um Raritäten gekämpft wird, die nichts weiter sind als Stadt-Nippes? Wer keine Juwelen hat, muss halt seine Glasperlen nehmen, um stolz zu sein.
„Ja, ‚Mampes‘ gute Stube!“, sagte ein freundlicher Mann, der hinter einem kleinen Bier saß.
Wir befanden uns in der Ku’damm-Filiale der Kette Marché, die meine rührend altmodische Institution ‚Mampe‘ geschluckt hat, und das Nachbarhaus gleich mit. Das Marché bietet dem Gast die Herausforderung, sich in der Unübersichtlichkeit lauter verschiedener Stände selbst zu bedienen, um sich mit modernem Long-, Fast- und Fingerfood mikrowellenmäßig in die Nahrungskette einzugliedern und getränkemäßig eigenbestimmt zwischen Säften, Selters oder Sauvignon zu wählen.
Das Marché ist in derselben aufdringlichen Weise modern, wie ‚Mampe‘ unhaltbar weltfremd geworden war, doch immerhin: Am Eingang hatte das Marché – sei es aus Kalkül, sei es aus Pietät, um auch die Zielgruppe der 50-Jährigen bis Entmündigten (aber noch Schluckfähigen) ebenfalls abzudecken – zwar nicht die Glasveranda zum Ku’damm hin belassen, wohl aber die ‚gute Stube‘, die etwa 95 Prozent der Konsumenten kein Begriff mehr war. Doch Nostalgie schadet nie, und in einer Stadt, die fast nichts hat, lässt sich Tradition besonders leicht vermarkten.
„Davor war ja noch die Veranda“, sagte der Biertrinker.
„‚Mampe‘ halb und halb“, antwortete ich reflexhaft.
„Ja, die hatten Liköre, eigene Schnapsbrennerei“, erinnerte sich der Pensionär, „jibt et alles nich’ mehr. Eine Ecke weiter, da war das ‚Haus Wien‘ mit der ‚Film-Bühne Wien‘ und dem ‚Kurfürstenkeller‘, aber ich will Sie nich’ aufhalten.“ Er saß da, gemütlich und doch eifrig, allein in seinem Raum, in seiner Zeit und erzählte mir meine Jugend. „Das ‚Café Möhring‘, oben an der Schlüterstraße, hier jejenüber das ‚Café Schilling‘ – alles weg, da sind jetzt überall Textilgeschäfte drin und Fastfood-Ketten. ‚Hardtke‘ und noch weiter oben ‚Aben‘, das waren doch die Lokale, in die man ging. Aber ich will Sie nich’ aufhalten. ‚Aschinger‘ war erst an der Friedrichstraße und hat es dann nach dem Krieg noch mal in der Joachimsthaler versucht, da, wo jetzt ‚Beate Uhse‘ ist. Bei ‚Aschinger‘ konnte man zur Erbsensuppe so viel Graubrötchen essen, wie man wollte, das war eine soziale Einrichtung – is’ aber nich’ mehr jejangen.“
„Ja“, sagte ich, „davon hat mir mein Vater oft erzählt, nirgendwo sonst gab es diese kleinen Graubrötchen.“
„Am Hackeschen Markt hat wieder ein ‚Aschinger‘ aufjemacht, is aber bloß noch der Name. Aber ich will Sie nich’ aufhalten.“
„Das war sehr interessant“, sagte ich doof, er nickte, wir nickten, und dann mussten wir wirklich durch die Schwingtür ins Freie, denn wieder mal hatte ich es geschafft, uns in einen intensitätssteigernden Zeitdruck hineinzumanövrieren.
Nun bin ich noch nie absichtslos nach Berlin gefahren, allenfalls gelegentlich mit dem eisernen Programm, mir nichts vorzunehmen, um dann bereits am ersten Tag schwach zu werden und mir die Disziplin umfangreicher Planungen aufzuerlegen. Die waren diesmal schon im Voraus gemacht worden. Silke und ich reisten nicht zum Vergnügen, sondern zum Resümieren. Natürlich konnte solch ein Resümee nur ein – mein! – unser Zwischenergebnis sein, mehr nicht; denn wie lässt sich an vier Tagen im Mai 2005 das Thema ‚Berlin‘ zusammenfassen? Höchstens mit nichtssagenden Schlagworten: Eine Stadt im Abbruch, eine Stadt im Aufbruch, im Einbruch, im Ausbruch, im Umbruch, eine Stadt in Bruchstücken, wie man das seit der Reichsgründung von jedem Tag in Berlin hatte sagen können, eine Zeit lang sogar mit der Chance, für einige der Ausdrücke gehängt zu werden – diesen Nervenkitzel hat New York nie geboten.
Die ganze vergangene Woche über hatte ich Irene geknetet wie Mürbeteig, aber sie wurde nicht mürbe, sondern bestand zäh darauf, mir ständig die Vorzüge unseres Hauses gegenüber allen anderen Gebäuden auf der Welt aufzuzählen. Zweifellos wäre es ihr am liebsten gewesen, wenn ich – ihren Ausführungen Glauben schenkend – selber nicht gefahren wäre, aber dieser halb unbewusste Erpressungsversuch lief genauso ins Leere wie meine farbigen Schilderungen all der Schauplätze ihrer Jugend, die wiederzusehen ihr doch Bedürfnis sein müsse. – Also nicht. Wir aber doch: Herr Teßmer, Guntrams Finanzverwalter, versprach als Irenen-Tröster zu kommen, die Witwe von Guntrams Golfpartner Evelyn Bernstein sagte ein bis zwei Mittagessen zu und Hausmeister Candido wurde informiert.
Am Morgen der Abreise hatte Irene die übliche Metamorphose, eine Tiefkühltruhe zu werden, vollzogen. Doch als wir unser Gepäck im Wagen verstaut hatten, taute sie wieder auf, stand im Morgenmantel an ihrer Eingangspforte und sagte wehmütig: „Am liebsten würde ich mir was anziehen und mitkommen.“
„Ja, tu’s!“, feuerte ich sie an.
„Nein, nein.“ Mit ihrem entsagungsvollen Winken war der Vorgang abgeschlossen.
Na ja: 85 ist sie jetzt. Wir waren zusammen in Hongkong und auf Hawaii gewesen. Aber mit fünfundachtzig muss man vielleicht nicht mehr über die Halenseebrücke, deren symbolische Bedeutung wir uns für später aufheben.

Titelbild mit Material von Tiia Monto/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Marché, Ausschnitt/bearb.), Kopiersperre/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Karte/bearbeitet)
#2.58 | Die abgebrannte Kerze#3.02 | Das Gemeinsame von Island und Kolumbien

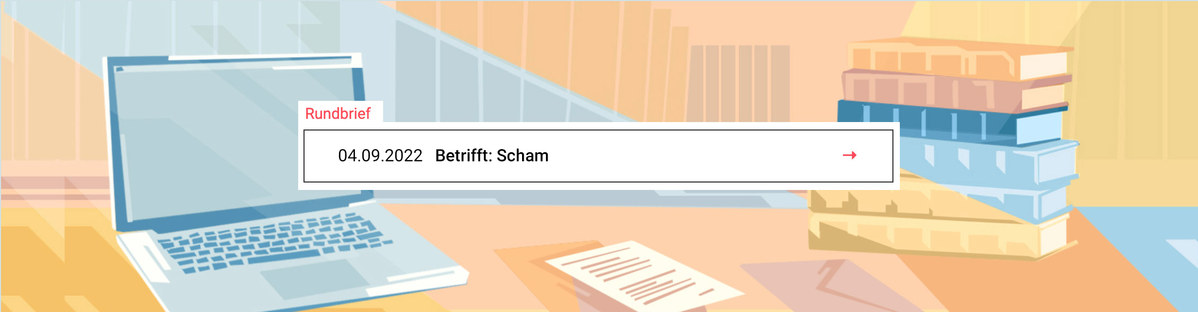








Ah, dieses Stück Kaisersaal kam mir immer ziemlich komisch vor.
Madame Germaine de Staël sagte: „Jeder trägt sein
Dekolleté da, wo er es hat.“
Manchmal muss man es verschieben.
Diese Marchés kenne ich nur vom Flughafen. Ihre Beschreibung trifft es auf den Kopf.
Schrecklich. Und es gibt dieselben einfallslosen Sandwiches wie an jedem anderen Flughafenstand.
„Handgemacht ist unser Geheimrezept.“ (Eigenwerbung)
Der ist Original? Da ist doch nichts handgemacht!?
Würde dann die Werbe-Aufsicht nicht einschreiten?
Candido hatte ich völlig vergessen. Den kennt man doch aus vorherigen Geschichten. Was für ein Name.
Candido bedeutet ‚weiß‘ und gilt in Portugal, huch!, als Mädchenname. Unser früherer Hausmeister ist herzensgut, aber ganz und gar männlich.
Stadt-Nippes 😂 Im Prinzip kommt das ja hin. Aber man muss den Touristen ja was bieten. Den Einheimischen und den jungen Partygängern wird sowas ja eher egal sein.
Ach die freuen sich auch wenn die Stadt zumindest ein bischen hübscher ist.
Manche lieben mehr das Verschlampte und wittern überall Gentrifizierung.
Auch wieder wahr. Zum Glück findet man den meisten Stadt-Nippes ja eh irgendwo im Zentrum. Moabit braucht sich da weniger Sorgen machen.
Sind Hauptbahnhof, Spreebogen, Arminiusmarkthalle und berühmtes Gefängnis nicht Nippes genug?
Ich würde mich so freuen, wenn ich mit 85 auch noch Lust hätte mich in neue Abenteuer zu stürzen. Fingers crossed.
Mit gekreuten Fingern ist ‚Carpe diem‘ schwierig umzusetzen.
Alleine reicht das sicher noch nicht aus. Aber man muss ja trotzdem auf all das hoffen, was man selbst nicht beeinflussen kann.
Und das, was man selbst beeinflussen kann: beeinflussen!
!
Berlin und absichtslos passt ja auch nicht so richtig zusammen.
Naja, es passiert ja so viel um einen herum, dass man auch ohne große Absichten genug erlebt. Aber die meisten wissen wahrscheinlich trotzdem, was sie nach Berlin zieht.
Einfach mal absichtslos schlendern zum Beispiel.
Was nützen einem die vielen Juwelen, wenn die Stadt trotzdem langweilig ist? Bei vielen Reisen kommt mir dieser oder ein ähnlicher Gedanke. Hübsch allein reicht einfach nicht.
Die fremden Menschen und die eigene Stimmung überhöhen den Modeschmuck.
Hässlich und langweilig ist aber auch nicht angenehmer. Da schau ich lieber auf ein paar Juwelen. Und sorge dafür, dass die richtigen Menschen mit mir reisen. Oder ich zu Ihnen.
Gerechtigkeit durch Gleichheit wird es nie geben, weil Hässlichkeit so hässlich ist.