

Winfried sagte mir auch gleich bei meinem ersten Anruf am Ankunftssonntag, dass Peter und er am Montagabend nach Essen führen, und weil er weit draußen in Buckow arbeite, würden wir uns nicht zu viert sehen; Peter habe aber nahe seinem Arbeitsplatz bei den Festwochen ein Mittagessen mit Silke und mir im ‚Manzini‘ geplant. Peter, schön und pünktlich wie immer, etwas altershager geworden, gab keine befriedigende Auskunft über die Notwendigkeit einer Reise nach Essen, kalauerte etwas verlegen: „Verhungern in Essen“, und ließ durchblicken, dass es etwas mit Oper zu tun habe. Peters hervorstechendste Eigenschaft ist seine einfühlsame Zurückhaltung: Er weiß, dass ich Oper nicht leiden kann und Menschen, die sie besuchen oder dafür gar ins Ruhrgebiet fahren, erst recht nicht. Nicht mal die weihnachtliche ‚Carmen‘ auf dem Führerbunker oder ‚Der fliegende Holländer‘ in Auschwitz hätte daran viel ändern können. Dass ich bei der ‚Traviata‘ regelmäßig losheule und mich im ganzen Repertoire von Monteverdi bis Henze gut genug auskenne, um zu wissen, wovon ich rede, macht es bloß noch schlimmer. Peter hatte sogar das Programmheft des Bernstein-Konzertes im Schauspielhaus 1984, das ich mir damals so fummel-fröhlich verdeant hatte, aufgetrieben. Kann Freundschaft weiter gehen?
Nachdem wir eine Weile unerschüttert, aber auch unabgestoßen durch die Stelen des Holocaust-Denkmals geschritten waren, dachte ich, na ja, das wird eine Publikumsattraktion. Kontrovers und einmalig ist es ja, und mehr ist heute nicht nötig. Dass sie keinen Eintritt nehmen können, ist freilich bitter für den Senat. Ich dachte: Zumindest die Vermeidung von Emotionen ist gelungen, und ich sah: ein Taxi. Der Emotionspegel stieg wieder, die Versuchung war einfach zu groß, und ist ein einsames Taxi vor einem solch herausragenden Ort keine Götterbotschaft? Silke, die schon ein wenig über blutige Zehen geklagt hatte, ging der Frage nicht weiter nach, sondern stieg ein.
Wir fuhren zu Anette in die Anklamer Straße zum Tee. Anette verbrachte einige Wochen in der Wohnung einer Freundin und schrieb wie immer an der Magisterarbeit von jemandem, der die Hilfe einer Studienrätin für Deutsch und Geschichte gut gebrauchen konnte. Eigentlich war ausgemacht, dass ich Anette in Berlin mein fertiges Manuskript übergeben sollte – daraus wurde ja nun nichts und hätte wegen der telefonbuchhaften Schwere des Kompendiums ohnehin nichts werden können.
Gestern hatte uns Anette zu einem Pavillon am Kreuzberger Paul-Lincke-Ufer gebeten. Wir stiegen am Bahnhof Kottbusser Tor (warum nicht mit ‚C‘?) aus, begegneten niemandem, der deutsch aussah, was uns aber nicht störte, da sowohl Silke als auch ich über Auslandserfahrungen verfügen. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich zwar in Istanbul einen Film für Arte gedreht, aber noch niemals so viele Türken gesehen habe. Ich war ganz begeistert. Der Pavillon hieß allerdings nicht ‚Ankara‘, sondern ‚Anker‘, und Anette saß aufrecht zwischen Hübschem, Buntem, Exotischem, ein bisschen eben doch wie die Aufsicht führende Lehrerin auf dem Schulhof. Sie wird mir so unendlich viele Seiten aus diesem Manuskript ungerührt wegstreichen, dass sie diese Zeile ja vielleicht stehen lassen könnte. Anette hat, wie viele Töchter aus dem Großbürgertum, eine große Sehnsucht nach dem Schlichten und Unverfälschten, obwohl sie sehr wohl um die Vorzüge von Klapperdeckchen und elektrischen Espressomaschinen weiß. Nach einem kurzen Gedankenaustausch galt es nun, mein Geburtstagsgeschenk vom vorvergangenen Jahr einzulösen: ein Haarschnitt einschließlich Ohrhaar-Ausbrennen bei Ibrahim, dessen Geschäftssitz mehr noch als alles andere unseren Treffpunkt rechtfertigte.
Wer zu spät kommt, den bestraft der Filius. Der Friseur hatte sich zur Ruhe gesetzt, sein Sohn hatte den Laden übernommen und – clear Cut – gleich ein Schild ‚Hair Designer‘ neben Vaters Namenszug gehängt. Vor der Tür unterhielten sich zwei: die Friseure. Die beiden Damen setzten sich an die Wand und belauerten mich sensationslüstern. Mehr Publikum war nicht.
Der eine Spur reifere der beiden Männer legte mir den Umhang um, dann wurde zu meinem Missvergnügen der Jüngere an meinem Kopf tätig und bearbeitete ihn zunächst mit dem elektrischen Rasierer. Da ich ohne Brille nur verschwommen sehen konnte, machte ich mich schon mal darauf gefasst, nach dem Ende der Prozedur aus dem Spiegel heraus Heinrich Himmler in die Brillengläser zu blicken. Als der junge Mann sein Werk beendet hatte, wusch mir der erfahrenere den Kopf und beschwor, während ich nach meiner Brille nestelte, Anette und Silke: „Zehn Jahre jünger!“ – Ich hoffte also zunächst, ich würde nun wie dreißig aussehen, war dann aber schon damit zufrieden, dass ich zufrieden war. Ich hatte ohnehin eine List angewandt: Mein Haar war derart verwildert gewesen, dass alles, was geschehen würde, nur eine Verbesserung darstellen konnte. „Ja“, sagten wir alle ungefragt, „ja“, und Anette zahlte.
Von Anette geführt, durchquerten wir den frauenlosen Zickenpark, gingen die Dieffenbachstraße entlang und setzten uns vor ein Lokal auf die Straße. Wir tranken und redeten und ich rief Michael, mit dem wir für den Abend verabredet waren, an, um ihm zu sagen, wo er uns finden konnte: Kommunikation wie bei jungen Leuten, meinem Haarschnitt angepasst.
Anette und Michael war nur ein kurzer Gedankenaustausch vergönnt, dann musste Anette zu einem Vortrag eilen, der sich mit den Deutschen und dem Nationalsozialismus befasst. Als Historikerin und Intellektuelle braucht sie das. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, liebt sie besonders Vorträge, deren Inhalt sie empört, um anschließend während oder statt der Diskussion nach Herzenslust zu randalieren.
Silke und ich stiegen in Michaels Auto, weil ich wollte, dass wir zum ‚Abendmahl‘ fahren, um es Silke zu zeigen. Dies gelang auch, nicht allerdings, sie hineinzuführen: Ruhetag. Aber man ist ja schon dankbar, wenn etwas überhaupt noch existiert. Stattdessen gingen wir – auch in der Muskauer Straße – ins ‚Jolesch‘ und brauchten uns für den Rest des Abends an keinen Zeitplan mehr, sondern nur noch an die Speisekarte zu halten. Ich bin gern mit Michael unterwegs. Nicht nur, weil er ein so kompetenter Begleiter ist, sondern weil ihn dann der Geräuschpegel zwingt, etwas lauter zu sprechen.
Am nächsten Tag fuhren wir vom Holocaust-Denkmal aus durch den weiterhin sanierungsbedürftigen Teil der Stadt in die Anklamer Straße. Ich glaubte, die Gegend überhaupt nicht zu kennen; dabei mündet die Anklamer Straße in die Ackerstraße, in der wir 1987 mit Roland, Frank, Lutz und ‚Ostschwestern‘ meinen Geburtstag gefeiert hatten – keinen Kilometer Luftlinie von Rolands Praxis in der Gesundbrunnener Ramlerstraße entfernt. Berlin ist kein Dorf, ich kenne es bloß nicht mehr, weil durch den Fall der Mauer Strukturen entstanden sind, wo früher nur Grenzen waren. Vermutlich entgehen einem durch solche willkürlichen Mauern auch mögliche Vernetzungen im Hirn, die einen daran hindern, Zusammenhänge zu begreifen. Das dachte ich so beim Tee, aber sagte es nicht, weil es mir zu umständlich vorkam.
Da Dorothee uns ja nun versetzt hatte, beschlossen wir, mit Anette zu dritt in der ‚Paris Bar‘ zu reservieren, letzter Lokalpunkt, den wir Silke halber abhaken mussten. Wir schleppten uns zum Nordbahnhof, der mitten in der Mauer gelegen hatte, aber das sah man nicht, und so konnte ich mich nicht gruseln, sondern allenfalls Silke wegen ihrer blutigen Zehen bedauern. Wir fuhren aus Rücksicht auf Silkes Füße vom Wittenbergplatz aus mit dem Bus zur Pension, wo Silke als Trostpflaster ihren Hotel- und Zimmerschlüssel zurückbekam. Fräulein Schneider, die in Wirklichkeit Frau Lange heißt, hat überraschenderweise einen Mann: Herrn Lange, der hat Silkes Schlüssel mit dem Magneten aus der Ritze gezogen. Da wäre ich gern dabei gewesen. Doch kaum kam Silke wieder ohne fremde Hilfe in ihr Zimmer, schon mahnte sie gleich zur Eile: Wir waren mit Anette um halb neun im ‚Keno‘ verabredet. „Das schafft die nie“, beruhigte ich Silke. Aber so ist Silke nun mal: Wie aus dem Ei gepellt und frisch bekleidet saß sie Punkt halb neun vor ihrem Mineralwasser am letzten freien Tisch vorm ‚Keno‘. Ich bestellte meinen Wein, leicht verhetzt, um viertel vor, und um neun kam, souverän und gelassen, Anette.

Titelbild mit Material von H. R./Privatarchiv (Friseur), Kopiersperre/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Karte/bearbeitet)
#3.07 | Wenn man sich’s leisten kann#3.09 | Guntram hat wieder recht

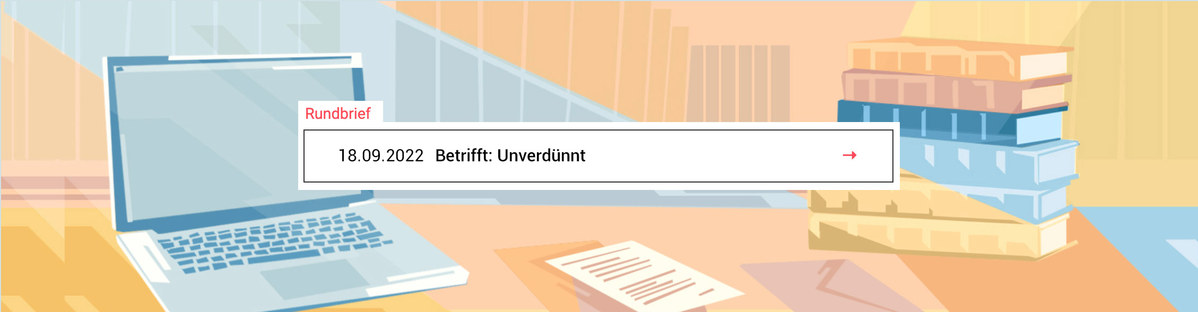








LOL. Ich musste mal beruflich nach Essen. Da bin ich auch fast verhungert 😂
Metaphorisch wahrscheinlich? Es soll ja spannendere Städte geben
Bei Essen denkt man heute ja an Fleischverzicht. Früher dachte man an Krupp.
Immer wenn ich das Gefühl habe ich müsste verzichten, dann tue ich das nicht. Wenn mir ein vegetarisches Gericht zusagt, ist das ganz was anderes. Verzicht und Genuss passen ja nicht zueinander.
Die Beschreibung von Berlin gefällt mir. Neues wo früher nur Grenzen waren!
Die Grenzen verorten manche jetzt im sozialen Bereich. Aber ich kenne keine Großstadt in der Welt, in der das anders wäre.
Und es gibt ja auch da immer Ausnahmen. Wenn die Gentrifizierung kommt, wird auf einmal ein sozial brenzliges Viertel zum neuen Kreativ-Hotspot der Stadt.
Was den weniger Kreativen und weniger Vermögenden mein weniger gefällt.
Anette scheint mir mit ihrer Empörung nicht alleine zu sein. Das Prinzip Social Media und seine Algorithmen basieren ja genau darauf: Konsum von Material, welches die größtmögliche Empörung hervorruft.
Nur läuft das bei Facebook weniger freiwillig ab. Da bekommt man ja meistens bestimmte Inhalte vorgesetzt. Egal ob man übereinstimmt oder nicht.
Wer bestimmte Inhalte nicht sehen will, kann diese einfach ausblenden und so den Algorithmus neu kalibrieren. Nur tun das die wenigsten Menschen. Aber da läuft es wohl auf Hanno Rinkes Fazit hinaus: Empörung macht eben sehr viel Spaß.
Empörung ist mindestens so schön wie Begeisterung. Leider nutzen sich beide schnell ab.
Die beiden sind sich tatsächlich sehr ähnlich. So verschieden und doch ähnlich.
Ich mag ja nie wenn der elektrische Rasierer zum Einsatz kommt. Wahrscheinlich ist das albern, aber es kommt mir immer so nach Fließbandabfertigung vor.
Naja, es kommt ja schon sehr darauf an, was der Friseur mit den Geräten macht. Es gibt genügend wo auch ein Schnitt mit Kamm und Schere vom Fließband kommt.
Gerade habe ich meinen Bartwuchs unbeholfen elektrisch gestutzt. Männer müssen sich ja bis zum Tod mit diesem Geschlechtsmerkmal auseinandersetzen. Menstruation ist schlimmer, wenn auch kürzer.
Menschen, die ’souverän und gelassen‘ zu spät kommen beneide ich ja schon ein wenig. Trotzdem sind mir die pünktlichen im Freundeskreis immer lieber. Ich warte so ungern.
Verständlich!
Man kann selbst später kommen wenn man einmal die unzuverlässigen Freunde durchschaut hat. Viel mehr kann man nicht tun.
Oder sich andere Freunde aussuchen, wenn man selbst zu ungeduldig ist oder es ganz unerträglich wird.
Wen man liebt, kann man sich nicht aussuchen. Mit wem man befreundet ist, schon eher.