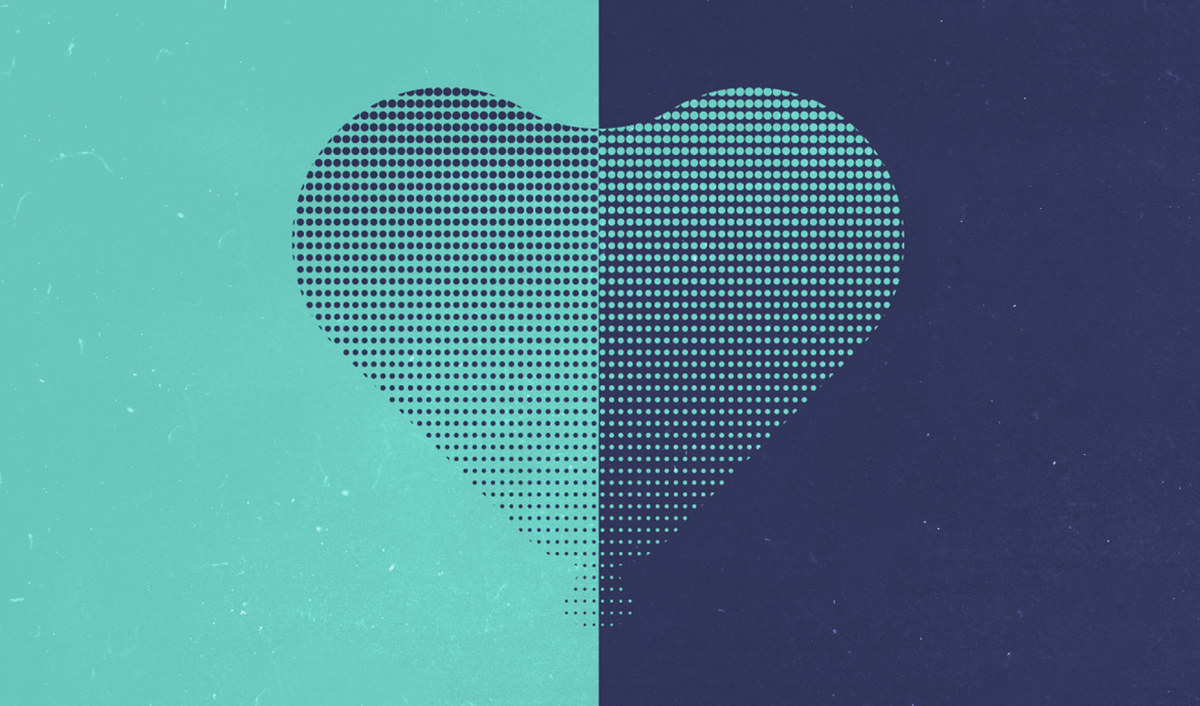
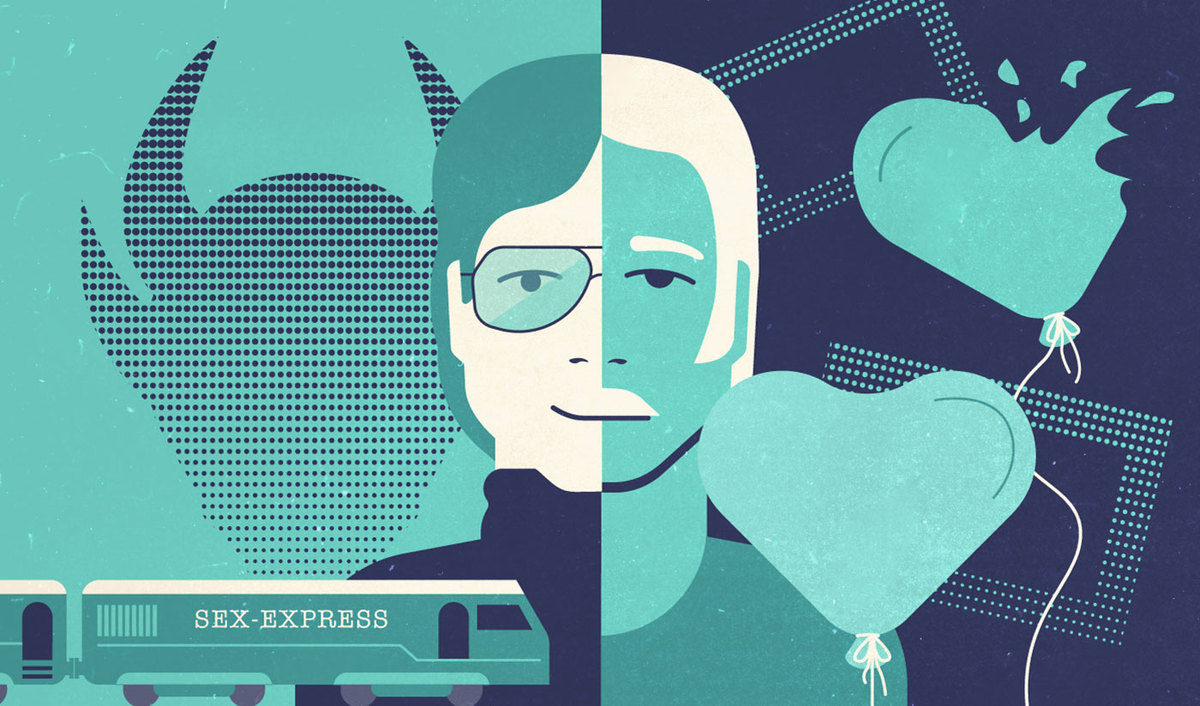
Mähnen, Männer, Macho. Manche kannte Robert. Die meisten nicht. Vertraute Verträumte. Verklärte Verklemmte. Und die Forschen und die Schwätzer. Die blinden Hühner, die nach Körnern picken, und die Gockel, die im Mist scharren. Aber unten waren sie alle gleich. Und was Qualität war, bestimmte er. Robert musterte den Mann an der Tür zum Keller. Ein ziemlich runtergekommener Bursche. Wilde Gleichgültigkeit im Gesicht. Gut gebaut, soweit zu sehen.
––„Da!“ Martin hielt Robert die Flasche hin.
––„Ah, danke!“ Er nahm einen Schluck. „Na, Martin, wer von denen hier ist denn dein Typ?“
––Warum sage ich nicht: ‚du!‘? Warum sage ich nicht: ‚Schon den ganzen Tag habe ich von dir geschwärmt‘? – Weil du mich jetzt plötzlich so freundschaftlich herablassend ansiehst, dass es wehtut, und ich nicht schreien darf, deshalb. Ist das Stärke oder Schwäche? Von dir oder von mir? „Ach, ich weiß nicht. Alles nette Jungs. Männer, die im Leben stehen.“
––„Ja, in ihrem eigenen Leben, aber sonst nirgendwo.“
––„Und du?“
––„Ich bin genauso. Das Einzige, was ich nicht mitmache, ist das Vereinsgetue, aber das kommt sicher auch noch: Der Kassenwart des MSC Duisburg grüßt den zweiten Vorsitzenden des MSC Wuppertal gemäß den Satzungen des EMSC und macht darauf aufmerksam, dass nur Typen in entsprechenden Klamotten Einlass finden. Dann wird mit Riesenaufwand und monatelangen Vorbereitungen ein Treffen inszeniert, und dann wollen sie alle nur abspritzen. Manchmal denke ich, das ist bei jedem Verein so: bei jedem Konzil und bei jedem Parteitag. Im Grunde wollen sie alle nur entsaften, ganz gleich, ob sie sich nun auf die Samen- oder die Tränen- oder sonst eine Drüse spezialisiert haben.“
––Martin sagte nichts. Was auch?
––„Da hast du wieder dein Bild und die Wirklichkeit: Hier stehen sie in Stiefeln und zerfetzten Jeans, und zu Hause darf das Häkeldeckchen nicht verrutschen. – Darum geh’ ich auch so ungern mit einem mit und komm’ hier lieber gleich zur Sache: Ich hab’ meist’ Pech und gerate an einen mit Plüschkissen auf weinrotem Noppensofa. Dann fällt mir vor Schreck der Schwanz runter und erholt sich erst gegen Morgen, wenn ich längst allein im eigenen Bett liege und eigentlich schlafen möchte.“
––‚Was würde er über meine Wohnung sagen?‘, dachte Martin. – Warum nimmt er mich nicht einfach bei der Hand und geht weg mit mir? Warum führt er mich nicht endlich heraus aus meinen Träumen in seine Wirklichkeit? Oder soll ich ihn fragen, ob er mitkommt? Noch ist es nicht zu spät. Er ist genau das, was ich will. Vom Gesicht her, von seiner Figur. Nur das Gespräch läuft anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber danach wollte ich ja heute sowieso nicht gehen. Heute wollte ich doch jeden nehmen. – „Ach, und ich geh’ grade gern mit“, sagte Martin, so als ob das häufig passierte. „Ich finde das spannend. Man hat doch sonst nie die Möglichkeit, so viele verschiedene Menschen in ihrer Umgebung zu sehen. Natürlich gibt’s da Überraschungen, auch böse. Aber du sagst doch, du magst das Spiel, den ‚Einsatz‘.“
––„Es ist ja auch nicht das Kissen mit Kniff, sondern was dahinter steht“, sagte Robert. „Mit Kerligkeit Reklame machen und mich dann in die Spießerecke locken. Das ist unlauterer Wettbewerb. Ich hasse es, wenn die Aufmachung mehr verspricht, als die Ware hält.“
––Martin starrte auf die Öffnung seiner Bierflasche. – Wie gerne würde ich auch endlich loskommen von den Bildern, endlich die Wirklichkeit lieben und nicht meine Fantastereien. Endlich Fleisch und Blut statt Papier. Einen Menschen. Mit all seinen fremden, zweifelhaften Eigenschaften. Ihn ertragen. Kann ich das überhaupt? Oder hat die Droge meiner Träume mich schon verdorben für das Leben? Nehme ich das Leben schon als Droge? O Gott, lass mich nüchtern werden! Wirklich? Die Dinge nehmen, wie sie sind? Wollen, was man kann? Mögen, was man hat? Ist das erstrebenswert? Sehen, ohne zu träumen. Glauben, ohne zu missionieren? Lieben, ohne zu hassen? Wann werde ich so weit sein? – Martin steckte den Finger in den Hals der Flasche. „Ich glaube, der größte Fehler der Schwulen ist, dass sie Sex so wichtig nehmen“, sagte er.
––„Und die Heteros, die jedem Rock hinterherhecheln?“
––„Nicht so wie die Schwulen hinter jeder Hose. Jeder betrachtet hier doch jeden nur als Sexobjekt.“
––Robert stellte einen Fuß auf die Kiste. Diese altkluge Art des Jungen fand er plötzlich lächerlich. Ihm war, als würde lautlos ein langer, langer Geisterzug vorbeirasen: all die Schwulen, die monatelang einsam zu Hause sitzen, weil sie nicht den Mut haben, in eine Bar zu gehen; all die, die nicht ausgehen, weil sie abends lieber allein sind mit ihrem Partner. All die vielen, die ihren Honig ausschließlich aus Büchern oder Kunstausstellungen oder Opernpremieren saugen; die anderen, die ihren Durst durchs Reisen, durchs Essen, durchs Trinken stillen. Dann die, die sich zu hässlich vorkommen oder zu prominent; und vor allem die, die zu alt sind oder zu müde oder einfach nicht genügend Mut oder Lust haben, um vom Zug abzuspringen und sich an der Fleischversteigerung zu beteiligen. Die nicht erwähnenswerte Mehrheit. – „Was hast du gegen Sex?“, fragte Robert. „Sex ist doch wie Essen: Man braucht es täglich, aber nicht täglich dasselbe.“
––„Sex! Sex! Sex!“, sagte Martin. Er hoffte, das klang verächtlich und nicht enttäuscht.
––Robert spürte schmerzhaft die Kälte in der Stimme des Jungen. – Ich selbst habe diesen Tonfall heraufbeschworen. Kann ich das Ruder noch herumreißen? Will ich das? – „Ja. Genau das ist doch der Sinn hier“, sagte er. „Hier gibt es keine verlogenen Versprechen, sondern einen ehrlichen Fick. Es ist ein ganz solider Markt, genau auf die Bedürfnisse der Konsumenten zugeschnitten. Das macht hier die Gemeinschaft aus. Und nur das.“
––„Dass es bei Schwulen immer nur um Sex geht! Und so wird man auch beurteilt. Wenn ein Mann irgendwo seine Frau vorstellt, denkt sich kein Mensch was dabei. Stellt ein Schwuler anderen Leuten seinen Freund vor, denken alle sofort daran, dass er mit ihm schläft.“
––„Na und?“
––Martin stützte auch den Fuß auf die Kiste. „Ich finde das erniedrigend. Danach suche ich mir meine Freunde doch nicht aus.“
––„Ich glaube, man kann sich die Menschen, mit denen man schläft, sowieso nicht aussuchen. Sie sind einem bestimmt. Die einzige Überwindung dieses Prinzips ist der Keller da unten.“
––Sie starrten beide vor sich hin. Die vorwärtskreisende Musik verhinderte, dass die Stille zwischen ihnen hörbar wurde.
––‚Warum nimmt er mich nicht einfach bei der Hand und führt mich aus meiner tödlichen Wirklichkeit heraus in seine Träume?‘, dachte Robert. – Umgekehrt. Ich müsste ihn bei der Hand nehmen. Oder liegt in seinem Glauben mehr Kraft als in meinem Wissen? Wie erwachsen bin ich wirklich? Die ganze Fickerei einfach sein lassen, so wie man irgendwann mit fünfzehn oder sechzehn aufhört, Lakritze zu essen. Was ist es nur, das diesen Trieb jeden Tag wieder neu in mich hineinmeißelt? Jeder halbwegs passable Kerl nimmt seinen Hammer und schlägt den Meißel tiefer ein. Wie tief soll das noch führen, ohne auf Granit zu stoßen? Bis zum Anschlag. Bis zum Tod? Was für ein Triebwerk ist das, das sinnlos Strom erzeugt? Wie sind die Relais geschaltet, wie sind die Leitungen gepolt? Umschalten! Umpolen! Kurzschluss. Alles in die Luft sprengen. Vielleicht liegt Heil nur in der Vernichtung. Wie gerne würde ich wieder dem Schein erliegen und dem Abbild meiner Sehnsüchte hinterherschwärmen, stundenlang, wochenlang, jahrelang – ganz ausgefüllt. Es geht nicht mehr. Ich habe meinen Traum verloren. Nur packen kann ich, zugreifen und verschleißen. Ich nehme das Leben nur noch als Droge. Wie kurz ist der Augenblick, in dem man die Wahrheit schon erkennt und sie doch noch achtet? Ich möchte ihn lieben. Warum kann ich es nicht? Aus Feigheit?
––Martin hielt die Flasche umklammert. – War das ernst gemeint? Der Keller da unten? Das sollte die Befreiung sein? Alle Menschen werden Brüder. So? – „Ich finde deine Einstellung total daneben. Außerdem nehm’ ich sie dir auch nicht ab. Du hast doch bloß für alles einen Spruch. Mehr nicht.“
––Ja, ‚daneben‘. Genau. Aber warum sagte der Junge das jetzt? Verletzte Zuneigung? Verletzende Abneigung? Robert hatte das ohnmächtige Gefühl, dass sie dabei waren, ihre Chance zu vertun, bei allem Einsatz. Ein Satz, ein einziger richtiger Satz, aber er fiel ihm nicht ein, nur Werbesprüche flatterten durch seinen Kopf wie losgelassene Luftballons. Robert starrte ihnen nach und er wusste nicht, warum er glaubte, dass es schieflaufen würde, nur dass es kaum noch zu ändern war und dass er einen aufsteigenden Schmerz darüber unter Kontrolle bringen musste. „Wer oder was hat dich eigentlich hierher verschlagen?“
––Martin fand, dass Roberts Stimme jetzt tonlos klang. Wahrscheinlich hatte er das Interesse verloren und sehnte sich weg. Aber vielleicht lag es auch nur an der wummernden Musik. – Ja, warum bin ich hier? Weil ich geil war und neugierig, wie weit mich meine Geilheit treiben würde. – „Ich hatte schlechte Stimmung. Mir ist die Decke zu Hause auf den Kopf gefallen.“
––„Und dann kommst du hierher? Da treibst du aber den Teufel mit Beelzebub aus.“
––Martin verzog das Gesicht, ihm selbst kam es vor wie ein augenloses Weinen.
––„Warum grinst du?“, fragte Robert.
––„Ich hab’ mir heute, als ich das eine Bild von dir entwickelt habe, vorgestellt, dass ungefähr so wie du der Teufel aussehen könnte.“
––„Oh, das ist aber wirklich ein Kompliment! Da hattest du ja schon feste Vorstellungen und konntest mich gleich richtig abschätzen, als ich zur Tür reinkam. – Und du bist wohl der Engel, der die Treppe nicht runterfällt?“
––Martin lächelte. ‚Ich bin Beelzebub‘, dachte er.
––Ein Hoffnungsschimmer.
––Robert nahm den Fuß von der Kiste und warf die Zigarette auf den Boden. „So“, sagte er, „dann will ich mal dem Bild von mir entsprechen und was für mein unterleibliches Wohl tun!“ Er nickte Martin zu und drehte sich um. Die wirre Menge teilte sich vor ihm. Palmsonntag. Sein Körper streifte durch die Leiber hindurch wie durch das Rote Meer, unberührt, ungerührt, und senkte sich die Kellerstufen herab.
––‚Ich kriege doch sonst mit Geilheit alles weg‘, dachte Martin, ‚Hunger, Angst, miese Laune – warum nicht auch dieses überwältigende Gefühl von Ohnmacht und Eifersucht?‘ – Weil ich nicht geil bin. Weil ich jetzt, im entscheidenden Augenblick, überhaupt nicht mehr geil bin, und weil es eine Qual für mich war, ihn von Sex reden zu hören wie von den Alpen. Aber was will ich denn dann von ihm? Was sonst? Etwas anderes hat er doch gar nicht zu bieten. Immerhin. Auf den Gipfel steigen und hinabsehen. Oder abstürzen. – Martin trank den letzten abgestandenen Schluck aus der Flasche und fühlte das schale Bier seinen Hals herabrinnen, lauwarm und ätzend.
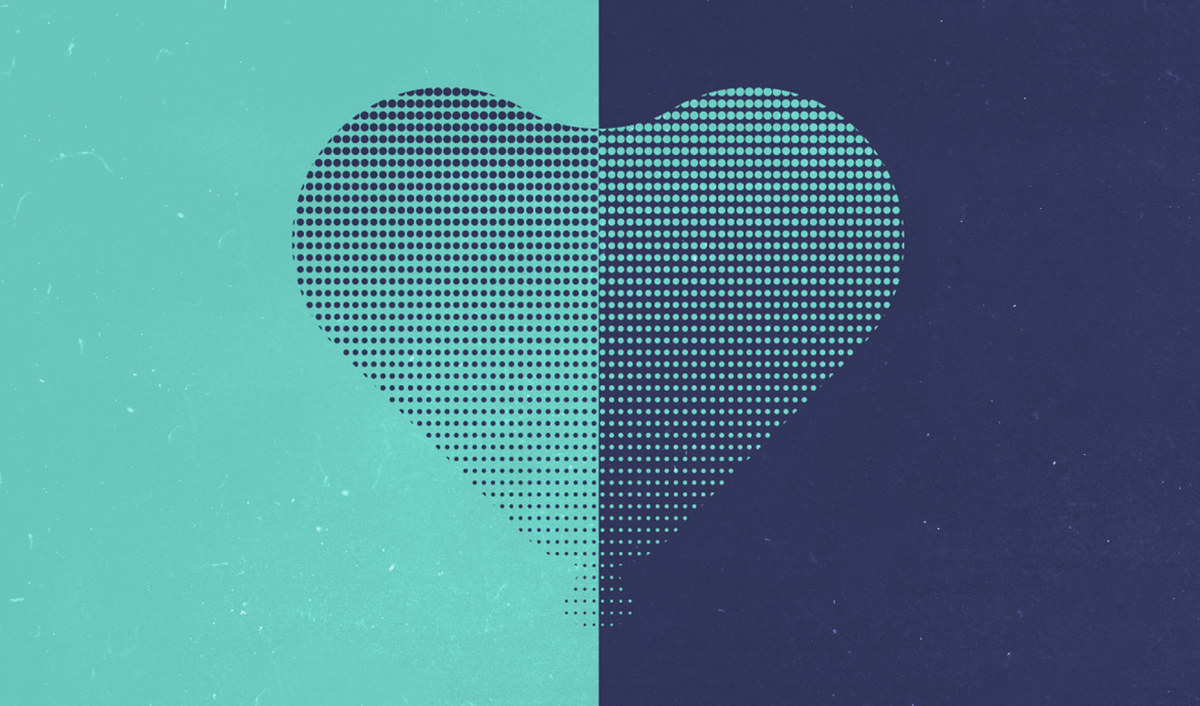

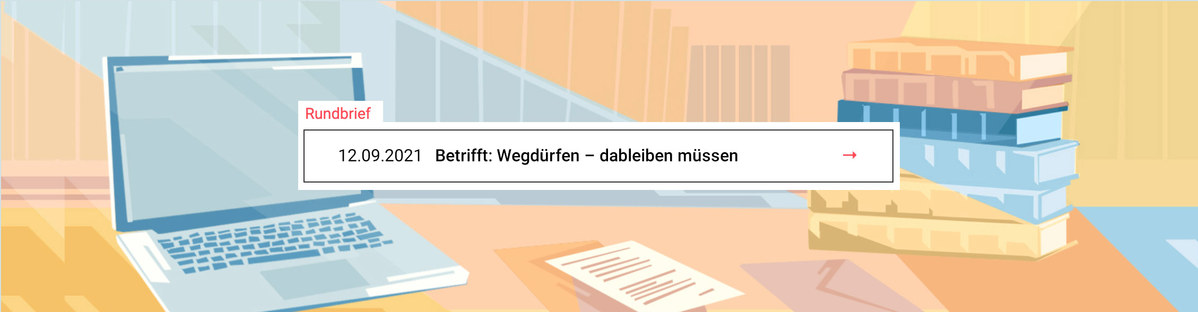




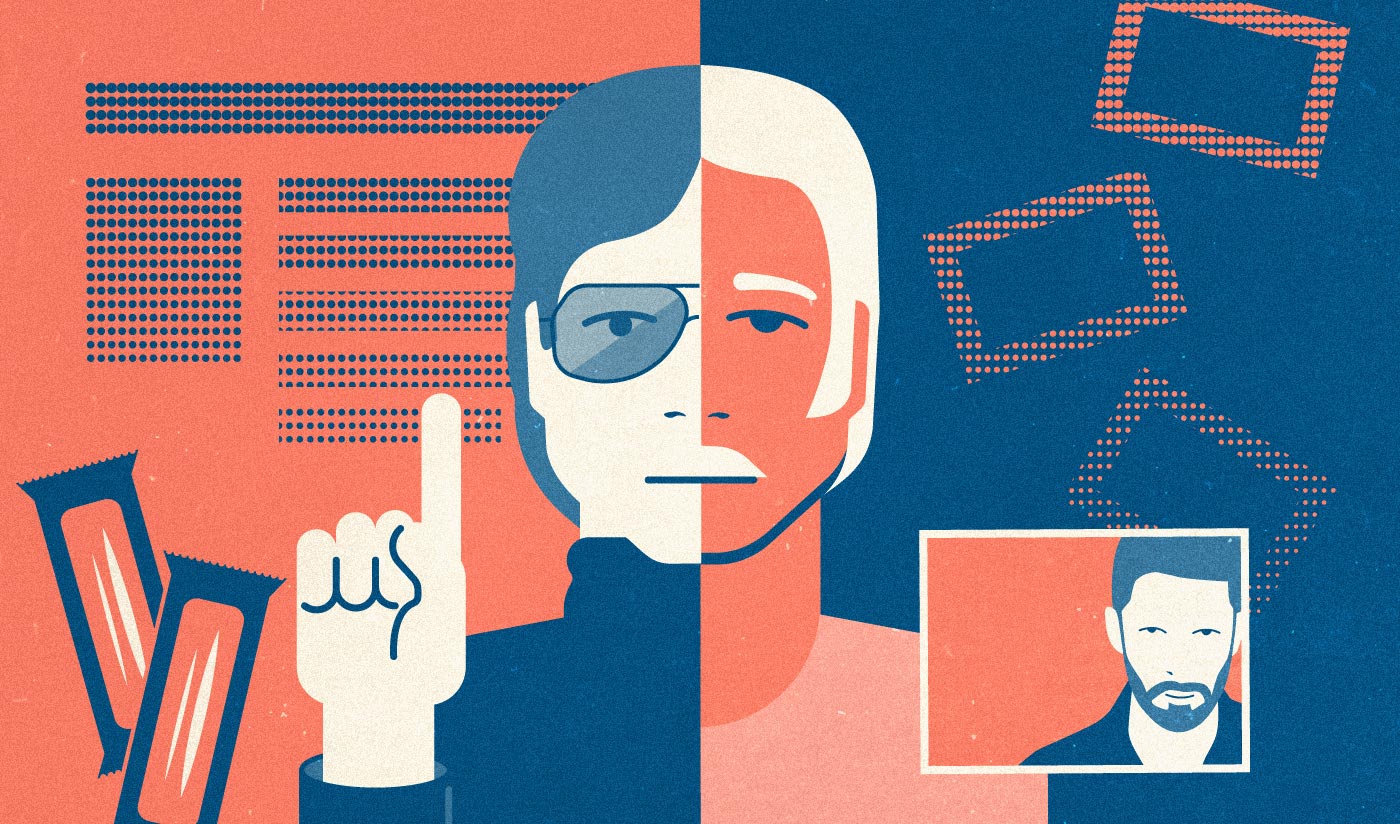


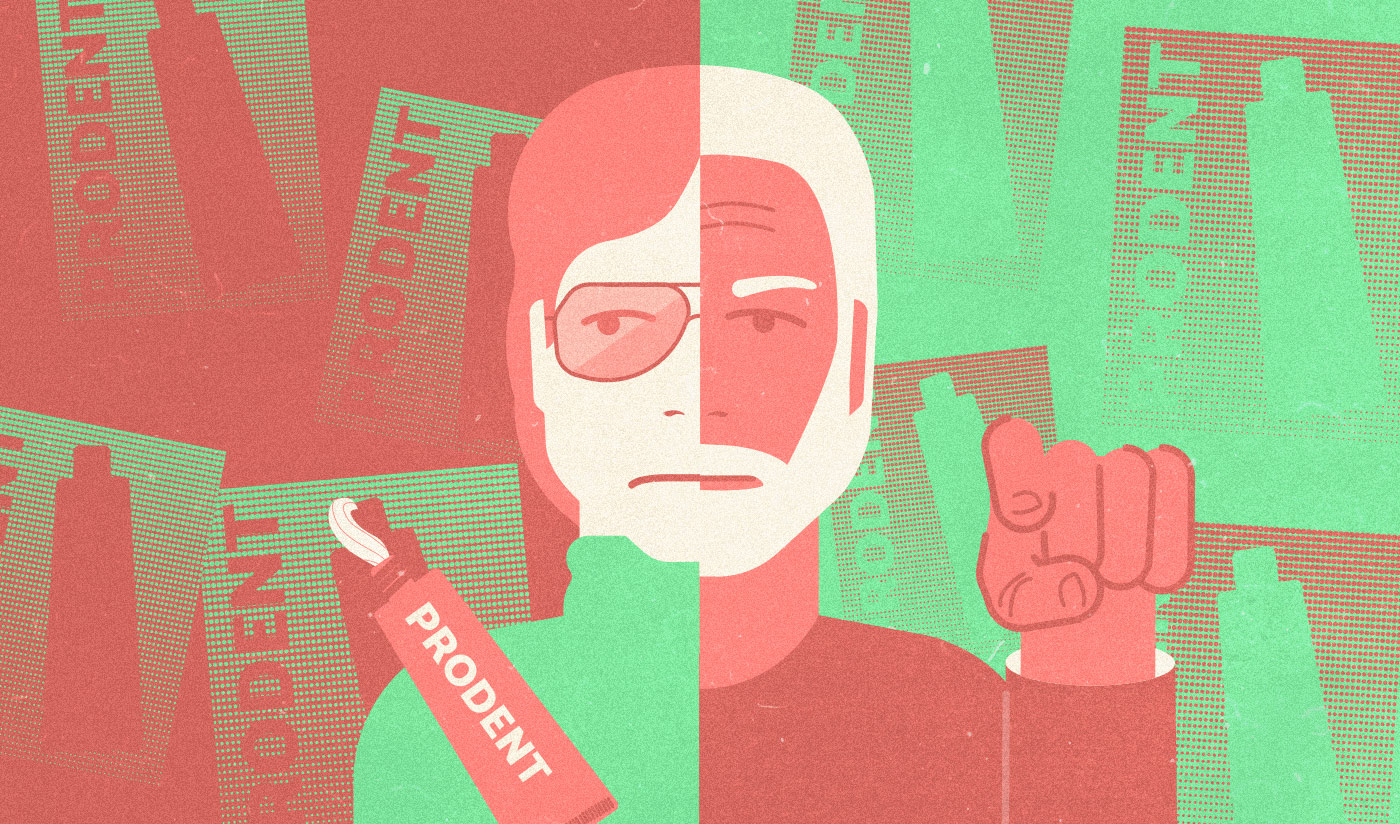

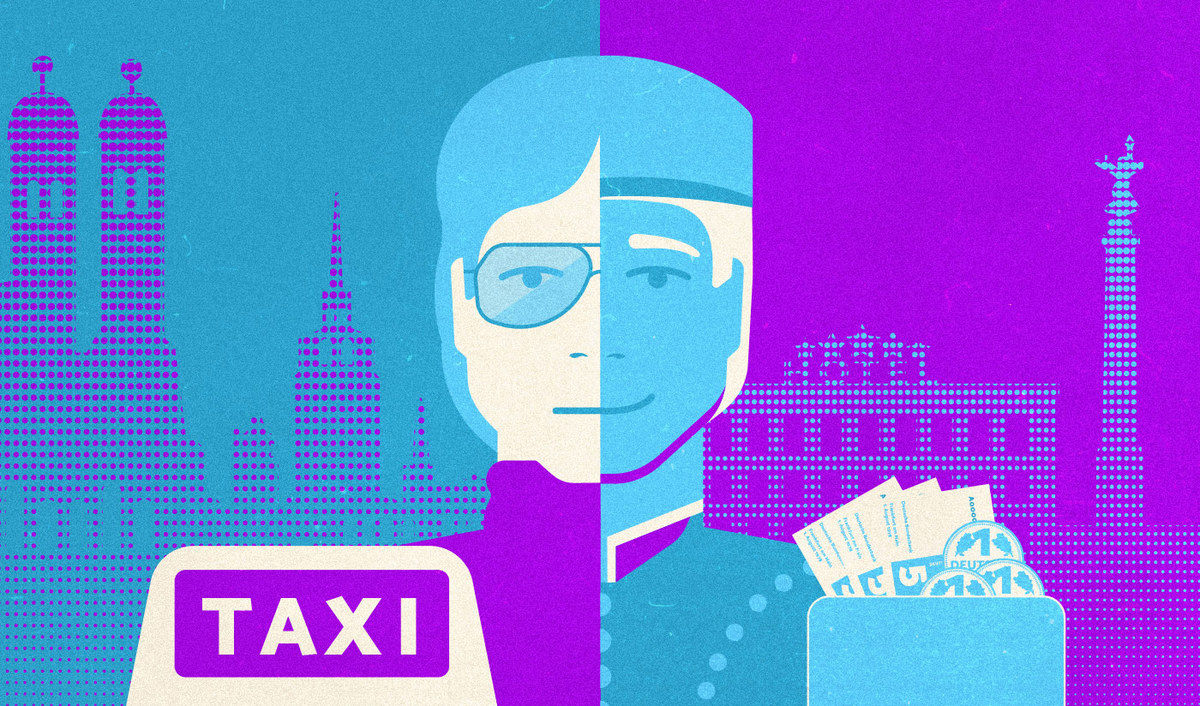




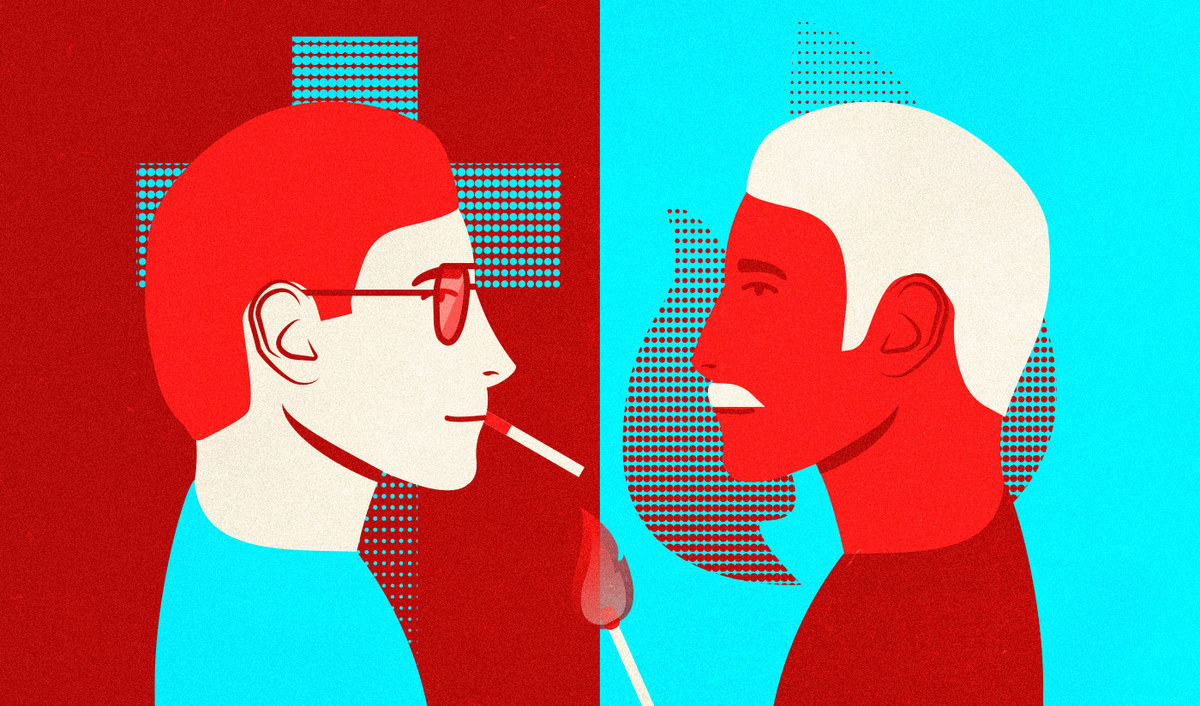
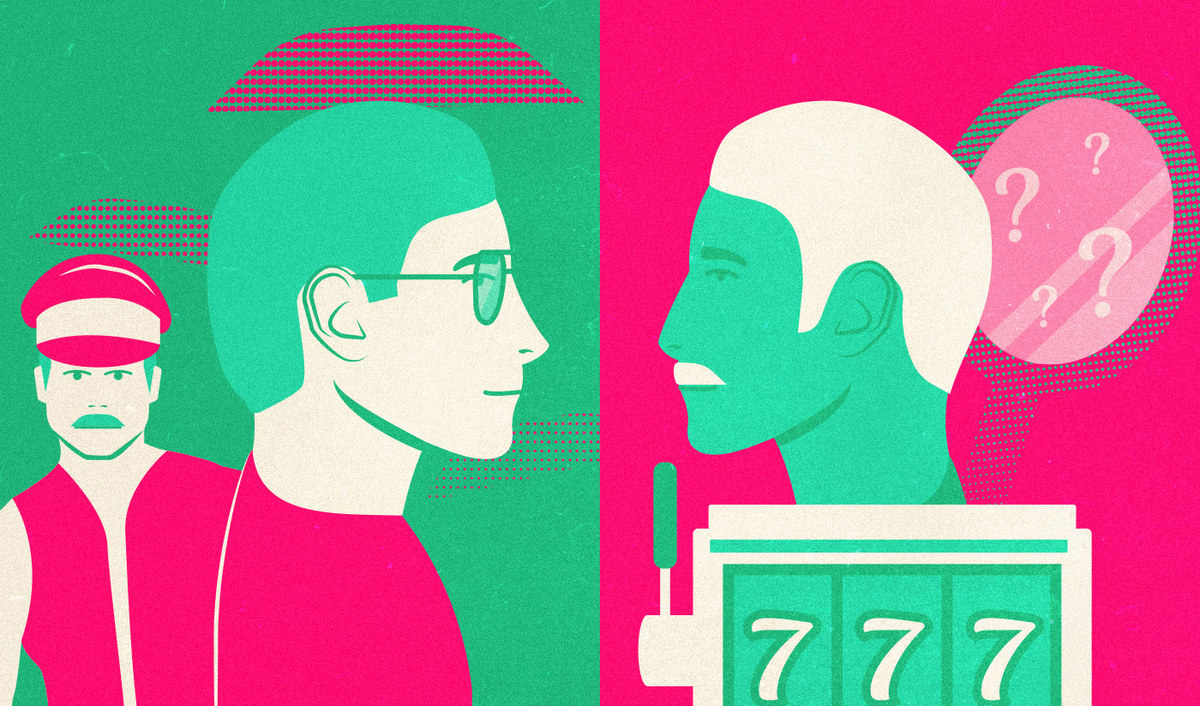
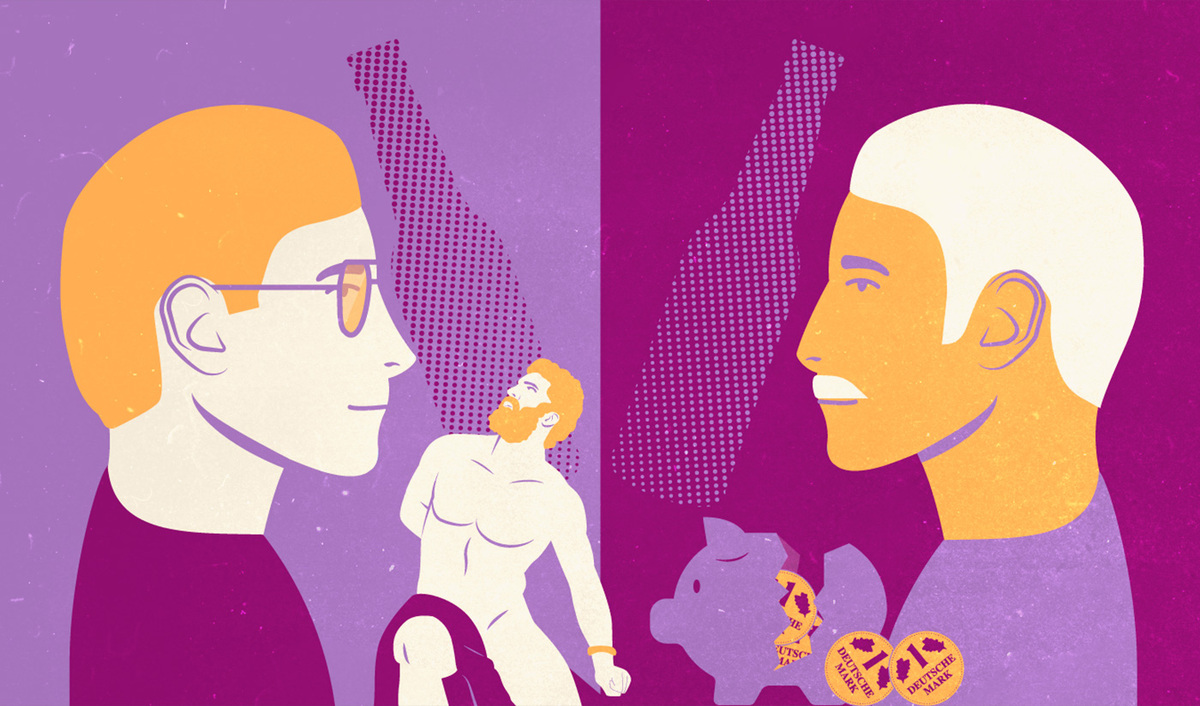


Und auf einmal trennen sich die Wege wieder. Zumindest für den Moment. Man konnte es ja in den Gesprächen spüren, dass die beiden nicht so richtig zueinander finden können.
Noch ist die Geschichte ja nicht zu Ende. Aber man merkt natürlich, dass die beiden nicht nur mit ihrem Gegenüber, sondern auch mit sich selbst hadern.
Ja, hadern. Es ist mehr als nur denken.
Robert fragt sich ja selbst warum er Martin nicht lieben kann. Feigheit ist glaube ich nicht die Antwort.
Einen Fehler nicht nochmal machen wollen: Vorsicht oder doch Feigheit? Etwas nicht fühlen, oder etwas nicht zulassen. Privatleben ist manchmal komplizierter als Beruf. Scheitern Künstler-Ehen häufiger oder berichten die Medien nur ausführlicher davon?
Und: gilt eine Ehe erst dann als gescheitert, wenn man sich offiziell scheiden lässt?
Zumindest ist des für Außenstehende, die das ja auch nichts angeht, schwer, einen anderen Maßstab als die Trennung zu finden.
Die Trennung ist halt das klare Zeichen dafür, dass beide Seiten aufgegeben haben. Das kann man schon als entsprechendes Zeichen werten.
Ja die Schwulen nehmen Sex wichtig. Vielleicht zu sehr. Aber das Problem entsteht doch eher, wenn sich Sex und Liebe vermischen. Oder nicht mehr klar ist, was man eigentlich genau sucht. So wie beim Jungen hier.
Ich finde es immer erstaunlich, wenn Menschen das so einfach trennen können. Nicht falsch, aber doch erstaunlich.
Auch beim Sex sollte der Augenblick eine Ewigkeit dauern.
Zum Gespräch von Robert und Martin fällt mir ein Smiths-Song aus den 80ern ein: I want the one I can’t have, and it’s driving me mad…
Reden kann alles verderben. Muss aber nicht. Wenn jemand dummes Zeug sagt, ist es natürlich blöd. Aber wenn jemand dämlich lacht, ist es aus.
Es geht vielleicht auch gar nicht IMMER um Sex. Aber im Sexclub, naja da sollte man darauf vorbereitet sein.
Keine Lederkneipe ist nicht gerade ein Sexclub. Ein Wahllokal ist auch nicht immer eine Kanzler*-Schmiede.
*innen erst recht nicht.
Aber doch fast.
Wenn mit Riesenaufwand und monatelangen Vorbereitungen ein Treffen inszeniert wird, dann kann man in der Regel nur enttäuscht werden. Dass auch zufällige Begegnungen nicht immer besser ausgehen müssen, scheint uns allerdings diese Erzählung zu zeigen.
Sobald zwei Menschen in einer Begegnung involviert sind wird es schwierig.
Wenn zwei Menschen keine Begegnungen haben, ist es auch nicht immer einfach.
Oh, fast philosophisch, und sicher wahr.
„Unten waren sie alle gleich.“ Und trotzdem kann Sex so unterschiedlich sein…
Zum Glück kann er das. Wie langweilig wäre es sonst.
Ganz so gleich sind sie ja unten auch gar nicht …
Kerligkeit und Spießertum schließen sich nicht immer aus. Im Gegenteil würde ich sagen. Die „richtigen Kerle“ sind ja oft überaus konservativ und eindimensional.
Masc4Masc hat jedenfalls immer etwas sehr altbackenes und verklemmtes.
Die Kerligkeit ist oft vorgetäucht. Das Spießertum ist immer echt.
Mich erinnert es auch immer ein wenig an Fasching. Dieses in eine andere Haut schlüpfen.
Hahaha. Wahrscheinlich führt die ‚Verkleidung‘ of sogar zum gleichen Resultat 😂
Ich glaube das kommt immer noch darauf an wo man sich verkleidet. Wenn man das wirklich so nennen will. Man muss ja zumindest mal das richtige Publikum haben um sein Ziel zu erreichen.
Der Weg vom Traum in die Wirklichkeit gelingt eben immer nur dann, wenn einer der beiden Personen die Initiative ergreift. Ansonsten bleibt man im immer selben Gesprächsstadium stecken. Da kann man den Traum eine Zeit lang genießen, aber relativ schnell stellt sich die Frustration ein.
Ein Gespräch, das auf der Stelle tritt, ist wohl auch gar kein richtiges Gespräch.
Sondern?
Kneipen-Gespräche treten wie die Wortwechselnden leicht mal auf der Stelle.
Immerhin geht das Gespräch dieser beiden Kneipenbesucher deutlich über das durchschnittliche Kneipengespräch hinaus. Das ist doch schon mal etwas.
Beim Titelbild muss ich glatt denken, dass Martin und Robert anstatt in den Sex-Express aus Versehen in die Regionalbahn eingestiegen sind.
Mit Claus Weselsky als Zugbegleiter ist der Unterschied gering.
Hahaha! Das wünscht er sich zumindest!