So ging ich also gestern Abend neben meinem Mitbürger Giuseppe einher, auf dem engen Bürgersteig schlängelten wir uns an den wenigen Passanten vorbei, die nüchterne Front der schmuckarmen Palazzi zur Rechten, zur Linken die dunkle, kaum genutzte, schmale Fahrbahn, und daneben wieder ein enger Fußweg und die glatte Reihe alter, aber nicht besonders ehrwürdig anmutender Stadthäuser, die nur am unteren Rand ihrer verwaschenen Fassaden ein imposantes Portal tragen wie eine Brosche.
Ich dachte nicht an Giuseppe, ich dachte nicht an mich, ich dachte ans ‚Crisco‘. Vorfreuden sind zweifellos schöner als Überraschungen, vorausgesetzt, die Vorfreude ist nicht allzu sehr im Essig der Sorge mariniert, dass die Sache schiefgehen oder platzen könnte.
Giuseppe, in seiner Gutmütigkeit fast mehr bestaunens- als bewundernswert, hatte mich gestern in Trient abgeholt und durchs von Gewittern heimgesuchte Valsugana, immer entlang der schier überschäumenden Brenta – in normalen Sommern ein bemitleidenswertes Rinnsal – nach Bassano kutschiert und von dort aus zu seinem zwanzig Kilometer weiter in einem ‚Mason‘ genannten Nichts gelegenen Haus am allerletzten Alpenhügel gebracht. Dabei erfuhr ich Neuestes über die Erbtante. Sie will nicht ‚zia‘ = ‚Tante‘ genannt werden, sondern ‚tata‘ = ‚Amme‘, findet sie irgendwie schicker. Das Zusammenleben mit der Tata gestaltet sich inzwischen offenbar amüsanter für ihn, denn er hat den Trick rausbekommen, wie er sie auf Kommando zum Weinen bringen kann. Dieser Knopf scheint er mit der Begeisterung eines Kindes zu drücken, das sich am Geräusch der Babyrassel nicht satthören kann. Und wirklich, als wir in seiner meist verwaisten Küche saßen, die die freudlose Unbenutztheit einer frigiden Stenotypistin ausstrahlte, und Parmaschinken aus dem Papier aßen, klingelte das Telefon, Giuseppe sagte nur ein paar Sätze, grinste mir dann stolz zu, mit leuchtenden Augen, und drückte mir zum Beweis den Telefonhörer ans Ohr, damit ich die Tante am anderen Ende weinen hören konnte.

Sie selbst hat auch das ein oder andre drauf und liest ihm aus der Hand, dass er zwei Wochen nach ihrem Tod sterben wird. Wahrscheinlich hat sie ihn längst enterbt, und ihr Geflenne ist nichts als verstelltes Kichern.
Wenn das Telefon, so etwa zwanzig Minuten später, zum zweiten Mal und schon sehr viel aggressiver, schnarrt, hopst Giuseppe hoch, als sei die Milch übergekocht, und fährt schnurstracks zurück nach Bassano, um die Nacht über der Tante zu Willen zu sein. Tagsüber geht es noch, aber nachts hat Tata Angst. Da verspricht man schon mal alles, um ja nicht allein zu sein. Wenn das Versprechen erst nach dem Tod eingelöst werden muss, ist es besonders günstig. Nach ihrem Tod gehören die Maisfelder Giuseppe. Jetzt gehört er ihr.

Foto: H. R./Privatarchiv
Der Hausgast bleibt allein zurück in der düsteren Villa und kann in der Stille der Einsamkeit die Zeit totschlagen, indem er Dialoge für das Zweipersonenstück ‚Ich und mein Neffe‘ konzipiert.
Sicher hätte mich Giuseppe auch gern gleich von Meran abgeholt, aber das war nicht nötig, weil es in Meran ja keine Möbel gibt. So muss ich meine Eltern also über Land fahren, und in jedem Ort kriegt Irene diesen etwas rastlosen Blick eines Schwulen, der in der Dorfstraße nach der öffentlichen Bedürfnisanstalt Ausschau hält. Ich weiß nicht genau, wonach sie fahndet, man darf auch nicht fragen, weil sie sonst einschnappt, jedenfalls haben wir bis auf etliche Kiefernholz-Teewägen nach Bauernmöbelart nie irgendwelche wesentlichen Entdeckungen gemacht, aber auf diese Weise verschlug es uns innerhalb unserer Streifzüge am Donnerstag nach Trient, was ja für Giuseppe durchaus benzinkostensenkend war.
Dabei habe ich, achtzig Meter vom Haus meiner Eltern entfernt, ein Einrichtungsgeschäft an der Ecke zu ihrem Privatweg ausgemacht: hinreißend. Der dort waltende grau melierte, drahtige Innenarchitekt wäre mir genügend Mobiliar für alle Räume des neuen Hauses, aber ich habe diese Anregung nicht an Guntram und Irene weitergegeben, weil ich befürchte, dass er ihnen nicht gemütlich genug wäre.
Wenn das ‚Crisco‘ geschlossen wäre, dann hätte das sauschlechte Essen in der Rosticceria vor einer Stunde keinen Sinn gehabt. Seit ich zum ersten Mal mit Irene 1966 dort gewesen war, habe ich fast alljährlich die Atmosphäre und Küche dieses urigen Lokals genossen: die verschlossenen Toskana-Gesichter der Kellner, das offene Feuer des Kamins, das dunkle Holz der Decke und das helle Fleisch der unverwechselbar schmeckenden Hühner aus dem Val d’Arno. Und jetzt? Neon, Plastik, ekelhaft freundliche Bedienung, die einem die berechtigten Vorwürfe mit so plumpen Ausreden pariert wie: „Die älteren Gäste haben bei Schummerlicht die Karte nicht richtig lesen können.“ Das ist jetzt einfach, die Karte liegt als Papierset auf der abwaschbaren Decke und enthält massenweise Pizza, was nach all den anderen Enttäuschungen endgültig der Grund zum Gehen hätte sein sollen (die Vorfreude hatte ich ja schon eingeheimst), aber, gelähmt von meiner Fassungslosigkeit, bestellte ich wider besseres Wissen einen gemischten Salat, der dann auch prompt aus drei welken Waschlappen und einem gehörigen Löffel Mais aus der Dose bestand, und mein geliebtes Pollo, das ehrlicherweise die Herkunftsbezeichnung ‚dal Val d’Arno‘ abgestreift hatte. Auf den Tisch geriet eine aus dem Wienerwald mit Fußtritten rausgeflogene Henne, deren Omahaftigkeit durch altes Öl überschminkt und durch Knusprigkeit getarnt war: Hier gehen für den Kenner Kochkunst und Kosmetik ineinander über – kross kriegt man alles, was Haut ist, wenn man’s nur genügend lange auf glühende Platten legt. Giuseppe lächelte zu all dem glücklich, obwohl ich nicht mal weinte. Seine Augen leuchteten immer noch vor Freude, als der Kellner die kaum von mir gefledderte Geflügelleiche wegtrug, so dass ich ihn fragen musste, ob er noch sehr unter dem Tod seines besten Freundes litt – der war im Juni an Lymphdrüsenkrebs gestorben.
Die Alte-Leute-Einsicht, dass alles immer schlechter wird, verbat ich mir energisch, denn die Bildröhren der Fernsehapparate, die Tiefkühlmenüs der Lebensmittelindustrie und die Kampfflugzeuge der Luftwaffe sind ja mit den Jahren immer besser geworden.


Foto links: Stefan Kühn, Fernseher, CC BY-SA 3.0 | Foto rechts: dimbar76/Shutterstock
Vor Entgegennahme dieser deprimierenden Mahlzeit waren wir hinter dem Palazzo Pitti den ziemlich steilen Hang der Boboli-Gärten emporgeklommen. Das geht jetzt nicht mehr wie früher von allen Seiten her, sondern nur noch durch eine enge Pforte gegen Eintrittsgeld, und ich musste beim Ersteigen der Höhe wirklich alle je von mir verzehrten Tiefkühlmenüs Revue passieren lassen, um den Fortschritt zu genießen.

Foto: Rufus46, Neptunbrunnen im Boboli-Garten Florenz-01, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Oben war es dann schön und nahezu menschenleer, es roch nach Buchsbaum und Lorbeer, unter uns lagen die roten Schindeln der flachen Dächer und die aufgebauschten Kuppeln der Kirchen, in der Luft ein fernes Summen, als seien die bläulichen Hügel in Schwingung geraten. Roland. Ach, Roland … Vielleicht könnte er noch leben, wenn er sich nicht die halbe Lunge hätte rausnehmen lassen. Ich habe ihn so gewarnt! Und dann – habe ich nicht alles versucht: erst mit ihm, dann für ihn, dann ohne ihn? Einen hübschen Akademiker namens Hering habe ich mir geangelt, einem humanistischen Psychoanalytiker habe ich in drei Sitzungen weisgemacht, ich sei bedeutend, Selbstanalyse, Selbstzerfleischung, Selbstbetrug. Alles, alles. Und was ist dabei rausgekommen? Ich langweile mich immer ein wenig, wenn ich nicht onaniere, besonders natürlich mit Giuseppe.

Foto: H. R./Privatarchiv
Ich legte mich flach auf eine der glatten Marmorbänke und er setzte sich aufrecht daneben. Die Vögel kamen dicht, korngewohnt. Sie öffneten die Schnäbel, um die üblichen tschilpenden Geräusche zu machen, und sie hoben die Schwanzfedern, um die üblichen weißen Kleckse zu lassen.
Lebe ich etwa doch – noch – gern?
Zumindest liege ich gern. Wenn die strenge Mittagssonne nachsichtig geworden ist und schließlich gleichgültig in den Abendhimmel sinkt – dieser Moment ist wie ein Achselzucken der Natur, bevor die Dämmerung beginnt, mit ihren eigenen Regeln, die schon dem Gesetz der Nacht unterliegen.

Foto: Dirk Petersen/Adobe Stock





















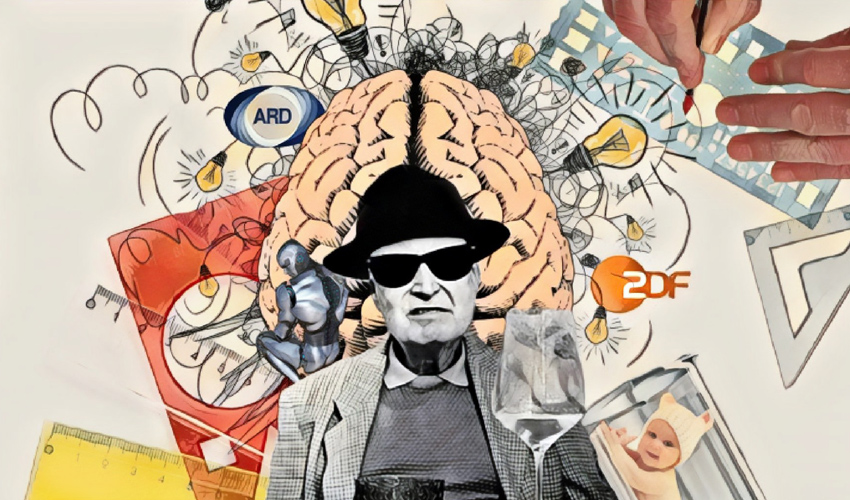

Vielen Dank für diese Einblicke! Gern leben, gern liegen… und in diesem Falle gern lesen.
Definitiv, danke für die Seelenentblößung! Und auch mal wieder ein großes Lob an die Illustratoren.
Man fragt sich schon manchmal ob mit zunehmender Qualität von Fertigkost und immer höher auflösenden Fotokameras andere lebenswichtigen Dinge entsprechend schlechter werden. Quasi damit die Balance immer bestehen bleibt. Das würde die ‚Früher war alles besser‘-Attitude zumindest im Ansatz erklären.
Haha interessante Theses, Fortschritt gibt es also gar nicht? Alles bleibt irgendwie immer gleich, nur die Gewichtung verschiebt sich? Hmmm…
Ein verwandter Gedanke: Alle Menschen sind stolz auf die Fortschritte der Menschheit, doch kein Mensch macht Fortschritte 😉
Vorfreude über alles. Erfüllen muss sich sowas nicht zwangsläufig. Überraschungen sind natürlich vollkommen überschätzt. Ich werde immerhin besser darin die Freude wenigstens vorzuspielen.
Hahaha, sich über Überraschungspartys oder ähnliches zu freuen gehört sicherlich zu den schwersten Prüfungen. 😉 Da braucht es fortgeschrittenes Handwerk.
Woher kommt bloß dieser Neonwahn im Süden? Mein letzter Südfrankreichurlaub ruft sehr ähnliche Erinnerungen wach.
Da sollten Sie mal nach Tokyo, Seoul oder Beijing reisen 😉
Gern! Aber für Neon-Erlebnisse brauche ich bis zur Reeperbahn nur zehn Minuten. Und so viel Soya-Soße wie in Fernost.
Hahaha stimmt auch wieder! 🤣
Giuseppe ist mir suspekt. Ich hatte mal einen Freund, der zu jeder Gelegenheit fröhlich war und lächelte. Lange habe ich’s mit ihm nicht ausgehalten.
Versteh ich. Deshalb verschweige ich ja seine leicht sadistische Seite nicht. Hinter der liebenswürdiger Fassade steckt ein gebrochener Charakter.
So ist das doch in der Regel immer, nicht?! Das Klischee vom traurigen Clown kommt ja auch nicht von ungefähr…
Ist’s nicht interessant, dass wir uns immer wieder über menschenleere Orte freuen? Ob dauerlächelnd oder melancholisch, andere Menschen sind uns doch immer auch ein wenig im Weg.
„Menschenleer“ ist manchmal genauso gruselig, wir proppevoll zu Platzangst führt. In einem Restaurant der einzige Gast zu sein, macht eher argwöhnisch als zufrieden.
Dank der normalerweise wahnsinnig guten Produktqualität und noch hervorragenderen Küche, deprimieren mich diese seltenen „sauschlechten Essen“ in Italien noch mehr als zuhause in Deutschland. Da muss es schon einen sehr guten Grund für solch ein vorsätzliches Opfer geben. Crisco klingt zumindest vielversprechend 😉
Nach freudiger Lektüre grüsst dankbar ihre Brigitte Schmoller. …. ich war als junge Soubrette dort auch schon überall.. natürlich nicht im Crisco Salon!