

1966 war ich noch ganz bei Goethe und Beethoven und ich liebte Genremalerei und Kupferstiche. Diese so gar nicht auf 1968 zulaufende Einstellung habe ich selbst „hinterfragt“, ein Wort, das damals Karriere machte.

Foto: Deutsche Fotothek, Wikimedia Commons
S T I C H
Ein Herr zu Pferd, den Dreispitz auf dem Kopf,
mitten im Tritt das Tier, die Beine leicht gewinkelt.
Ein flinker Hund springt auf die Menschengruppe zu,
die auf dem Sandweg steht, gestikuliert und spricht.
Tänzelnd ein Kind am Arm der Mutter,
drei Herren rechts, bezopft, in Staatsrock, Schnallenschuhen,
gespreizt die Haltung, ihre Beine leicht verdreht.
Ein zweiter Reiter, seltsam gravitätisch,
sein runder Kopf zeigt starr geradeaus,
zum roten Wams blank-braune Stulpenstiefel,
die Peitsche in der Hand.
Daneben noch zwei Herren in Culottes,
die schlanken Beine zaghaft aufgesetzt,
auf ihren Häuptern zierliche Perücken.
Leicht sinkt der breite Weg nach unten ab,
in seiner Biegung eine prunkvolle Karosse,
schnaubende Rösser neigen ihren Kopf.
Die Landschaft lieblich, voller Anmut,
rechts flache Steigung, links ein sanfter Hang,
Gatter entlang der scheuen Wiesen.
Zahllose Bäume, sorgfältig belaubt,
am Ufer eines Sees in langer Reihe,
geschmückt wie für eine Parade fast.
Auf glattem Wasser Boote,
Mühlen spiegeln sich,
und ihre Flügel greifen in das Blau.
Der Himmel weit, mit flüchtig grauen Wolken,
drei schmale Vögel schweben durch den Dunst.
Alles scheint wie von ungefähr
und ist dabei doch nur gestellt, gestelzt;
nicht eingefangen, wie gewollt, der Augenblick,
durch jene Bilder träumt die Ewigkeit,
versteckt in zeitgebundener Gebärde,
friedlich, gläserne Miniatur.
Warum nur kleide ich die Sehnsucht
in Überröcke, in Vergangenheit,
setze ihr den Kapotthut auf,
stopfe das Busentuch,
presse sie unter Schnürmieder und Reifröcke,
zwäng’ sie in Krinolinen?
Viel zu enge Schnallenschuhe hemmen ihren Flug,
all das muffige Geflitter
ist doch Selbstbetrug!
Nein, besser war die Vergangenheit nicht!
Aber soll deshalb die Sehnsucht erfrieren?
Nackt muss die sterben,
so hülle ich sie
in prunkvolle Gewänder.
Ihr Ziel bleibt unerreicht,
doch sie kann ich mir greifen,
am Saum der Schleppe, die sie trägt,
Schweif lichtjahrfernen Kometen,
daheim in der Leere des Alls;
verloren, ohne das Wissen
um die Vergangenheit.
Nur sie bringt Hoffnung auf keine Zukunft,
wie sie doch kommen muss und wird.
Die eigne Zeit kennt nicht den Überblick,
hat nur die täglichen Alltäglichkeiten,
den blassen Ruf der Uhr.
Wir können keine Zeit begreifen,
die fremde nicht und nicht die eigene.
Mein Traum ist eine Stunde ohne Zeit,
nur eine Stunde – und der Zeiger steht gelähmt.
Oft bin ich im einsamen Wald,
blinzle durch steinerne Bäume,
am Rain liegt vielleicht Babylon.
Oft schließ’ ich im Gras meine Augen,
die Sonne malt warmes Rot.
Verdeckt durch die Lider treibt vielleicht schon
der Hirt seine Schafe davon,
sucht die Stunde sich jüngere Weiden:
unsere Wiesen abgegrast, tot.
Zeitlosigkeit – maßloser Gedanke,
ganz überschwemmt von Sein, während
jede Entwicklung erstarrt.
Zeitlosigkeit – nichts lischt, nichts verdirbt,
unvergänglich, was je geschaffen,
Ruhm wäre für ewig erworben!
So aber:
taubes Vergessen.
Der Mensch stirbt sich rasch hinterher.
Das Aktuelle ist tageswichtig.
Nur das, was den Menschen jetzt betrifft,
wird ihn jetzt auch berühren und fesseln.
In dies Gewand muss meine Botschaft schlüpfen,
will ich, dass er sie hört.
Das immer Gültige steht stets an zweiter Stelle,
auch dann noch, wenn die erste längst gewechselt hat …
Modern ist gut, zeitnah ist gut,
doch zeitlos – das ist besser!
Die Zeit, sie ist wie ein Drachen:
Wir rennen seinem Steigen hinterher.
Stürzt er herab, verschnaufen wir und warten,
schwingt er sich aber auf, folgen wir keuchend.
Fang dir das Fabeltier rechtzeitig ein!
Betrachte sein Zappeln im Käfig,
und lächle über sein Flügelschlagen,
das nur metallene Stäbe trifft!
Wird dir das Lärmen zu viel,
dann nimm ein Tuch,
bedecke seinen Käfig –
Ruhe herrscht,
wenn du es willst!
(1966)

Foto: bejo/Shutterstock













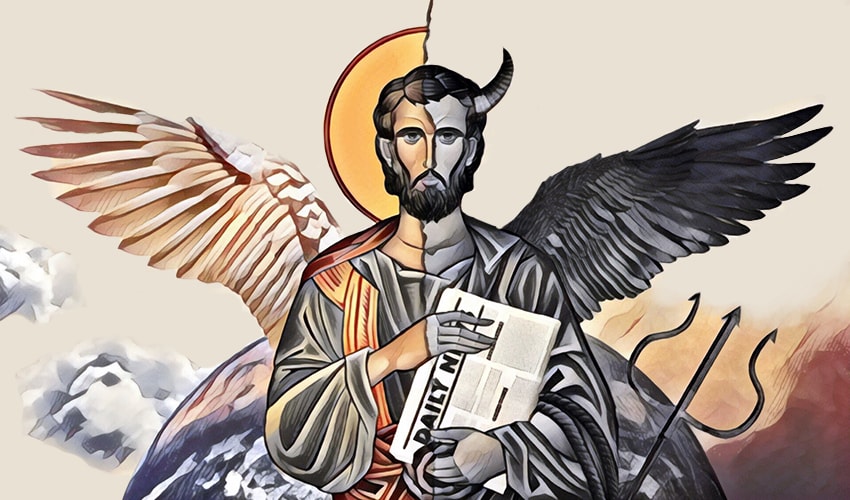





















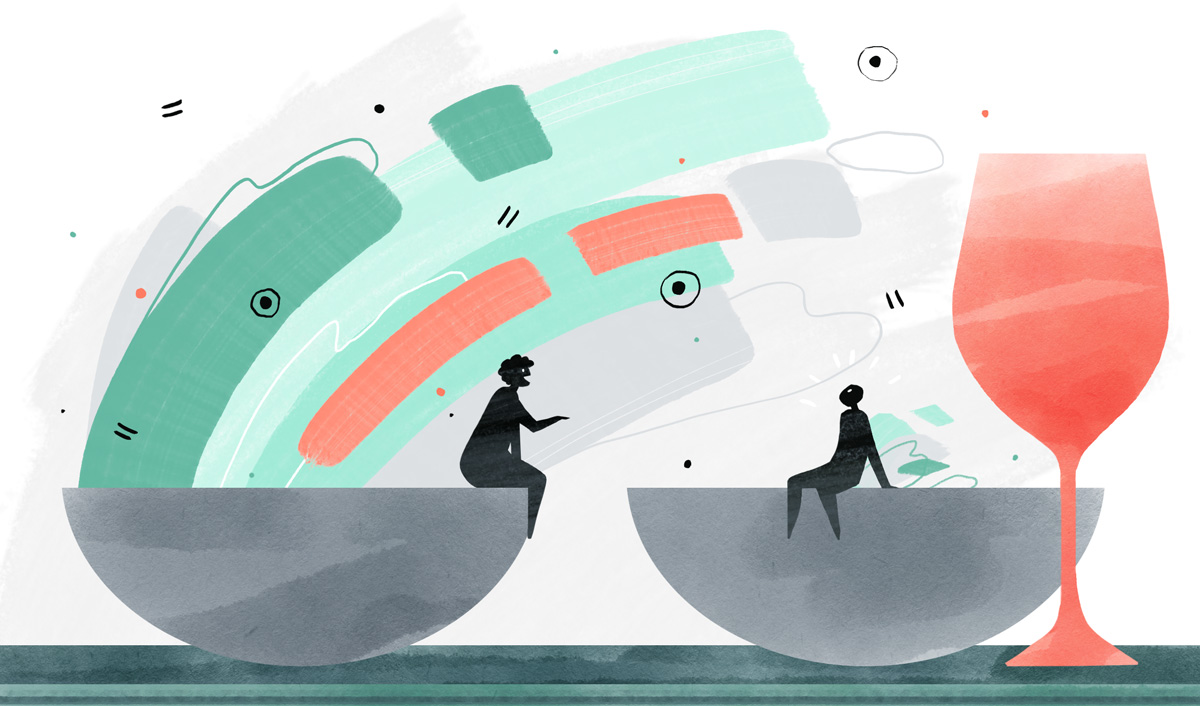



























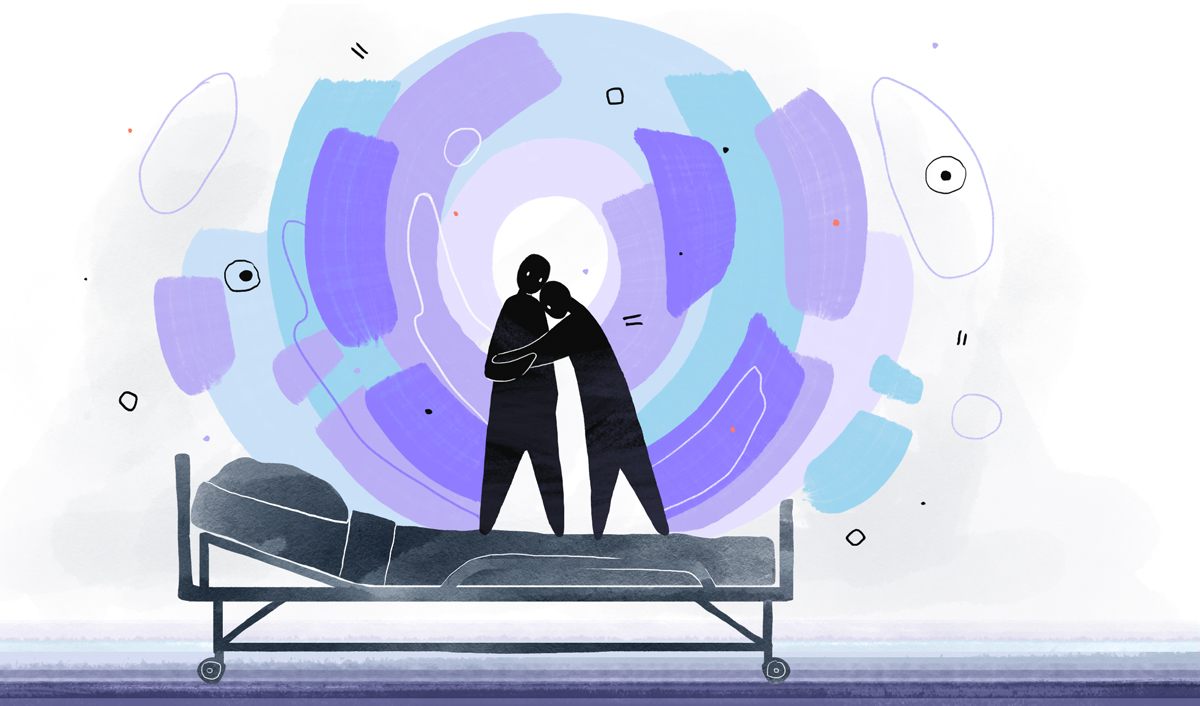




Manchmal frage ich mich schon, ob die Karriere des Hinterfragens langsam vorbei ist. Vielleicht erklären sich dadurch die Erfolge von populistischem Denken à la AfD?!
Es gibt Gott sei Dank noch genug Verrückte, die sich noch trauen sich und die Welt zu Hinterfragen. Der Populismus hat nicht gewonnen.
Ist „Populismus“ Stimmenfang durch „Nach-dem-Mund-Reden´? Gar nicht einfach, das nicht zu mögen.
Ist Populismus nicht mehr als ein Nach-dem-Mund-Reden eher ein Stimmungen-für-die-eigenen-Zwecke-ausnützen?!
Ja, da haben Sie recht. Aber der Übergang ist fließend, denn nicht jeder Populist hat neben dem Wunsch gut anzukommen auch eine eigenständige Botschaft.
Völlig richtig. Oft genug reicht es nicht mal zur eigenen Überzeugung. Geschweige denn zu einem Programm.
Besser war die Vergangenheit nicht. Aber weil wir meistens eher die schönen Erinnerungen sammeln, läuft man schnell in die Falle alles zu verklären.
Das zeigt uns vor allem wie unzufrieden wir von Natur aus sind.
Stimmt das? Wir sammeln das, was uns am meisten beeindruckt hat, das Negative nicht weniger als das Positive.
Ich würde auch nicht behaupten, dass meine Vergangenheit nur aus positiven Erinnerungen besteht. Schmerz und Verlust kommen genauso vor. Unzufriedenheit mit dem Jetzt nützt da auch nichts.
Nur was den Menschen betrifft, wird ihn auch berühren. Das ist leider sehr wahr. Ich muss es selbst oft feststellen, wenn ich mir die Nachrichten mit all den grausamen Meldungen anschaue. ‚Wirklich‘ betroffen bin ich meist nur wenn ich einen persönlichen Bezug habe. Schlimm aber wahr.
Es geht wohl nicht anders, sonst kämen wir aus dem Heulen ja gar nicht mehr raus.
Da haben Sie auch wieder recht. Wahrscheinlich braucht man das als Überlebensinstinkt.
Vor allem nützt Heulen immer so wenig. Zumindest nicht wenn es wieder mal um einen Amoklauf oder einen Terroranschlag geht. Handeln müsste man.
Ich habe kein Problem mit der Zeit, ebenso wenig wie mit dem Leben. Vieles ist schwierig, aber da muss man einfach durch. Es lohnt sich trotzdem.
Das sagt sich manchmal sehr leicht.
Ich wüsste gar nicht was Zeitlosigkeit für mich bedeuten würde. Soweit reicht meine Vorstellungskraft nicht.
Wenn man „da durch muss“, scheint es ja doch Probleme zu geben. Von außen betrachtet kommt mir manches Leben überhaupt nicht lebenswert vor. Aber häufig kommen die, denen es eher schlecht geht, besser mit dem Leben zurecht als die, denen es offensichtlich gut geht.
Meist ist es ja die eigene Betrachtung auf seine Alltäglichkeit, die einen selbst langweilt. Deswegen ist das Leben der Anderen meist das Intessantere. Spannender haben sie es aber mit sich selbst auch nicht.
Ich finde die Suche nach dem Sinn im Leben tatsächlich ein First World Problem. Je besser es einem geht, desto eher fragt man sich wozu das alles.
Zeit, wenn sie davonrast ist das Traurigste. Wehmut über Glückempfinden. Wenn Zeit still stehen bleibt, ist sie eine Qual. Langeweile.
Solange man sie ausfüllt geht’s ja noch. Das schlimmste ist doch, wenn man im Nachhinein denkt etwas im Leben verpasst zu haben.
Man muss sich eben vorher gut überlegen, auf was man verzichtet und warum. Ich habe sehr, sehr vieles nicht gemacht, aber nichts davon habe ich gewollt.
Es gibt so viele spannende Dinge im Leben, so viele Möglichkeiten, so viele Wege… Verzicht gehört dazu. Grämen brauch man sich darüber sicher nicht.