
Video (Ausschnitt aus ‚Zwischenraum‘ – Teil 2): Privatarchiv H. R.
Brief vom 30.09.’83 an Pali – Teil 1
Also wirklich der letzte Tag? Der übliche Block sträubte sich: Er blieb versehentlich zu Hause. ‚Zu Hause‘ – wie das klingt! Der Stift sträubt sich. Er verweigert den Dienst.

Fotos (3): Privatarchiv H. R.
Dieser nicht. Es ist juliwarm, heißfeucht. Ich sitze im Café, wie immer. Schwitzend, wie fast nie. Noch einmal meine drei Lieblingsbeschäftigungen: Wein trinken, Menschen beobachten, Feuilletons schreiben. Mit diesem einen letzten Tag bekomme ich noch einmal das Geschenk dieses Sommers: Hitze und Neugier. Das ist das Gemeine am Winter, dass er die Neugier so abstumpft. Irgendwie ist man mehr interessiert, was hinter freien Stirnen oder Locken vorgeht, als was hinter Kopftüchern und Pelzkappen gedacht wird. Anschmiegsame Sommerhosen machen halt den Beschauer wahnsinniger als Michelin-Männ(tel)chen. Noch münden lange Beine in griffige Ärsche und nicht in wulstige Jacken. Noch sind die Brusthaare das einzig sichtbare Fell am Leib. Noch, noch, noch. Es gibt nichts Aufregenderes als Menschen, und damit mein ich nicht bloß mich. Ich habe immer das Gefühl, bei euch als egoman zu gelten. Also so eine Unverschämtheit! Mich interessiert alles! Und alle! Wie könnte ich sonst Situationen und Menschen mit sparsamen Strichen skizzieren, wenn ich sie nicht beachten, betrachten und erfassen würde?
Dieses Papier ist grässlich. Man muss so klein schreiben wie ein Buchhalter ins Kassenbuch.

Foto: Privatarchiv H. R.
Also: Ich interessier’ mich nur für andere und bin mir selbst egal, abgemacht?
Nur immer die Panik, dass, wenn man sich selbst egal ist, es den andern erst recht so gehen wird. Warum wohl Susis Sorge, Mühe und Hingabe für Frisur und Make-up jeden Morgen oder Palis 80 Paar Schuhe auf dem Boden? Kaum, weil sonst der kaufmännische Leiter beim Abendbrot zu seiner Frau sagen würde: „Übrigens, auf dem Flur der Kreativen wird neuerdings modemäßig geschlampt!“
Es ist ein Anspruch an sich selbst, ein Anspruch an die anderen und ein Anspruch an die Kommunikation zwischen beiden.
Und wenn mich ein Vorübergehender rasend macht, dann muss ich eben wettbewerbsfähig genug sein, ihn auch rasend machen zu können – sonst macht Leben keinen Spaß, kann allerdings trotzdem wichtig und ehrenwert sein, für andere.
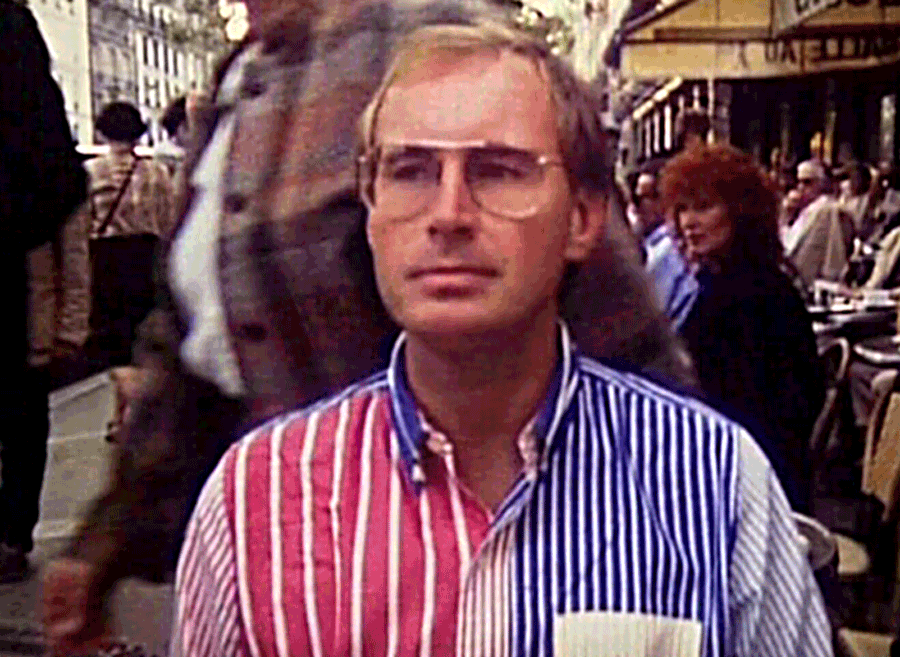
Fotos (2): Privatarchiv H. R.
Ob die Kerle das machen, um mich zu ärgern? In so aufreizenden Scharen sind sie doch seit Wochen nicht mehr hier vorbeigezogen. Diesen (un)gerechtfertigten Anspruch im Gesicht. Eine durch runtergespielte Eleganz verschleierte Wildheit im Gang, im Gebaren. Die katzenhaften Frauen: satt und gefräßig.

Foto: Privatarchiv H. R.
Ich spüre, wie die Anästhesie reibungslos funktioniert: Der Abschied betäubt mich mit Ungläubigkeit und nimmt mir so den Schmerz. Es kann nicht sein, es kann nicht sein! Schweig stille, mein Herze!
Irene, die Frostige, brachte die Hitze nach Paris. Seit sie da ist, steigt das Thermometer täglich auf 30 C am Mittag und sinkt nachts nicht unter 22 Grad. Ganz ich selbst war ich noch nicht, als sie ankam, denn genauso wenig, wie es eine Pille gibt, die schlagartig gesund macht, genauso wenig gibt es eine, um das Lebensgefühl wiederherzustellen.

Foto: Privatarchiv H. R.
Ich hatte Gewohnheiten geändert und die Änderungen beibehalten: kein Radio hören, zum Beispiel. Die Musik war weg.
Ich habe in den letzten Tagen weder geschrieben noch komponiert. Der Aufenthalt ist in eine andere Dimension gerückt – eine kleinere. Aber: Alles ist gut, wie es ist. Bereuen soll man vorher, nachher ist es Quatsch.
Wir fuhren rein nach Paris. Irene richtete sich für eine Nacht in meiner Wohnung ein: Hotel ab Sonntag erst möglich. Dann eine erste Hannosche Gewalttour für den Überblick. Von fünf bis neun auf den Füßen, dann essen. Skrupellos schlucke ich, was Speise- und Weinkarte bieten. Ich definiere mich als genesen. (Es klappt leidlich, denn Körper sind ja mehr zum Funktionieren da als dafür, Rücksichtnahme zu üben.)
Zu Hause war ich müde. Kein Schreiben, kein Klavierspielen, kein Ausgehen. Allein lebt sichs gefährdeter und kreativer.

Foto: Privatarchiv H. R.
Der Sonntag brachte Herbes. Zunächst mal: Das Hotel hatte meine Bestellung annulliert, „weil Ihr Name nicht im Telefonbuch steht“. Stundenlang rannte ich mit Irene durch die Gegend: Nicht mal in den schlimmsten Absteigen war ein Zimmer frei.
Ich hatte mich mit dem Gedanken anzufreunden, Irene die Woche über in der Wohnung zu haben. Mit diesem Gedanken Freundschaft zu schließen, war so einfach wie mit der Idee, seinen Urlaub mit Heinrich Himmler und Beate Uhse zu verbringen.
Beim Mittagessen in einem wunderschönen Restaurant auf einem wunderschönen Platz war ich der Verzweiflung schon nahe. Erst störte die Sonne. Wir mussten uns dreimal umsetzen. Dann war der Salat zu bitter. „Also so möchte ich nicht mehr essen“, sagte Irene, die einen gemischten Salat bestellt hatte und enttäuscht darüber war, dass er aus Frisée, Eichblatt, Radicchio und Eisberg bestand statt Tomate, Gurke etc. Es klang ein wenig so, als hätte ich sie wochenlang an die Pommes-frites-Bude geschleppt. Von Zeit zu Zeit machte sie mich auf abscheuliche Ziegen aufmerksam, um mir zu sagen, was für hübsche Mädchen das seien.
Sie war dabei, mir Paris zu versauen, mir madig zu machen, was ich mochte. Ich fand sie eine sehr fremde Frau und sah mich zu ein paar angemessenen Worten genötigt.

Foto: Privatarchiv H. R.
Am frühen Nachmittag trafen wir Klaus Bülows Bruder Gerd. Auf dem Weg dahin begegnete uns ausgerechnet der bezauberndste Junge meines Lehrgangs: sanft und einsam in St. Germain. Na schön, ich mit Mutter zu Bülow und per Bahn nach außerhalb. Er schleppte uns durch Colberts Schloss und Park, wobei er fundierte Halbbildung verbreitete. Abends waren wir noch zusammen mittelmäßig essen. Irene war halbwegs zufriedengestellt, obwohl ihr Gerd Bülow natürlich auch zu mittelmäßig war, aber es ging so hin.
Irene und ich hatten eine kleine Auseinandersetzung. Sie pfiff sich kräftig Valium ein und zog sich in ihr ‚kleines Reich‘ zurück, wie ich es nannte: d. h. auf die Balustrade, wo ihre königliche Matratze zwischen Pappkartons gebettet war. Das Geländer hatte sie zu Klein-Neapel stilisiert: Mit Wollschlüpfern und Nylonstrumpfhosen hielt weibliche Anmut dort Einzug, wo vor Kurzem noch aufgereckte Männerschwänze in dumpfer Lust gegeneinander gewütet hatten.
Sie hatte mit Gerd Bülow so lange im Park räsoniert und sich darüber ausgelassen, dass das, was mit den Aristokraten während der Französischen Revolution geschehen sei, schlimmer gewesen wäre als das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben, dass sie nun in tiefen chemischen Schlaf sank. Sie selbst war ja davongekommen. Ihr Vater eher nicht. So entsteht Geschichte.
Ich war nicht sonderlich animiert und blieb gesunderweise ebenfalls zu Hause.

Foto: Privatarchiv H. R.
Montag liefen wir rum. Abends war Essen mit Anne Stephan angesagt, einer Freundin von Krystian Zimerman. Es war geplant, dass ich mit Anne bei ihr von acht bis neun sitze und plaudere. Um neun wollten wir mit Irene essen gehen.
Ich setzte Irene in ein Café und kam allerdings bei Anne erst mit zwanzig Minuten Verspätung an, weil die Straße so lang war und ich drei U-Bahn-Stationen zu früh mit Irene ausgestiegen war. Anne, 29, hübsch, russischer Abstammung, öffnete Champagner und erhielt ein Telefongespräch nach dem anderen. Endlich kamen wir zum Trinken. Ich erwähnte diskret die wartende Irene, aber Anne fand mit Recht, die Flasche müsse doch alle werden, und was ich denn so von Krystian hielte. Ich kenne ihn doch auch gut. Also sie sei ja sicher, dass er schwul sei. Ob mein Instinkt mir das nicht auch sage – also ihrer einwandfrei. Und seine Frau, na ja, eifersüchtig seien sie ja noch aufeinander, aber das sei auch alles und mehr sei auch nie gewesen. Ich hielt mich sehr bedeckt.
Trotzdem war es halb zehn, als wir auf der Straße waren. Irene schäumte, verlangte, nach Hause gebracht zu werden und zischelte mir zu: „Das ist eine solche Unverschämtheit! Pali hat ganz recht, du bist völlig rücksichtslos!“ Dann kam sie doch mit zum Essen. Eine Stunde warteten wir auf den Tisch, dann war es laut und unerheblich.
Ich merkte im Auto, dass ich meine Kamera vergessen hatte. Sie war aber nicht am Essplatz liegen geblieben, sondern schon anderthalb Stunden vorher an der Bar in Gewahrsam genommen worden. Irene wurde ins Bett gebracht. Ich musste noch mal zu Anne und die zweite Flasche Champagner austrinken. „Weiß sie eigentlich, dass du nicht zu heiraten planst?“, fragte Irene am nächsten Morgen.

Foto: Privatarchiv H. R.
Am Abend dann war Essen mit Bruno: vornehm. Er gefiel Irene sehr gut. Sie unterhielten sich Englisch miteinander, was etwa so war, wie wenn ich mit unserem norwegischen Kollegen Portugiesisch rede.
Ich war fast bis zu Tränen gelangweilt und würgte an meinem ekligen Essen. Gegen Ende kriegte Bruno allerdings einen amüsanten Koller und flirtete mit dem spröden, sehr reizvollen Kellner. (Irene: „Ich habe erst bemerkt, dass er auch ‚so‘ ist, als er sich mit diesem grauenvollen Kerl eingelassen hat. Der war ja ganz widerwärtig.“)
Sie ist sicher eine achtenswerte Frau. Aber sie trägt ihre Vorurteile mit dem pompösen Charme der britischen Kriegsflotte vor sich her.
Außerdem fand ich sie ungemütlich. Meine Gelassenheit war dahin. Am Morgen schon hatte mich Guntram durch seinen Anruf wahnsinnig gemacht. Um 9 Uhr nach viel Champagner und vier Stunden Schlaf hatte er mich wachgeklingelt: „Was, du schläfst noch? Ich bin schon im Büro.“ Ob es denn was Wichtiges gäbe, hatte ich feindselig gefragt. Jeden Morgen glaubt er Irene mitteilen zu müssen, wie das Wetter in Hamburg ist, aber wenn ich aus Meran Roland einmal anrufe, ruiniere ich ihn.

Foto: Privatarchiv H. R.
Warum ich mir das Ganze eingebrockt habe? Weil ich nicht Nein sagen kann, es mir anders vorgestellt habe – und weil ich sie für den Film brauchte: Peng! Gegenseitige Ausnutzung wird im Allgemeinen nicht so genannt.
Es wurde also Film gemacht und Sightseeing von Eiffelturm bis Sacré-Coeur, von Notre-Dame bis Bastille. Und es wurde besser. Alles schliff sich ab und spielte sich ein, und inzwischen bin ich’s ganz zufrieden.

Foto: Privatarchiv H. R.
Das mit dem Ausgehen abends hat sehr nachgelassen. Natürlich hab’ ich das ein oder andere versäumt: noch was Schickeres, Witzigeres, Geileres, Helleres, Schwärzeres. Aber irgendwann ist eben mal Schluss, und dann kommt das Resümee. Da muss ich natürlich von vorgestern Abend berichten. Aber es ist jetzt sieben, dunkel durch die Zeitumstellung, und ich muss nach Haus zu Irene.
Ade, Pariser Cafés! Wer weiß, wo ich weiterschreibe.

Foto: Privatarchiv H. R.
Hier. Wien. Maazel dirigiert die ‚Sinfonia domestica‘. Irene im Publikum, ich mit Team im Studio. Ich werde als Produzent auf dem Cover stehen. Gegen meinen Job habe ich einen so heftigen Widerwillen und gegen die Unerheblichkeit dieses Gefiedels, dass ich mich frage, ob es nicht wirklich besser wäre, aus dem eigenen Müll was zu machen, als aus fremder Leute Kunstverrichtungen.

Foto: Privatarchiv H. R.
Mittwoch Abend aßen Irene und ich bei uns um die Ecke rohes Gewürm. Das ist typisch französisch: nach Klitoris schmeckende Muscheln und nach Pissoir duftende Seeigel. Alles direkt aus dem Meer und so über alle Maßen fies, dass wir die Ekelschwelle nur mit sehr viel Wein auf ein mundöffnendes Level herunterspülen konnten. Aber natürlich sehr lustig. Wir zeigten uns gegenseitig das rohe Gequappel, bevor wir es von der Gabel schnappten, wie Kinder, die schamlos-verschreckt zum ersten Mal ihre jeweiligen Geschlechtsteile einander bewundern lassen.
Nachtisch: was Cremiges. Dann musste Irene ins Bett und mein Eiweißschock unter die Leute gebracht werden.


Fotos (2): Privatarchiv H. R.
Ich dachte, vielleicht könnte ich Max noch im Café ‚Central‘ treffen. Wir waren vage verabredet gewesen, aber weil ich mit Irene zu spät von einer Seine-Bootsfahrt zurückgekommen war, hatte ich ihn am Telefon nicht mehr erreicht. Also ließ ich Irene wissen, ich wollte noch zusehen, ob ich Freunde im Café auftriebe, sie sagte karg: „Lüg nicht! Das ist nicht der Grund, warum du gehst!“
Hätte sie sich das nicht verkneifen können? „Na schön!“, dachte ich, beeinflussbar, wie ich bin, und schritt geradewegs zum ‚Sling‘. Da waren die oberen, entscheidenden Räume geschlossen und auch sonst nicht viel zu erben, außer einem, mit dem ich schon mal in Wien was auf der Straße gehabt hatte. Also ‚BH‘.
Vor Desorientiertheit ging ich in die verkehrte Richtung und landete erst gegen zwei dort. Ich musste mich allerdings zunächst ein bisschen einleben. Auch Irene in der Wohnung limitierte die Möglichkeiten.
Schließlich gefiel mir doch einer ganz gut. Und er war auch weidlich interessiert. Nur dass sich ein Hagerer unverschämt dazwischendrängte, was ich ja noch hingenommen hätte, wenn er mich nicht dabei völlig wegzuschubsen versucht hätte.
Ich sah mir das eine Weile missvergnügt an, aber als sein Drängen gegen meinen Partner stärker und sein Betragen gegen mich harscher wurde, zog ich beleidigt meinen Schwanz raus und wunderte mich selbst, mit welcher Ausdauer ich ihm gegen’s Bein und an den Jeans runterpissen konnte. Zwar wurde er mir dadurch nicht, wie erhofft, gewogener, dafür aber zog er sich zurück. Auch schon was.
Mit meinem Partner (in spe) hatte ich mich durch die Ereignisse allerdings auch ein wenig auseinandergelebt, und so trennten wir uns nach weiteren fünf Minuten in gegenseitigem Einvernehmen.
Als ich in die beleuchteteren Gefilde kam, erwartete mich Unerfreuliches: Der Hagere hatte die Pisse nicht so geil gefunden. Was ich nicht hatte ahnen können: Er war Mitglied einer Gang, die nun ziemlich bedrohlich auf mich losschoss, mich in eine Ecke drängte und nach Rache schrie. Ich sollte nur versuchen rauszukommen, da würden sie mich kurz und klein hauen. Sie sahen wirklich so aus, als ob ihnen das Mordsspaß machen würde. Neben Alkohol mischte sich der eisige Schreck in mein Blut, während das Blut meiner Gegner hitziger und hitziger zu brodeln schien. Sie wetzten grausige Lächeln in ihren Gesichtern, gingen dann auseinander und hielten mich unter Beobachtung, wobei sie von Zeit zu Zeit genüsslich die Faust reckten.
Ich dachte kurz das mir geläufige Repertoire von ‚West Side Story‘ bis James Bond durch, ohne auf eine für meine Situation klaubare Idee zu stoßen (zumal ja die ‚West Side Story‘ sowieso kein erfreuliches Ende nimmt).
Ich dachte an gequetschte Nieren, Leberriss, Schnitte im Gesicht, eingedrückte Rippen und Schädelbasisbruch. All das wollte ich nicht, ich wollte nicht mal mit einem blauen Auge davonkommen. Einen zweiten Ausweg hatte die verdammte Höhle nicht. Noch wimmelte es von Menschen. Das war gut. Aber draußen würde es menschenleer sein. Das war schlecht. Abwarten brächte nichts. Oder konnte ich mich hier irgendwo verstecken? – Unmöglich. Und dann bis zum nächsten Abend gefangen sitzen. Also raus, durch die einzige Tür! Wenn ich sofort wegschlüpfte, gelänge es mir vielleicht, ihnen zu entkommen, aber ich mochte meine vorne an der Garderobe hängende Jacke nicht fahren lassen. Also ging ich, sie zu holen. Während dieser Zeit begaben sich, wie erwartet, meine Feinde schon nach draußen.
Ich fragte den Garderoben-Menschen, einen Schrank, ob er Englisch spräche. – Nein. Also ging die folgende – ‚Unterhaltung‘ kann man das nicht nennen, in Französisch vor sich.
Ich würde bedroht von einigen Leuten. „Wo?“, fragte er, „wo sind sie?“ Ich starrte in Bärte und Leder. „Ich weiß nicht“, sagte ich. Rausgegangen, die meisten. Ob er mir eine Taxe direkt vor die Tür rufen könne (da reinzuhechten stellte ich mir allerdings auch nicht so einfach vor). Das könnte er nicht, sagte er, aber an der Rue de Rivoli, keine 50 Meter entfernt, seien immer welche. Ob ich aber so weit kommen würde, fragte ich ihn und mich zweifelnd. Er ging zum Wirt, dem ich zutraute, in und vor seinem Laden keinen Ärger haben zu wollen. Und wirklich. Er schickte mir den Schrank mit auf den Weg.
Wir traten vor die Tür: niemand. „Niemand“, sagte er und wollte schon umkehren. Ich bat um Begleitschutz bis zur Rue de Rivoli – in der Tat, da standen sie schnaubend. Der Schrank sagte etwas zu ihnen, der Angepisste trat krakeelend vor und zeigte seine Nässe. Der Schrank sah mich an. Eine Taxe kam von Weitem. Sie halten ja nie in Paris. Wenn man mit Koffern im Regen steht, wenn man fiebergeschüttelt zur Apotheke will, hält keine. Nie. Aber die! Die ja! Ich hätte sie abküssen können. Nun wollte mich der Schrank festhalten, um die Sache aufzuklären. Ich riss mich los, stürzte mich ins Auto und stieß den Straßennamen aus. Der Wagen fuhr an, hinter mir hörte ich Verwünschungen grölen. Fünf Minuten später schloss ich die dicke Eichentür auf und war gerettet.

Foto: Privatarchiv H. R.
Irene war gegen drei aufgewacht, ihr war, als wäre ich durch den Raum gegangen, und da sie abergläubisch ist, hatte sie sich beunruhigt. Doch nun, eine Dreiviertelstunde später, säuselte sie schon wieder in ihrem kleinen Reich jenseits der Balustrade.
Das ‚BH‘ war damit für diese Reise erledigt und wäre es auch gewesen, wenn ich noch vier Wochen in Paris geblieben wäre.
In Amsterdam kenne ich einen, der will nur immer auf die Jeans gepisst werden. Sobald man etwas tiefer in ihn eindringen will und sei es nur am Hosenschlitz, ist er unwillig und wartet auf mehr Pisse für seine Kleidung. Der Hagere hier nun wieder so gar nicht! Da kenn sich einer aus mit den Schwulen! Dass man sich Aids bei ihnen holt, nimmt man ja schon in Kauf, aber Kloppe? – Nein, danke!
Video (Ausschnitt aus ‚Se(h)en‘ – Teil 1): Privatarchiv H. R. | Titelbild: Alex Harmuth/Unsplash













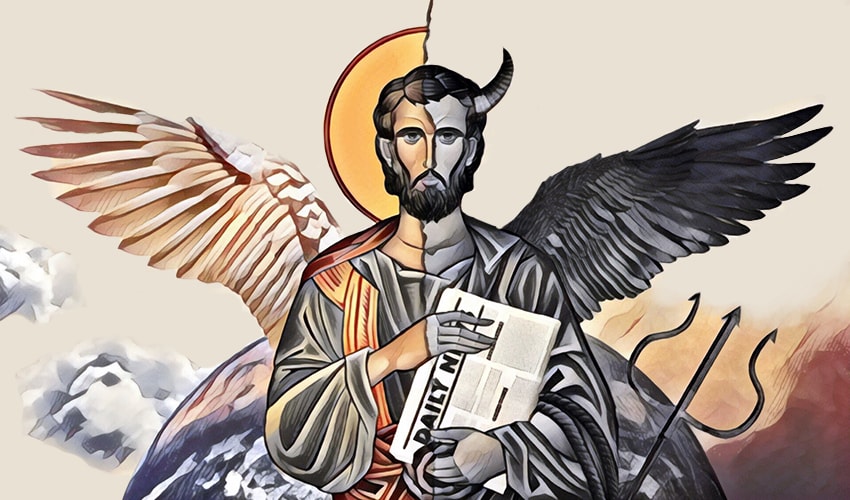





















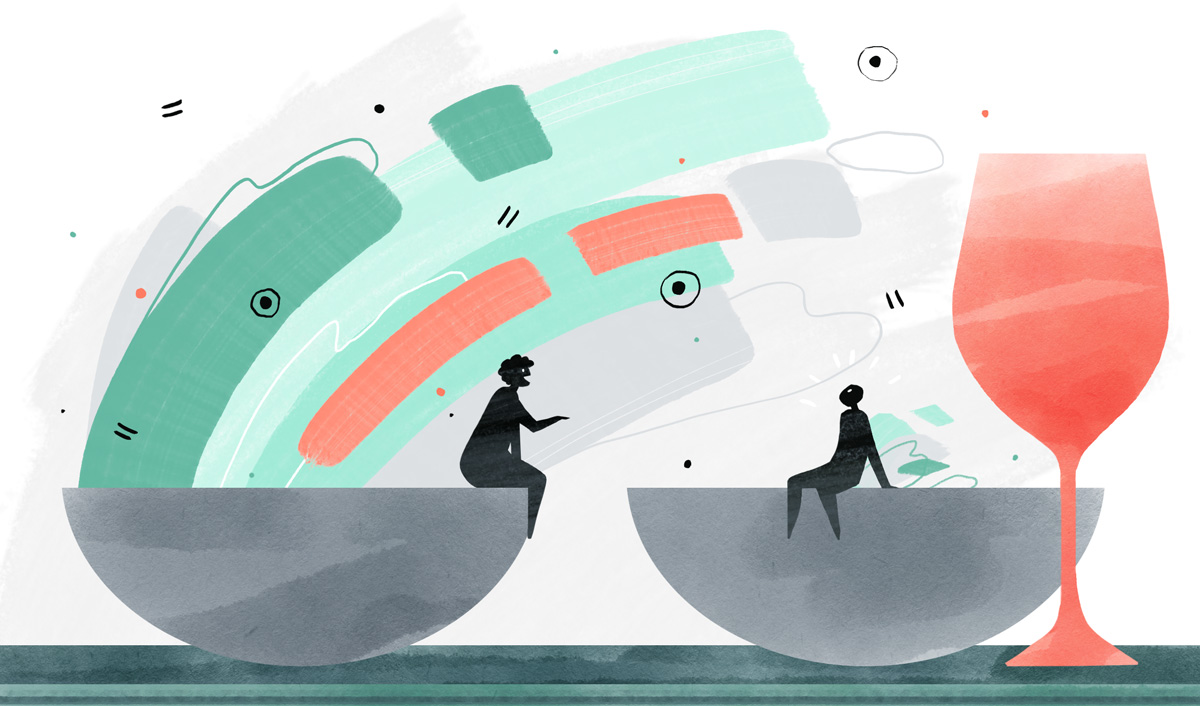



























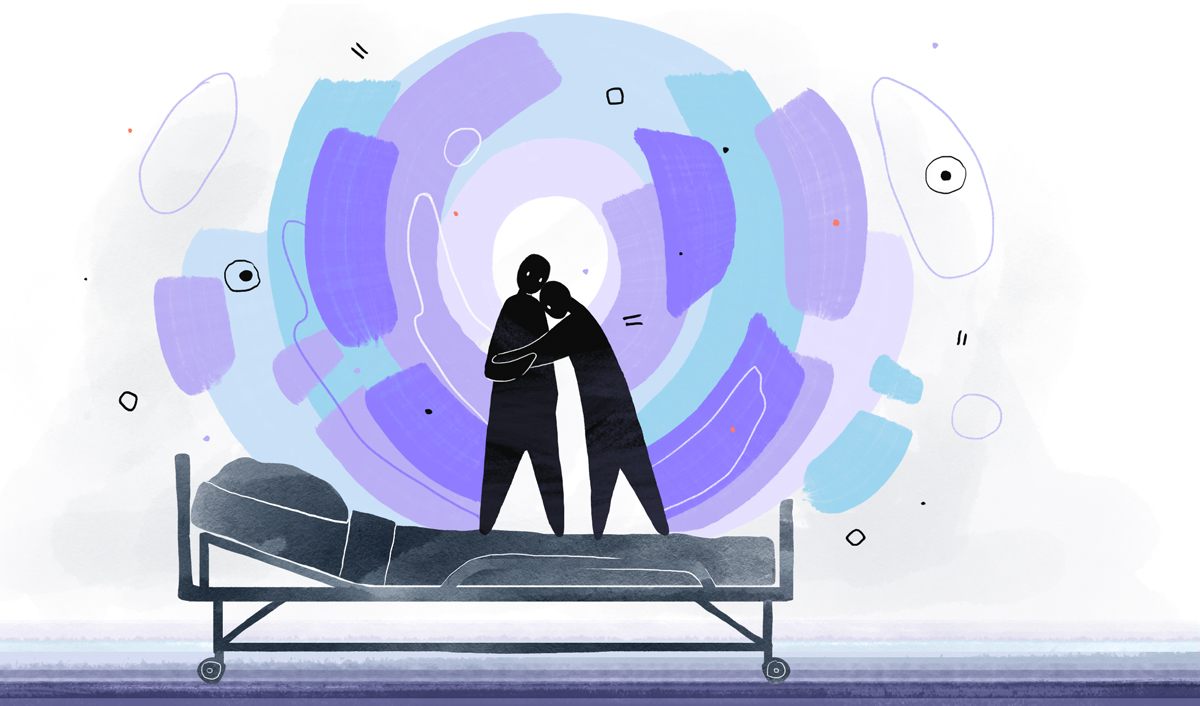




Eine durch runtergespielte Eleganz verschleierte Wildheit im Gang. Das klingt so richtig nach Paris und dem Marais.
Und nach mir als Beobachter.
Haha, auch das kommt hin.
Das ist vielleicht nicht der wichtigste Teil dieses Briefes, aber Irenes Ärger über den gemischten Salat kann ich nur zu gut verstehen. Wieviele enttäuschende Salate ich schon in Restaurants gegessen habe!
Hahaha, ja beim Salat wird gern gespart. Jedenfalls in mittelprächtigen Restaurants. Kleine (aber feine) rustikale Gaststätten sowie gehobenere Restaurants können das manchmal besser.
Ich akzeptiere Salat nur noch als Beilage, wenn ich das Lokal nicht kenne.
Man kann jedenfalls nicht sagen, dass Sie in Ihrem Leben nichts erlebt hätten!
Und man kann auch verstehen, dass dieser Herr ein wenig angepisst war 😉
Mental wohl ziemlich, physisch sehr.
Der „große Krach“ war in dem Fall wohl vorprogrammiert. Aber manchmal braucht es solchen Übermut im Leben.
Tolle Geschichte! Keine Frage. Man wird trotz oder vielleicht sogar ob der großen Aufregung eine wenig neidisch auf Ihr junges Selbst.
Aufregungen sind immer schön – nachher, wenn man von ihnen erzählt.
Ob der Herr mit der nassen Hose das nach all den Jahren ähnlich siehst?
Der Winter stumpft die Neugier ab. Der Ausspruch ist mir neu, aber das Gefühl kenne ich eigentlich sehr gut.
Ja, das kommt so hin.
Meine Aussprüche sind mir auch meistens neu…
Hahaha, und man freut sich aber ungemein, wenn einem solch ein Ausspruch einfällt, nicht wahr?!
Freuen tut man sich, wenn man ihn nachher liest. Der Einfall hat ja immer etwas Selbstverständliches. Was erst nach langem Ringen entsteht, macht den Schöpfer vielleicht stolzer, besser muss es – ungerechterweise – nicht sein.
Das ist wohl richtig. Mühe allein bedeutet leider nicht sofort auch Qualität.
Ich glaube beim Sprechen denkt man auch selten über Qualität nach. Den breiten Wortschatz bzw. die Fähigkeit pointierte Aussagen zu treffen trainiert man ja nicht beim Small Talk.
Doch. Zumindest Schlagfertigkeit.
Ich finde es ja toll, dass auch in diesen aufregenden Geschichten Ihre Eltern vorkommen. Es bestätigt wieder, dass Sie wohl ein sehr gesundes Familienverhältnis hatten.
Wir haben täglich daran gearbeitet. Anders gelingt es wohl auch nicht.
Es gibt nichts Aufregenderes als Menschen. Und weil Sie das schon vor 40 Jahren so sahen, haben wir nun auch alle etwas davon. Vielen Dank für diese sehr persönlichen Briefe und Einblicke.
Danke sehr. Ich bin gespannt, was Sie sagen werden, wenn nach dieser Paris-Einleitung am Karfreitag der Hauptteil beginnt.
Herr Rinke, ich bin wie immer gespannt und freue mich auf die kommenden Kapitel.
Also kein Strauss-Fan?
Aber durch den Job bei der Grammophon haben Sie doch bestimmt auch richtig viele spannende Sachen erlebt?
Ja, und viele auch beschrieben. Im Blog z.B. Atlantische Turbulenzen: Kapitel #5 und #6 (Boston) und Winterreisen mit Sommern Teil 3 Kapitel #4 (München).
Die ‚Vier letzten Lieder‘ liebe ich. ‚Die Liebe der Danae‘ in Santa Fe war eins meiner schlimmsten Opernerlebnisse. Open Air bei Regen in der Wüste.
Ist es vielleicht nicht sogar besser man trägt seine „Vorurteile mit dem pompösen Charme der britischen Kriegsflotte vor sich her“ als dass man hinterrücks über Menschen redet?
Sehr nett wäre: weder – noch.
Das ist das Ziel. Oder sollte es zumindest sein. So richtig frei von Vorurteilen kann man sich allerdings nur schwer machen. Das bedeutet immer auch fortwährende Arbeit.
An sich selbst und – mit möglichst nicht zu penetrantem Sendungsbewusstsein – an seinen Mitmenschen.
Da kenn sich einer aus mit den Männern, mit den Frauen, mit den Heteros, mit den Schwulen. Zwischenmenschliches ist ja immer gleich schwierig.
Das wird unser nächstes Thema!
Diese Szene mit Ihrer Mutter Irene kommt mir bekannt vor. Da macht man sich fremde Orte nach und nach durch eigene Rituale zu eigen, lebt sich langsam ein, hat seine Lieblingsorte und Lieblingsbeschäftigungen – und dann kommt auf einmal Familie, Freunde, Kollegen dazu und ’stören‘ quasi den so lieb gewonnenen Tagesablauf. Da fällt mir auch immer wieder auf, dass man dieselbe Stadt mit unterschiedlichen Menschen ganz anders erlebt.
Verliebt ist auch Salzgitter schön, und in unangenehmer Begleitung nutzt selbst Portofino nichts. Die Fage ist immer: Kann ich jemandem/r etwas bieten oder werde ich mir von ihm (ihr) die Laune vermiesen lassen.
Und vielleicht noch: ist man zumindest ungefähr auf der gleichen Wellenlänge.
Das ist Voraussetzung, dachte ich früher. Aber manchmal findet erst allmählich die Angleichung statt, und das kann sehr befriedigend sein.
Stimmt. Manchmal überrascht mich auch mit wem das gelingt und mit wem nicht. Das passiert nämlich oft entgegen meinen ersten Erwartungen.
Paris ist ja eine tolle Stadt, aber ohne Frage eine von denen, die ich im Frühling oder Herbst lieber habe als im heißfeuchten Juli.
Das geht mir bei allen Städten so 😅 Der Sommer macht ja trocken und heiss auch mehr Spaß als schwül und stickig.
Komisch, ich hab‘ schwül ganz gern. ‚Triebtriefend wie Tropennächte‘ schrieb ich mal über Rom im August.