

Paris, Totensonntag ’81
Pali,
nun ist es halb fünf. Mein letzter Tag in Paris, mein letzter Tag ‚unterwegs‘ in diesem Jahr, ist fast vorbei. Allerspätestens in zwei Stunden muss ich das Taxi zum Flugplatz besteigen. Ich sitze in einer Tages-Lederkneipe und genieße die Blödsinnigkeit, zwischen Männern, die hier auf flotte Anmache rumhoffen, zu schreiben. Ich bin in dieser bodenlosen Stimmung, die ich für das Leben halte. Es riecht nach Kerlen. Eine gewisse Verdrossenheit hängt in der Luft, so als hätte jeder schon mit jedem geschlafen. Ich bin auf aufgeraute, wundgehetzte Art glücklich. Das letzte Mal in diesem Jahr. Ich habe vor nichts Angst. Das allein schon ist Euphorie.

Foto: Privatarchiv H. R.
Heute vor einer Woche war ich in Berlin, vor zwei in München in der Türkensauna, vor drei zu Hause, das war ganz fremd. Bill aus Los Angeles war da, vielleicht deshalb. Vor vier in Florenz, nach einer genauso unbändigen Nacht wie der vorigen, vor fünf in Oberbozen. Um diese Zeit spazierten wir gerade über den Friedhof und blickten ins Tal. Vor sechs Wochen lief ich, Arm in Arm, durch Grinzing. Es stürmte draußen und drinnen. Vor sieben Wochen auch Wien, der hübsche Schwarze, Dirigent aus Washington, abends hatte ich plötzlich keine Lust mehr auf ihn und verschwand mit einem fast schon entmutigend riesigen Schwanzträger. Vor acht Wochen waren wir beide zusammen im ‚Châlet Suisse‘ in Berlin, Dorothee saß zufällig mit Breest am Nebentisch, und du fandst mich ihm gegenüber – immerhin auf dem Papier mein Vorgesetzter – liebedienerisch. Ausgerechtet du, der du allen Respektspersonen in die hinteren Innereien krabbelst und das mit der Ausflucht rechtfertigst: „Wenn es um die gute Sache geht, bin ich mir für nichts zu schade!“ Wisse: Ich bin mir nicht mal für eine schlechte Sache zu schade, wenn er es wert ist. Apropos: Vor neun Wochen saß ich mit Helen im Englischen Garten und wir trafen ihren ‚Freund Fritz‘. Anschließend hatte ich so viele Kerle in der Türkensauna, bis der letzte mir plötzlich etwas bedeutete. Ich sah ihn abends wieder, aber da regte mich doch schon ein anderer mehr auf. Vor zehn Wochen war ich in Berlin, in Andreas’ Kneipe, von wo aus ich mit diesem türkischen Tänzer wieder in den Tiergarten gegangen bin. Vor elf Wochen in München …
Sonntage – Sonntage. Einen so sonnigen Totensonntag habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Um mich rum wachsen die Männer.

Foto: Privatarchiv H. R.
Vorige Nacht, bei meinem furchtbaren Husten und Frösteln, ich hätte gar nicht gehen sollen. Aber ich musste. Es war eine solche Orgie, so hingebungsvoll, dass es fast fromm war. Es war unirdisch, und es geht nur, wenn alle das gleiche Geschlecht haben, so dass man nicht unterscheiden muss. Es wies über sich selbst hinaus, alles ganz wirklich und ganz symbolisch. Niedrig und heilig. Als ich auf die (Gott sei Dank warme) Straße trat, war ich so nass, als hätte ich mit Kleidung unter der Dusche gestanden. Mein Haar stand zu Berge, ich fand keine Taxe und musste auch noch zu Fuß gehen. Trotz dieser Nachttour im Feuchten und meiner Poppersgetränktheit ist mein Husten heute fast weg. Diese Chuzpe hat meinen Bronchien offenbar das Röcheln verschlagen. – Gerade eben musste ich unter unsäglichen Umständen exkrementieren. Das Erhabene und das Niedrige liegen ganz nah beieinander, Kneipenklo und Grandhotel-Lavatory tun das nicht. Nun sitz ich wieder in einem dichten Wald von Jeans und Leder. Brauchen Menschen ein Zugehörigkeitsgefühl – von Körpern, Männern, Soldaten, Volksgenossen? Wenn ich bleiben könnte, könnt’ ich sie wieder spüren, noch dichter als so schon: Männer, Körper. Bringt das was? – Vielleicht die Desillusion, die Befreiung. Es gibt keine Befreiung. Reiß meine Sucht nach Männern aus mir raus und mein ganzes Eingeweide ist mit weg! – Sie schwirren um mich, fast wie Fliegen. Manche nobel, viele billig. Es ist meine letzte Reise in diesem Jahr. – Zeit, Bilanz zu ziehen.
Was bin ich? – Sohn einer polnisch-jüdischen Herrenfrau und eines auf Recht und Ordnung bedachten, angepassten Fantasten. Berliner/Schwuler/kaufmännischer Angestellter.
Was will ich? – Spaziergänge in idyllischer Landschaft und perverseste Sauereien. Zusammengehörigkeit, einsame Jagd. Kleine Dörfer, große Städte.
Was bin ich geworden? – Na ja, genau so was eben.
Was soll aus mir werden? – Keine Ahnung. Absolut nicht. Du sagst, mein Theaterstück über die Hausbesetzer-Szene sei ‚eben zu schlecht‘. Ich frage mich, worin ich gut bin. Im Diktieren und im Aufreißen vermutlich. – Auch was.
Unzählige bejeanste Ärsche vor mir wie Petits Fours in der Konditorei. Es ist wie in der katholischen Kirche, früher, als die Liturgie noch in Lateinisch gefeiert wurde, in Helsinki wie in Rio. Alles Männer, alle hier zu Hause, ich nicht, aber irgendwie gehör’ ich zu ihnen, haben wir was gemeinsam. Gemeinschaft der Schwulen. Diese weltweite Ähnlichkeit, die früher die Messe hatte, hat heute nur noch die Schwulenkneipe. Und die Wandlung, dieser Zeugungsakt, der gleichzeitig Geburt ist – das Einzige, was an diesem sonnig-milden Nachmittag an Totensonntag erinnert, ist meine Erinnerung: Die Fickerei, mit der ich ihn begonnen habe, hätte Tote wecken können. – Jetzt liegen die Häuser im Schatten, und der Himmel ist tiefblau. Halb sechs. Ich muss Abschied nehmen: von diesem Lokal, von Paris, von meinem Unterwegssein ’81, von diesem Jahr. Ich will noch einmal hin- und herkreuzen, bevor ich gehe.
Video (Ausschnitt aus ‚Zoo ’81‘ – Teil 1): Privatarchiv H. R.
Drei Stunden später. Sie hat schon gebeten, sich anzuschnallen. Es geht auch ziemlich runter und drückt auf die Ohren. –
Hastig habe ich Paris verlassen. Ich habe mich aus dem Café gestohlen, noch für Roland und meine Eltern eine Kerze in Notre Dame gespendet (je) und bin dann, ziemlich plötzlich, in eine Taxe gestiegen. Koffer raffen im Hotel – und ab! Rasch, fast zu rasch. Aber wie sonst? Vielleicht war es in gewissem Sinne meine schönste Reise in diesem Jahr. Hätte ich zu Fuß zum Flugplatz gehen sollen oder auf Knien rutschen? – Nein. Hastig, wie man sich von einem unvermutet wilden Liebhaber trennt, mit dem man zwar eine Weile Schweigen kann – hinterher –, aber doch nicht plötzlich über Wetter und Beruf reden mag.

Foto: Privatarchiv H. R.
Macht Schwulsein glücklich? Mir sind vorhin im Café, als ich schrieb und wie immer zehn Wahrnehmungen auf einmal hatte, Schrecken und Einsamkeit des Alltäglichen nicht entgangen und die Katastrophen von Langeweile und Überdruss auch nicht. Schwulsein, Judesein, Außenseitersein machen ein bisschen mehr lebendig, und das ist fast dasselbe wie glücklich. Den Schweiß von fremder Haut zu lecken heißt leben, diese kochende Gleichzeitigkeit von Zeugung und Geburt, des Wahns, der Lust, des Wollens, heißt leben – und ein anderes Glück ist mir nicht vorstellbar.
Video (Ausschnitt aus ‚Zwischenraum‘ – Teil 2): Privatarchiv H. R.
Es ruckelt ja wirklich wie toll. Meine Schrift zuckt nicht unter meinen fiebrigen Gedanken, sondern über dem von Turbulenzen geschüttelten Tablett. – Durch die Wolken. Da liegt Hamburg. Die Lichter kommen näher, zum Greifen.
Meine letzte Reise. 1981 beginnt zu erlöschen.
Und ich selbst? – Ich habe mich – außer in meinen ganz persönlichen, leiblichen Dingen – immer noch nicht genug ausgesetzt. Deshalb kann ich zwar gut formulieren, aber nicht gut schreiben. Ich müsste in London, New York oder Paris, das ich innig lieben gelernt habe, leben. Das würde vielleicht helfen. Wir sind gelandet, wir rollen.
Ich hasse es, zurück zu sein.
Zeig diesen Brief Susi besser nicht, sonst wird sie bestimmt in ihrer Meinung bestätigt, mal ein ernstes Wort mit mir reden zu müssen.
Nur – die Ärmste, was soll sie mir sagen, außer, dass es so nicht weitergeht und anders erst recht nicht?
Video (Ausschnitt aus ‚Spiel ’82‘ – Teil 1): Privatarchiv H. R.
Nun sitz’ ich wieder zu Hause an meinem Sekretär. Roland ist nicht da, was auch nicht hilft. Eben hab’ ich noch die Filme in den Briefkasten geworfen. Meine beste Freundin, die mich heute durch Paris begleitet hat – kreuz und quer, sechs Stunden lang –, ruht: die Kamera in ihrer Kammer. Was hatten wir für eine herrliche Zeit! Ich lief, wie üblich, um mein Leben, und sie hielt alles fest für die Ewigkeit. Dieser Rausch, ‚da zu sein‘, diese unauslöschlichen Eindrücke, die ich erlebe und die ich zu hinterlassen hoffe. Ich kenne sie alle, die da stehen und warten, dass etwas passiert. Ich stehe auch, ich warte auch, aber nicht ungeduldig, denn ich weiß: Ich passiere immer.

Foto: Privatarchiv H. R.
Ich bin so erfüllt, dass es mich fast sprengt. Ein euphorischer Schmerz in dieser wunderlichen Mansardenwohnung, die mein Heim ist. Zu Hause bin ich in der feuchten Dunkelheit, dem unbarmherzigen Leuchten, dessen Hoffnung den Gesichtern Konturen und Charakter auf die gespannte Haut malt. Ich könnte heulen vor Glück und Trauer, es war so unerzählbar bewegend. Die weiten Plätze und finsteren Ecken. Dieser helle warme Himmel über der blassen Stadt, ein welker Frühling, so lebensfroh im Erlöschen. Roland denkt, ich komme erst morgen. Ich bin einen Tag eher gefahren, als mein Reiseantrag vorschreibt. Instinkt. Ich habe den Hamburger Taxifahrer gehasst, weil er meine Sprache spricht und den krausköpfigen Taxifahrer zwei Stunden zuvor, mit dem keine Verständigung in Worten möglich war, geliebt. Ich habe die ganze Strecke vom Flugplatz hierher in ihrer kotzerregenden Geläufigkeit gehasst. – Ich könnte noch in Paris sein, aufgebracht, außer mir. Ich bin es nicht. Instinkt. In der dritten Nacht kann man nicht wieder wie in erster törichter Vergafftheit nur Körper berühren, sondern man muss darüber hinaus auch die Einsamkeiten und die Menschen begreifen. Man kann nicht noch einmal in Gesichtern baden, ohne den Grund zu suchen. Ich lese Gesichter besser als Druckbuchstaben. Aber in der dritten Nacht darf man nicht mehr buchstabieren: Man muss zuhören. Das will ich nicht. Denn ich werde eins nicht nur mit meiner Sprache, sondern auch mit der des anderen. Ich wachse hinein in dieses Gesicht, das zu mir spricht. Das wollte ich nicht. Ich wollte Paris unverwundet verlassen und verlasse es – verwundet?
Instinkt! Wahrscheinlich.
Lieber heute Abend, spätabends, unglücklich in Hamburg, obwohl ich in Paris glücklich wäre, als Paris morgen Abend unglücklich verlassen. – Denn wie den Überschwang hinüberretten auf einen vierten Tag? So etwas muss umkippen, wenn es zu solcher Begrenzung verurteilt ist. Instinkt? Ich habe mich verkalkuliert. Ich wollte Paris enthusiastisch verlassen ohne den schalen Nachgeschmack einer überdrehten Nacht. Ich habe Paris mit einer nicht voraussehbaren Sehnsucht verlassen, einer Sehnsucht, die mich hilflos und schweben macht. Zwei Filme sind angekommen, ich hab’ sie zur Seite gelegt. Unwichtig. – Wenn ich so in den Spiegel sehe, der über meinem Sekretär hängt (tuntig und idiotisch), verstehe ich das ein bisschen: Ich würde da auch anspringen. Es kommen nur die, die Angst mögen. Die, die das Vergessen hassen und lieber an der Erinnerung leiden. Ob sie es nun wissen oder nicht.

Foto: Privatarchiv H. R.
Wenn man in Eutin lebt und plötzlich entdeckt man einen Schwulen, wird man sicher fast verrückt vor Aufregung. Aber wie verrückt vor Aufregung soll man werden, wenn man in Paris in einen Raum tritt und man sieht lauter Menschen, mindestens sechs oder acht, so, dass man glaubt, man könnte sofort über sie herfallen oder über sie schreiben, dicke Bücher mit zitternder Feder? Ihr Leid und ihr Trotz sind einem so vertraut, und ihr Lächeln auch. Und man weiß nicht, welchen. Wer ist die Fälschung? Und welche Fälschung ist echter als die Wahrheit? Es sind ja sechs oder acht. Und es wäre eine Hilfe, wenn sich fünf oder sieben von selber entzögen. Aber nein. Wohin man die Finger steckt, werden sie gegriffen. Weil jeder weiß, er wird begriffen. Du sagst ja immer, ich interessier’ mich nicht für Menschen. Stimmt das? Es ist für die Welt natürlich von bodenloser Unerheblichkeit, wen ich nun mehr oder weniger goutiere. Darum geht es nicht, nicht mal mir. Worum es geht, ist, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln. Zu den Hilflosen? Den Deutschen? Den Schwulen? Zur Uniform der Bärtchen mit Lederjacke Zutrauen gewinnen und eine Jeans für Gesinnung nehmen? Es gibt so viel Wichtigeres, selbst die Türken sind ein größeres Problem als die Tucken. Nur: Man muss sich entscheiden. Und ich hoffe immer noch, wenn ich meine Richtung erst einmal gefunden habe, dann geht die Neutronenbombe, die mir alle hörig macht, richtig los, und sie zerstört die Häuser und lässt die Menschen leben.

Fotos (4): Privatarchiv H. R.
Ich könnte die Nacht durchschreiben, in schmerzhafter Verzückung, ich könnte mich über die Boulevards und unter die Brücken träumen, diesen Duft im Kopf, wenn Männer zusammen sind und ihr etwas zu wildes Lachen in den Qualm stammeln.
Sag der Personalabteilung Bescheid, sie soll mich entlassen: Ich bin für ein Industrieunternehmen weder tragbar noch erträglich. Ich muss in Paris leben. Wenigstens eine Zeit lang. Ich muss es!
Das mit dem Selbstmord hat übrigens noch etwas Zeit. Das Leben tut zu weh, um es aufzugeben.
Dass Roland immer noch nicht da ist, gibt mir zu denken. Es ist wie im Himmel: Alle, an denen man hängt, sind gerade woanders eingeteilt. Chöre und Glückseligkeit. Totensonntag ’81, Hamburg.
Video (Ausschnitt aus ‚Zoo ’81‘ – Teil 1): Privatarchiv H. R. | Titelbild: Rita Chou/Unsplash













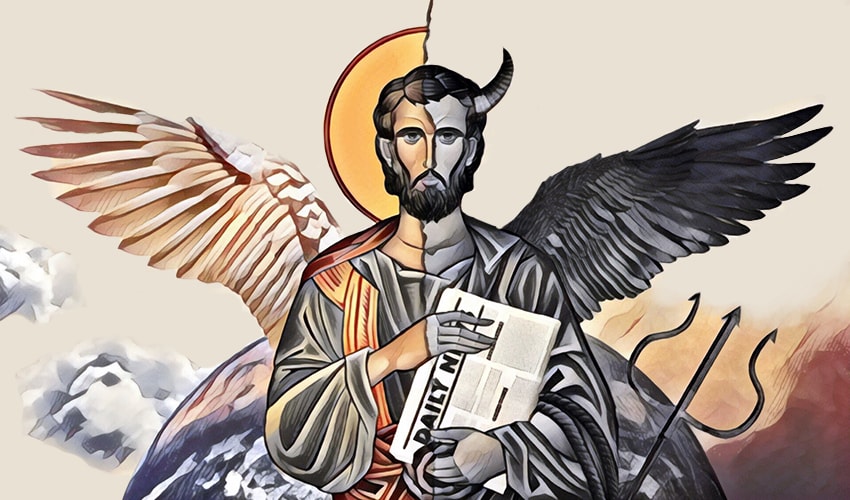





















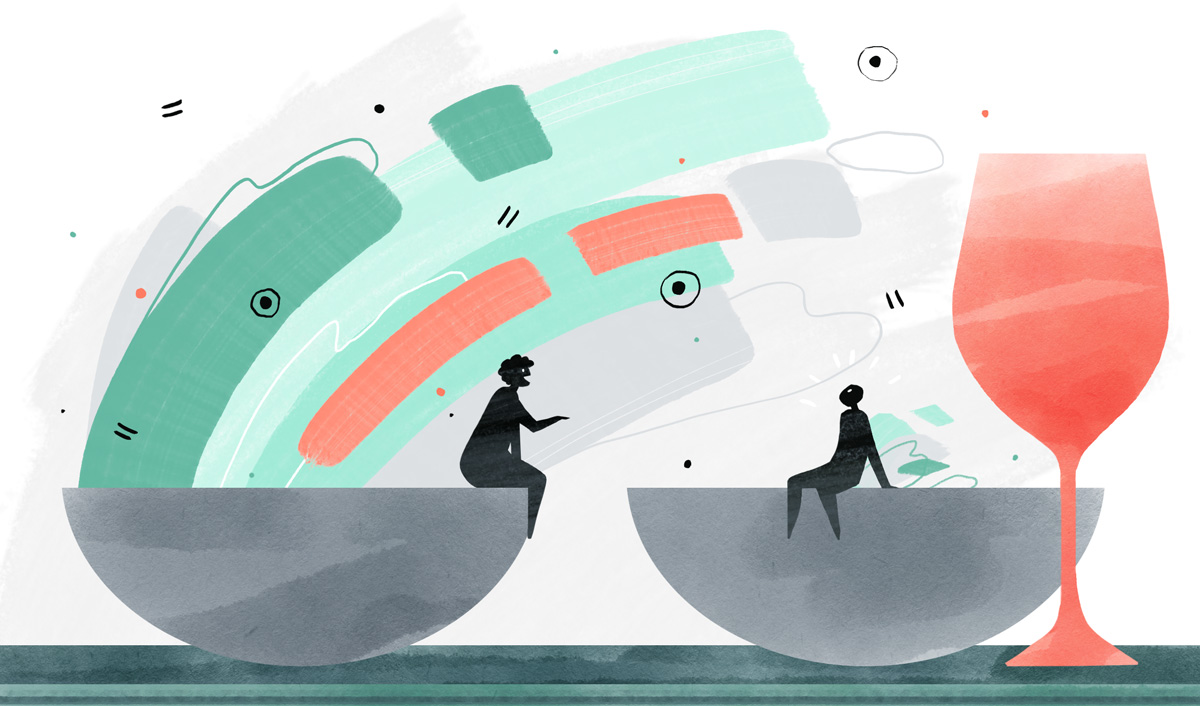



























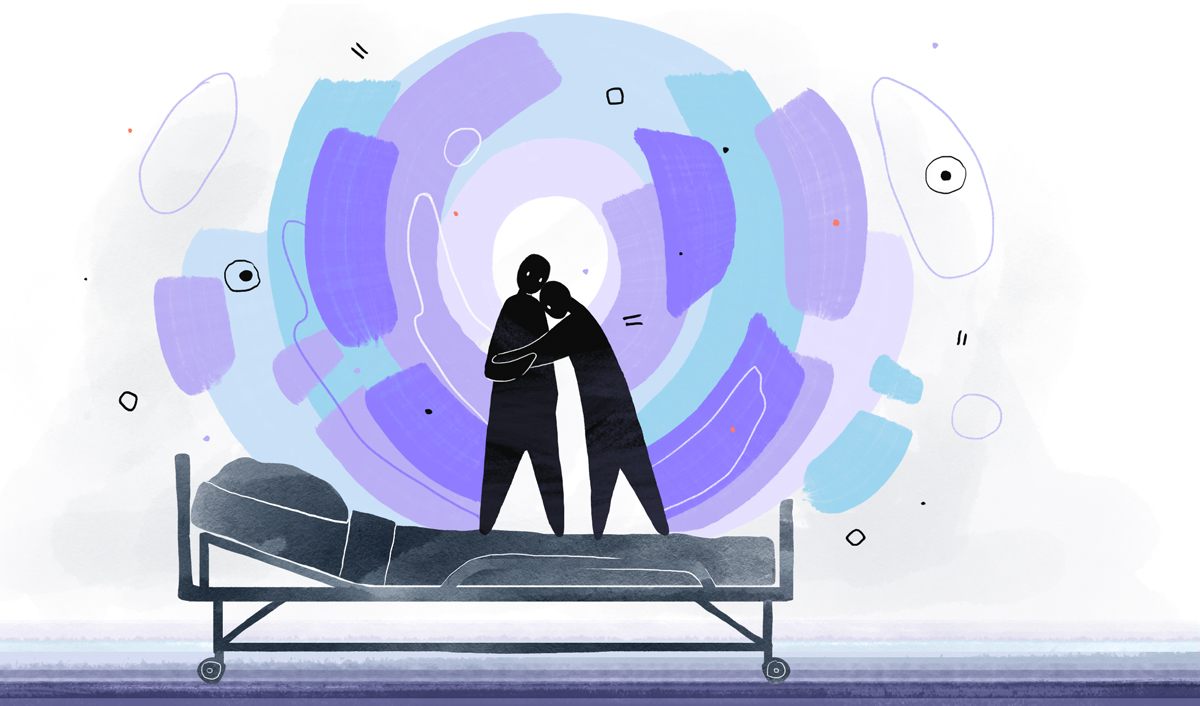




So sonnig sieht der Sonntag gar nicht aus. Jedenfalls nicht auf den Paris-Fotos, aber das kann natürlich auch Stilmittel sein.
Wie ich im Video sage: ein lichter Sonntag. Helle Schleier. Fettlinse vor der Kamera.
Ich wusste bis gerade eben gar nicht, dass heute Totensonntag ist. Und ich habe auch vor ein paar Minuten erfahren, dass man ihn auch Ewigkeitssonntag nennt. Eigentlich viel schöner.
Am Totensonntag 1981 geschrieben, am fünften Fastensonntag 2021 veröffentlicht
Und am UNESCO-Welttag der Poesie!
Charlotte Roche hätte sicher nichts dagegen gehabt, ökonomischerweise die Poesie bereits am 2. Feburuar mit dem Tag der Feuchtgebiete zu verbinden.
Der ist ja auch erst am 21. November 😉
Knapp daneben liebe Daniela Theisen. Falls Sie nochmal im Liturgischen Kalender nachlesen möchten: https://www.stundenbuch-online.de/instrumenta/kalender-2021.pdf
Schwulsein mach nicht glücklich, hetero und weiss sein ebenso wenig. Afroamerikaner und Afrodeutsche haben es schwerer, weil sie einer Minderheit angehören. Unglücklich macht in dem Fall aber eher der Umgang mit anderen Menschen, nicht die Ethnie selbst. Manche macht die Religion glücklich, andere macht sie unglücklich.
Schön, wenn heute viele Minderheiten anerkannt werden. Aber es geht auch etwas verloren. Um Anerkennung zu kämpfen, füllt manche Menschen mehr aus, als anerkannt zu sein. „Wollen ist seliger denn Haben“ (von mir erfundener Kalenderspruch).
Da mag tatsächlich etwas dran sein. Für einen Kalender reicht es natürlich allemal 😉
Exzess in der Geschichte sowie im Schreiben. So jung müsste man nochmal sein!
Im nächsten Leben. Wenn man kann, kann man es glauben.
Da muss dann aber wirklich das nächste Leben herhalten. Im Himmel ist ja eher Ruhe und Frieden anstatt Exzess und Rausch angesagt.
Um Ruhe und Frieden bis in alle Ewigkeit genießen zu können, müssen die alten, weißen Männer erst einer Gehirnwäsche unterzogen werden, und, ätsch, ihre Gattinnen und Töchter gleich mit.
Man merkt geradezu wie diese Stadt Sie damals energetisiert hat. Toll, wenn man solche Erfahrungen im Leben hat auf die man auch Jahre später noch zurückgreifen kann.
Filmen und Schreiben hilft dabei, die Erinnerung zu verwahren und von Zeit zu Zeit an ihr zu naschen…
Ich finde es ja auch immer wieder großzügig, dass Sie all diese Erinnerungen mit uns teilen. Sicher ist das nicht ganz selbstlos, aber nichts desto trotz, es gibt doch nichts spannenderes als über Menschen und deren Erlebnisse zu lesen.
Das freut mich. Natürlich ist das von mir nicht Eitelkeit, sondern Altruismus! Aber manchmal hilft Lesen ja tatsächlich.
Alles vergeht – und doch jede Begegnung bei Nacht für die Ewigkeit hin interpretieren!
Gut, das zu können.
Diese kurzen Momente, in denen man vor nichts Angst hat, einfach nur das Leben genießt, die sind doch unglaublich wertvoll. Davon zehrt man dann immer eine ganze Weile.
Wenn dieses Gefühl zu lange anhält verliert man manchmal den Bezug zur Realität, aber als temporäres Erlebnis ist so etwas natürlich toll.
Meistens meldet sich die Realität ja recht streng zurück. Aber man darf sie weder ausblenden noch herbeifürchten.
Dieser andauernde Halb-Lockdown und das damit verbundene Zuhausesitzen, ist das nun Realität oder eine überlange Pause von der Realität?
Das ist ganz eindeutig die augenblickliche Realität, die von der Situation vor zwei Jahren stark abweicht. Möge Gott oder die zuständige Instanz uns von Mutationen verschonen, die aus der Realität eine Regel macht.
Und es wird auch noch eine ganze Weile unsere Realität bleiben.
Die Fickerei hätte Tote wecken können. Hahaha, Herr Rinke, Sie haben mich sehr amüsiert.
Manchmal zaudere ich etwas, aber dann lasse ich es doch so stehen, wie es vor 40 Jahren geschrieben wurde.
Es ist immerhin entwaffnend ehrlich
Wenn aus Sehnsucht Sucht wird – dieser Wortzusammenhang ist manchmal wirklich enger als man auf den ersten Blick meinen würde. Das ist ja quasi eine Sucht nach Leben.
Ja, so sehe ich das. Es freut mich immer, wenn ich auch Kommentare zu den Videos erhalte.
ich habe noch eines. was macht eigentlich grace heute? mir fällt immer wieder auf wie brav und langweilig pop momentan ist. für alle eskapaden und extreme gibt es apps und plattformen, aber der mainstream-pop ist trotzdem langweilig wie selten.
Neulich habe ich Grace Jones im Fernsehen gesehen. Immer noch toll. Ich habe mal meine Pop-Biographie geschrieben und dj-mäßig geschnitten. Meine Agentur hat dazu ein Pobcast vorbereitet, aber mir fehlt das Vertrauen in ein Publikums-Interesse. Im Lesesaal des Blogs gibt es unter ‚Liedschatten‘ ein pdf dazu.
Tambáh kennt nicht mal Google. Außer eben in besagtem Lied. Ein Rätsel.
Tambah heißt auf Indonesisch ‚mehr‘ und ‚Nachschub‘. Ich erlaube mir, das für eine zufällige Buchstaben-Gleichheit zu halten. Obwohl: Rumba-Nachschub war ab 1930 sehr beliebt.
In Deutschland verboten die Nazis sie als entartet, was für sie spricht. Für die Rumba, mein ich.
Grace Jones ist für mich immer eines der besten Beispiele, wie man auch nach vielen Jahren noch relevant und sich dabei gleichzeitig treu bleiben kann. Davon könnte sich jemand wie Madonna eine Scheibe abschneiden.