
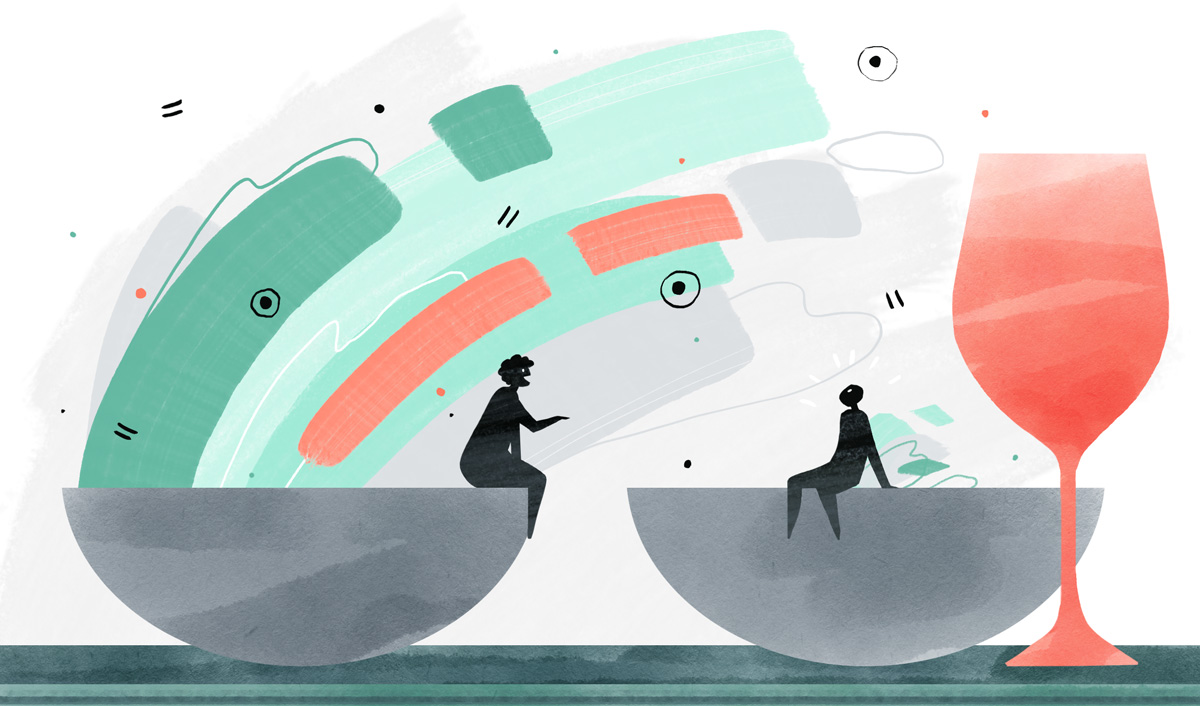


GOLDENE HOCHZEIT
(Ein Gast: G; seine Tischdame: T)
T: Und Sie sind also Willies Enkel, der Enkel vom wilden Willie? – Kaum zu glauben!
G: Ist er so genannt worden?
T: Ja, so haben wir ihn immer genannt, weil er – also, er war schon ein toller Hecht. Und ein fabelhafter Hockey-Spieler. Spielen Sie auch Hockey?
G: Nein, leider nicht.
T: Was ist denn Ihr Sport?
G: Ach, ich komm’ nicht so viel dazu …
T: So? Schade. – Und Verena ist dann Ihre Großtante?
G: Ja.
T: Mögen Sie sie?
G: Wie meinen Sie das?
T: Na, ob Sie sie mögen.
G: Äh, ja, sehr.
T: Mein Gott, dass wir das je erleben würden!
G: Wieso? War sie so unbeliebt?
T: Was? Ach wo, im Gegenteil! Ich wollte sagen: dass wir je ihre goldene Hochzeit erleben würden! Dass sie das durchhalten würde, hat doch damals niemand geglaubt.
G: Oh, war sie so krank?
T: Aber nein, kerngesund war sie. Deswegen ja gerade. Immer unternehmungslustig und sehr beliebt. Sie hätte alle haben können, fast alle, und die Entscheidung war ihr auch nicht leicht gefallen. Aber na ja. Dann kam der Krieg und dann wurde die Auswahl geringer. Da war es dann einfacher, treu zu bleiben. – Wussten Sie, dass Verena schon mal verlobt gewesen war?
G: Nein, das wusste ich nicht.
T: Ja! Mit einem Halbjuden – oder war es nur ein Viertel? Ich meine, mir ist das egal, aber damals war es nicht egal. Sie wissen vielleicht: Verena und ich waren sehr enge Freundinnen. Eines Tages kam Verena zu mir und sagte: ‚Barbara‘ – das heißt, nein, ‚Babsi‘ wurde ich damals genannt – also: ‚Babsi, meinst du, ich soll mich von Siegfried trennen?‘ – Stellen Sie sich vor, er hieß ausgerechnet Siegfried. Ich fand das einen regelrechten Etikettenschwindel. Ich sagte: ‚Verena. Das musst du selber wissen.‘ Sie nickte, dankte mir für meine Anteilnahme und ging wieder. Am nächsten Tag hat sie die Verlobung gelöst.
G: Was ist aus ihm geworden?
T: Oh, es ging ihm blendend, ganz blendend, bis er dann an Leberzirrhose starb, vom Trinken, verstehen Sie?
G: Ach.
T: Ja. Warum trinkt ein Mensch? Bestimmt nicht, weil er glücklich ist. Ich glaube, er hat Verena nie verwunden. – Sie trinken aber auch ganz schön.
G: Ach, das ist nur, weil ...
T: … weil es immer noch nichts zu essen gibt, wahrscheinlich.
G: Das ist erst mein zweites Glas.
T: Na hören Sie! Sie brauchen sich doch vor mir nicht zu rechtfertigen, Sie sind doch ein erwachsener Mensch.
G: Ich bin Trinken gar nicht gewohnt.
T: So? Was sind denn Ihre Laster, hahaha?
G: Ach, es wird Sie vielleicht enttäuschen, aber ...
T: Nein, sagen Sie nichts! Wir müssen uns ja noch bis zum Nachtisch interessant finden.
G: Oh, ich finde Sie sehr interessant.
T: Ja, ich habe viel erlebt …
G: Und wieso ging es diesem Siegfried so gut, obwohl er doch Halb- oder Viertel-, ich meine, obwohl er jüdischer Abstammung war?
T: Na ja, es ging ihm natürlich erst nach dem Krieg so gut. Vorher hat er sich irgendwie durchgemogelt, aber nach dem Krieg, da war er dann gleich zur Stelle. Er wurde von den Alliierten sofort eingesetzt, als Verwaltungsdirektor oder so was. Dabei hatte er nicht mal das zweite Staatsexamen, das war ja nicht gegangen wegen seiner Herkunft. Na ja, er hat sich natürlich als Nazi-Opfer ausgegeben, und da war er dann angesehen bei denen, obwohl er nicht mal im KZ gewesen war.
G: Also, ich finde ...
T: Jaja, ich weiß schon, ich hab’ mich nicht richtig ausgedrückt. Wissen Sie, in meinem Alter … Aber trotzdem hat sich der Siegfried damals ziemlich unanständig benommen. Verena ging es sehr schlecht, sechsundvierzig. Robert war noch nicht zurück aus der Gefangenschaft, und sie saß da mit den zwei kleinen Kindern. Glauben Sie, der Siegfried hätte ihr geholfen?
G: Ach, sie kannten sich noch?
T: Sicher. Wir lebten doch alle in Fulda, damals.
G: Aber warum sollte er ihr helfen?
T: Na, ich bitte Sie! Schließlich waren sie mal verlobt gewesen. Schön – das Blatt hatte sich gewendet. Aber muss man das die anderen gleich so spüren lassen? Ich hab’ die Nazis nie leiden können. ‚Sieh ihn dir an, diesen Pöbel!‘, hab’ ich immer zu Verena gesagt. Aber trotzdem hab’ ich den Leuten, die dran geglaubt haben, die Hand wieder gereicht, als der Krieg vorbei war.
G: Immer noch gereicht, meinen Sie.
T: Was?
G: Sie hatten doch nie aufgehört, ihnen die Hand zu reichen.
T: Ach, ich bin nicht nachtragend. Mein Gott, wenn ich das wäre, wie sollte ich dann überhaupt leben, nach allem, was ich durchgemacht habe. – Na ja. Sie wissen sicher nicht, dass Verena Robert durch mich kennengelernt hat.
G: Nein! Ich dachte, er war der Freund meines Großvaters.
T: Auch. Aber sie haben sich bei mir zum ersten Mal getroffen, auf meinem einundzwanzigsten Geburtstag. Willie brachte Robert mit. Es war Liebe auf den ersten Blick.
G: Zwischen wem?
T: Zwischen Verena und Robert natürlich. Obwohl er mir auch zugezwinkert hat, ganz am Anfang. Aber Sie wissen ja, wie das ist, als Gastgeberin muss man sich um alle kümmern, Verena kümmerte sich nur noch um Robert.
G: Meinen Sie, dass sonst Sie jetzt goldene Hochzeit feiern würden?
T: I wo! Hahaha. – Gott, wer weiß. Manchmal hängt alles im Leben von solchen Kleinigkeiten ab. Wer begreift schon, was in Sekunden unser Leben bestimmt? Die Sterne, die Chromosomen …
G: Die Chromosomen?
T: Ja, die vor allen Dingen. Ich habe neulich ausführlich darüber gelesen. Die Chromosomen sind dafür verantwortlich, wie Sie werden. Das ist alles vorprogrammiert, sozusagen.
G: Aber doch nicht, was man daraus macht.
T: Ach, ich weiß schon gar nichts mehr. Ich lese diese Dinge, und ich bin froh, dass sie mich nichts mehr angehen. Ich habe meine Fehler gemacht, jetzt mache ich meinen Frieden und kümmere mich um das, wovon ich etwas verstehe: Gartenarbeit, so gut ich das noch kann, Stricken und Kochen.
G: Das klingt sehr abgeklärt.
T: So? Na ja, vielleicht. Aber ich bin immer noch ehrgeizig und neugierig. Die Neugier hält mich am Leben, sag’ ich, und der Ehrgeiz auf den Beinen. Die Rosen, die ich züchte, und die Pullover, die ich stricke, und die Suppe, die ich koche – das soll alles ein bisschen besser sein als der Durchschnitt. Sonst denkt man ja, man tut es nur, um sich zu beschäftigen. – Oh, die Suppe! Endlich! Hat Verena selbst gekocht, hat sie gesagt.
G: Erstaunlich. In ihrem Alter!
T: Wieso? Ich bin genauso alt, und ich koche auch.
G: Aber für so viele, für zwanzig Personen ...
T: Suppe geht, und das andere hat sie kommen lassen. Die Suppe ist übrigens ganz gut, finden Sie nicht?
G: Ja, sehr gut.
T: Sie sind so schweigsam.
G: Oh, ich – Sie reden doch.
T: Ich rede zu viel, das meinen Sie.
G: Ich hör’ Ihnen gern zu.
T: Oder haben Sie was zu verbergen, hahaha. Kommen Sie ans Salz ran? Aber bitte unauffällig, Verena ist immer so empfindlich, sie kann es nicht ausstehen, korrigiert zu werden.
G: Sie kann uns doch gar nicht sehen von ihrem Platz aus.
T: Tja, das ist der Vorteil, wenn man am Katzentisch sitzt.
G: Wieso?
T: Nur so. Sie auch?
G: Äh, was?
T: Salz.
G: Nein, danke, mir reicht es.
T: Soso, Ihnen reicht es.
G: Nein, so hab’ ich das nicht gemeint …
T: Weiß ich doch, weiß ich doch! Aber im Ernst: Eine Suppe verrät mehr als alles andere.
G: Was wollen Sie damit sagen?
T: Nichts Geheimnisvolles, nur dass man an der Suppe die Küche erkennen kann.
G: Die Küche?
T: Ja, an der Suppe erkennt man die Küche, sage ich immer. Ich geh’ in ein Restaurant und bestelle als Erstes eine Suppe, nur eine Suppe. ‚Und was dann?‘, fragt der Kellner. ‚Das weiß ich noch nicht‘, antworte ich ihm. ‚Bringen Sie mir erst die Suppe! Wenn ich die Suppe kenne, kenne ich den Koch.‘
G: Ja, eine Suppe sagt viel.
T: Das war jetzt aber Ihr drittes Glas!
G: Wirklich? Das hab’ ich gar nicht gemerkt.
T: Ich hätte übrigens etwas mehr Fleisch an die Brühe getan.
G: Ja, ich auch.
T: Viel mehr Fleisch. Na ja, im Alter lassen die Sinne nach und der Geiz nimmt zu. Das gilt natürlich auch für mich. Ist das eigentlich Kohlrabi?
G: Es schmeckt so.
T: Dann fehlt auch der Muskat. – Gott, was sind wir schrecklich! Die ganze Zeit kritisieren wir nur das Essen, als ob es nichts Wichtigeres gäbe, dabei hat sich Verena solche Mühe gegeben, ich meine ja auch nur ganz wenig Muskat, eine Prise, aber das ist natürlich Geschmacksache wie alles im Leben, hahaha.
G: Mir schmeckt es sehr gut.
T: Verstehen Sie denn etwas vom Essen?
G: Na ja, also, ich esse ziemlich regelmäßig.
T: Ich meine natürlich vom Kochen.
G: Ja, ein bisschen.
T: Kochen Sie selbst?
G: Ja, ich koche auch.
T: Da hat es Ihre Frau aber gut.
G: Hm.
T: Oder ist sie eifersüchtig auf Ihre Künste?
G: Ich, äh, ich bin gar nicht verheiratet.
T: Dann leben Sie also noch à la carte, wie mein Mann sagen würde. Na ja, heute ist das ja ganz normal. Man heiratet erst, nachdem man sich ‚selbstverwirklicht’ hat. Hahaha. ‚Die Hörner abstoßen‘, nannten wir das früher. – Aber Ihre Frau kann später mal froh sein: ein Mann, der kocht.
G: Das ist doch heute nichts Besonderes mehr.
T: Nein, nein, Sie haben recht, Genauso wenig wie spät heiraten. Es ist nur so schade wegen der Kinder.
G: Was für Kinder?
T: Na ja, wenn Sie dann schon älter sind, ist das ein Problem, find’ ich.
G: Ich verstehe Sie nicht.
T: Ja, wollen Sie denn keine Kinder haben, später?
G: Ich, äh, ich glaube, nicht. Kinder liegen mir nicht so.
T: Mein Gott, wie Sie schwitzen!
G: Die Suppe ist sehr heiß.
T: Mögen Sie Kinder nicht? Ist das der Grund, warum Sie nicht heiraten?
G: Verzeihung, Sie haben mich missverstanden. Ich habe wohl schon etwas viel Wein, äh ... Natürlich mag ich Kinder.
T: Natürlich ist nichts. Meine Nichte hat drei und sie kann sie nicht ausstehen. Sie bestreitet das zwar, aber ich seh’ doch, wie sie mit ihnen umgeht. Abends spät sind die Kinder noch auf, zu essen gibt es irgendwann. Grässlich, solche Lieblosigkeit. Und schreien tun diese Gören, schreien! Kein Wunder bei der Erziehung, aber es ist nicht auszuhalten.
G: Wissen Sie, ich bin Lehrer. Also Kinder hab’ ich genug um mich.
T: Das ist doch nicht dasselbe. Wollen Sie keine eigenen Kinder haben? Als Lehrer dürfen Sie doch ein Kind heutzutage nicht mal mehr ohrfeigen, wie soll man ihnen denn da etwas beibringen?
G: Also ich sehe das anders.
T: Ach, gehören Sie zu denen, die meinen, Sie dürften in die heutige Welt keine Kinder setzen? Das ist doch bloß Flucht vor der Verantwortung. Wie sah denn die Welt aus, als ich meine Kinder bekam? Ein Chaos, noch schlimmer als jetzt.
G: Verstehen Sie doch, ich habe gar nichts gegen die Familie, gegen Kinder und ...
T: Wie bitte? Das wäre ja auch noch schöner! Was sollten Sie denn gegen die Familie haben? Sie sind doch Beamter. Die Familie ist die Keimzelle unseres Staates.
G: Nicht nur deshalb.
T: Unsere Jugend mag sein, wie sie will, aber ohne sie wären Sie arbeitslos.
G: Wie viele andere Lehrer.
T: Verzeihen Sie! Ich bin unmöglich. Ich bin zu viel allein, und wenn ich unter Menschen komme, werde ich heftig. Statt Sie in Ruhe Ihre Kohlrabi-Suppe essen zu lassen, setze ich Ihnen zu mit meinen altmodischen Ansichten.
G: O nein! Es ist sehr interessant für mich. – Sie haben sicher sehr niedliche Kinder, äh, Enkelkinder.
T: ‚Niedlich?’ Jetzt fangen Sie an, altmodisch zu werden.
G: Also dann: super Kinder oder …
T: ‚Super‘? Haha, das ist das passende Wort! Ja, es sind schon zwei prächtige Burschen. Mein Mann vergöttert sie mehr als damals seine eigenen. Ich glaube, selbst Sie würden sie mögen, die Jungen.
G: Hm.
T: Doch, doch, doch! Da würden Sie schwach werden.
G: Schwach werden? Wie meinen Sie das?
T: Mein Gott, wie man das so sagt. Ich hab’ nichts Bestimmtes gemeint. Was starren Sie mich denn so an, als ob ich Ihnen unterstellen wollte, dass Sie ...
G: … dass ich was?!
T: Sie sind noch sehr jung.
G: Wer, ich?
T: Die Buben, meine Enkel, mein’ ich, sie gehen noch zur Schule.
G: Ich auch! Aber ich habe noch nie … wie können Sie nur so etwas denken! Ich und Kinder! Also, dass Sie es wissen: Wir leben sehr glücklich zusammen, auch ohne Ehe, auch ohne dass wir, na ja, eben auch ohne ...
T: Trauschein? ‚Ohne Trauschein‘ wollten Sie sagen?
G: Äh, ja, gewissermaßen …
T: Also, das finde ich, ehrlich gesagt, sehr rücksichtslos, besonders, wenn später doch mal ein Kind kommt. Oder werden Sie wenigstens dann heiraten? – Aber das geht mich ja nichts an!
G: Sie missverstehen mich die ganze Zeit. Wir leben sehr glücklich auch ohne Kinder, hatte ich sagen wollen, es kam mir nur irgendwie komisch vor, und da, äh, brachte ich es nicht recht über die Lippen.
T: Oh, können Sie keine – sind Ihnen Kinder versagt? Verzeihen Sie, das ist mir jetzt wirklich peinlich.
G: Aber wir wollen doch gar keine Kinder!
T: Ist Ihnen nicht wohl?
G: Nein! Doch! Ich meine, ewig das mit den Kindern.
T: Regen Sie sich nicht auf! Was haben Sie denn?
G: Also gut! Die Sache ist so, ich, äh, ich lebe mit einem Freund zusammen.
T: Sie meinen …
G: Ja.
T: Oh. – Und Sie sind Lehrer?
G: Ja, aber mein Freund ist älter als ich, obwohl er jünger aussieht.
T: Das ist alles ein Missverständnis …
G: Ich hoffe, Sie sind nicht schockiert.
T: Nein, nein. Was frag’ ich auch so dumm.
G: Es tut mir leid, wenn ich Sie jetzt in Verlegenheit gebracht habe.
T: Aber das macht doch nichts! Wirklich, es ist nicht der Rede wert. Ich hatte doch nur fragen wollen, ob Sie selber auch Kinder, äh, aber das ist nun natürlich …
G: Also, wenn es Sie interessiert, Kinder nicht direkt, aber eine Katze haben wir, eine – wir haben, genauer gesagt, eine Siamkatze. Sie heißt, äh, Apollo, heißt er.
T: Apollo! Was für ein schönes Tier, ich wollte sagen, was für ein schöner Name! Gott, war die Suppe heiß, meine Zunge ist ganz taub! Ich meine, ich muss das klarstellen. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich hätte etwas dagegen, dass Sie – ich meine, überhaupt nicht. Das muss ja jeder selber wissen, nicht wahr? Ich reiche jedem die Hand, wirklich jedem. Außerdem: Ich habe einen Neffen, das heißt, eigentlich ist er, äh, ein Neffe zweiten Grades, und der ist auch – na ja – so. Aber hochmusikalisch!
Weiterlesen
VOKABELN
nor|mal
[nɔrˈmaːl], Adjektiv
Bezeichnung für alles, was weder super noch scheiße ist. In diesem Lehrgang wird das Wort ‚normal‘ bisweilen noch wie im vorigen Jahrhundert verwendet, um nicht ständig das von Identitätspolitisierten als diskriminierend eingestufte Wort ‚Hete‘ auf Unschwule anwenden zu müssen.
su|per
[ˈzuːpɐ], Adjektiv
Modische Vorsilbe, um ganz normales Verhalten hochzustilisieren. In diesem Lehrgang wird nichts als ‚super‘ bezeichnet, nicht mal das Coming-out als gekonnte Möglichkeit, Schlagzeilen zu produzieren.
Miss|ver|ständ|nis
[ˈmɪsfɛɐ̯ˌʃtɛntnɪs], Substantiv, Neutrum
Die Folge einer Zusammenkunft von zwei Menschen, die sich selbst für ganz normal und ihr Gegenüber für ‚einfach super‘ halten.
Ver|le|gen|heit
[fɛɐ̯ˈleːɡn̩haɪ̯t ], Substantiv, feminin
Die Folge aus der späten, aber dennoch tröstlichen Einsicht, dass es umgekehrt ist.
ERLÄUTERUNGEN
Dieser Lehrgang hat es sich weder zur Aufgabe gemacht, Ihnen das Normale zu verekeln, noch will er Ihnen partout das Ausgefallene andienen. Er zeigt Ihnen bloß beides auf, allerdings aus dem subjektiv verengten Blickwinkel pädagogisch nützlicher Vereinfachung. Krass gesagt: Er lügt. Na ja, er übertreibt. Mehr kann er nicht leisten, um für Sie die Wahrheit aus dem Wust von Tatsachen herauszuschälen. Ausgefallen müssen Sie dann selber werden – falls Sie es wollen. Das agile Heer derjenigen, die dieses Ziel bereits erreicht haben, dürfte eine Ermutigung für Sie darstellen. Dabei gilt: Alles Ausgefallene hat, übergeordnet betrachtet, Verwandtschaft – alles Normale auch. Alltag bleibt Alltag, ob er nun Montag oder Donnerstag heißt. Und Sonntag bleibt Sonntag, im April wie im November. Auf die dennoch bestehenden Unterschiede werden wir hinlänglich eingehen.
Immerhin steht also bereits am Ausgangspunkt dieses Kurses fest, dass alles Normale alltäglich ist, alles Alltägliche in der Form erstarrt und im Inhalt ausblutet, somit zwangsläufig zum Stillstand führt und der Stillstand zum Rückschritt, also zu Abbau und Verfall. Wer will das schon?
Na ja, wenn es so einfach wäre, dann wäre dieser Lehrgang unnütz. Er ist es aber nicht, weil es keine These gibt, deren Gegenthese es nicht wert wäre, überprüft zu werden.
Das heißt aber beileibe nicht, dass Sie nicht Mehrheit bleiben sollen. Wovon sollten sich sonst die vielen Minderheiten absetzen? Die Minderheit, um die es hier gehen wird, das sind, dämmert es Ihnen, die homosexuellen Männer. Männer also, die Männer mögen – nicht nur im Gespräch, sondern auch im Bett.
Dieses Buch rechnet nicht damit, dass Sie selbst zu dieser Gruppe von Menschen gehören, oder wenn, dann nur durch Zufall. Sie haben vielmehr keine Vorkenntnisse, sondern – falls Sie männlich sind – allenfalls mal den Mann Ihrer Schwester spontan umarmt, als Ihr Fußballklub ein Unentschieden erzwingen konnte. Anschließend haben Sie sich solcher Ausbrüche aber womöglich gleich etwas geniert. Sehen Sie, altmodische Schwule genierten sich auch immer etwas. Seit urchristlichen Zeiten ließen die Schwulen diesem anerzogenen Unbehagen freien Lauf – aber sich selbst seit einiger Zeit auch: Besser sich offen genieren, als sich getarnt blamieren, erkannten die Gewitzteren unter ihnen und hörten bald sogar auf, sich zu genieren.
Schwule lernten das, weil sie mussten. Sie als Studierender müssen gar nichts. Sie können genauso gut Französisch lernen oder Surfen oder Sanskrit. Sanskrit kann man verlernen, Fahrradfahren nicht, Schwulsein auch nicht. Man muss damit leben wie mit seinen Falten oder ohne seine Haare, bloß, dass es – im Gegensatz zu diesen Beispielen – keine Alterserscheinung ist. Jedes Kapitel wird Ihnen zeigen, dass es lange Zeit bestürzend, hinreißend und lächerlich war, schwul zu sein, und: unübersehbar anders. Denn Schwule waren zwar oft ein wenig verhuscht, aber auch auffällig mit ihrer hübschen, saloppen Kleidung und dem adretten Bärtchen. Nur die einfältigsten Großmütter sahen in solch einem höflichen Jungen den zukünftigen Ehemann ihrer Enkelin. Alle anderen wussten Bescheid, wenn so einer mit flinken, sportlichen Schritten die Auslagen der Boutiquen abhakte.
Schwule demonstrierten, dass sie etwas für sich taten, vor allem äußerlich (auf Kultur kommen wir später), und sie demonstrierten Lebensfreude (auf die kommen wir gleich). Solche Demonstrationen sind genauso verkehrsstörend wie alles andere, was sich auf der Straße bewegt. Doch diese – zunächst noch – protestlose Demonstration musste von Anfang an Passanten, die weder etwas für sich taten noch eine Spur von Lebensfreude zur Schau stellten, ganz besonders verbittern, schon deshalb, weil Schwule als definierte Außenseiter an ihrem eigenen Äußeren gefälligst weniger Sack und dafür mehr Asche zu zeigen gehabt hätten.
Andere Menschen zu verbittern ist peinlich, also genierten sich die Schwulen so durch die Jahrtausende, ohne sich deswegen immer gleich umzuziehen. Sie schämten sich bis in die Siebzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts hinein ihrer Unfähigkeit, Rentenversicherungszahler und Vaterlandsverteidiger lustvoll beizusteuern, aber begannen die Vorteile dieses Mangels zu genießen, und tun es immer noch, so weit es geht.
Was geht denn? Was geht immer noch nicht und, viel wichtiger, wie erkennt man sie überhaupt, damit man an ihnen studieren kann, was noch geht?
Also, Schwule zu zweit sind auch außerhalb von Herrenboutiquen relativ leicht zu erkennen: eben aneinander. Wie aber erkennt man einen Schwulen allein, wenn er sich unter die Menschen gemischt hat? Was ist ausgefallen oder zumindest auffallend an ihm?
In heterogener Gesellschaft gar nichts. Er fällt überhaupt nicht auf, außer denen, die selber schwul sind, denen also nichts vorgemacht werden soll oder kann.
Trotzdem wird es immer den Versteck spielenden Homosexuellen geben, der dem ahnungslosen Gastgeber insgeheim unterstellt, er sei schwulenfeindlich, weil der ihm das Weinglas nicht bis zum Rand vollgegossen hat. Daneben gibt es aber auch den, der weiß, dass alle es wissen und der sich deshalb verpflichtet fühlt, seinem halb amüsierten Publikum immer wieder mal zeigen zu müssen, was eine schwule Harke ist.
Untereinander merken Schwule an der betonten Unauffälligkeit, mit der das offene Hemd zum Halbschuh passt oder die Handbewegung zum Tonfall, was los ist, und reagieren entsprechend, in heterogener Gesellschaft also betont unauffällig, aber doch so, dass sie durchschimmern lassen, ob sie Abneigung verspüren oder nicht abgeneigt wären. So etwas geschieht durch Blickfunk und gehört nicht zum Pensum, weil es nicht zu erlesen, sondern höchstens zu erleben ist. Hat sich aber ein Funker bei der Aussendung solcher Signale geirrt in der Einschätzung seines Gegenübers, dann hat er sich nicht geirrt, sondern der andere ist bloß verklemmt.
In schwuler Gesellschaft fallen Schwule schon gar nicht auf, weil die Gesellschaft ein so juchzender Haufen ist, dass man den Einzelnen darin überhaupt nicht bemerkt, glaubt der Tuntenversteher. Das gilt nicht im ‚Freischütz‘, aber schon im Foyer und erst recht im Freibad.
Damit also zurück zur Lebensfreude! Schwule sind nicht glücklicher, aber sie haben mehr Spaß am Leben – heute. Früher war das schwerer, besonders wenn sie sich gerade im Gefängnis oder auf dem Scheiterhaufen befanden, beides leider Orte, die Staat und Kirche leicht parat hatten für Menschen, die Spaß am Leben zur Schau stellten oder anderweitig aus dem Rahmen fielen. Selbst die, die im Rahmen und unerkannt blieben, fühlten sich fluchbeladen: Im Gefängnis ihrer Triebe oder auf dem Scheiterhaufen ihrer Lüste fristeten sie ein Dasein, das entweder nur ihnen oder nur Gott gefällig sein konnte, meist beiden nicht.
Heute ist das anders. Man heiratet, adoptiert Kinder und lässt sich scheiden. – Normal. Dass allerdings zur Schau gestellte Lebensfreude mit tatsächlicher Lebensfreude nicht viel zu tun haben muss, das gehört bereits zum Pensum der ersten Lektion. Vermutlich dürfte sie auf Basis von Genügsamkeit leichter zu erzeugen sein als durch ein Überangebot an Zutaten, da aber bislang die Lebensfreude noch chemischer Analyse widersteht und somit auch – bisher – nicht eingeimpft werden kann, so verlässt sich der/die Studierende besser auf seinen/ihren Instinkt, wenn er/sie einen hat. Sonst lesen beide weiter.
Natürlich, wer sich in bitterer physischer Not befindet, der müsste diesen Exkurs zynisch und albern finden – aber der liest das sowieso nicht. Und wer sich bloß in psychischer Not befindet, dem ist das zuzumuten.
Betrachten wir also, ohne allzu schlechtes Gewissen, weiterhin zunächst einmal den nicht in Not befindlichen Großstadt-Schwulen und seine Lebensfreude: Zur Schau gestellt ist sie nicht mehr als ein Anspruch, den es zu erfüllen gilt. Doch in dieser Beziehung ist er fleißig: Da wird ausgegangen, nach Sylt gefahren und Konzerte besucht, was das Zeug hält. Daraus entsteht erst einmal ein gewisses Bewusstsein: Ich tue was! Ich erlebe was! Ich mach’ mir Gedanken! Dieses Bewusstsein im Innern schafft, zusammen mit der äußeren Aufmachung (auf die wir selbstverständlich noch ausführlich kommen müssen), ein Klima von Selbstbewusstsein – ganz wichtig als Ausgleich für das blamable, bewundernswerte Außenseitertum! –, und aus Selbstbewusstsein entsteht leicht (Selbst-)Zufriedenheit. (Ungenügsamkeit als Nährboden von Lebenslust kommt auch noch dran.)
Zufriedenheit jedenfalls ist – ohne sie zu ersetzen – für die Lebensfreude ein genauso fruchtbarer Humus wie der Club Méditerranée für die Sinneslust von Heteros oder wie die Schleimhaut für die Vermehrung von Viren. (Auf Krankheiten werden wir übrigens mit keinem Extra-Kapitel kommen. Krankheiten braucht man nicht zu lernen, die kriegt man auch so. Aber wie man sich körperlich und seelisch schützt und mit der Angst zu leben lernt, das ist Lernziel jedes Kapitels.)
Sie merken wohl schon: Schwule reden sich so lange Lebensfreude ein und tun so viel dafür, sie in sich hochzukitzeln, dass am Ende etwas für sie dabei herauskommt, wofür es dann auch im nuancenreichsten Sprachgebrauch kein anderes Wort mehr gibt als ‚Lebensfreude‘. Nicht eine Lebensfreude, die aus permanentem Glücksgefühl entsteht – wer ist so töricht, sich so etwas auch nur zu wünschen? –, sondern eine Lebensfreude, vielleicht sogar ein Lebensernst, zumindest ein Lebensgefühl, das durch ein bewusst gestaltetes Leben hervorgerufen wird. Wurzel dieses Lebensgefühls bleibt meist die Illusion. Ach, wie selten wird Lebensfreude aus der Realität geboren! Meist ist sie in Träume gebettet, und die meisten Schwulen schlafen wenig, aber träumen viel.
Das gilt natürlich besonders für die Gruppe der Ruhelosen, die nur auf den nächsten Sonnabend und den übernächsten Kerl warten. Das Internet beschleunigt Angebot, Verschleiß und Enttäuschung in einem Ausmaß, das sich der heilige Sebastian nicht vorstellen konnte. Diese bei gayParship und ROMEO hyperaktive Gruppe lehrt uns vor allem, wie herb es ist, wenn sich Veranlagung und Umwelt gegen einen verschworen haben. Doch wir werden nicht die Gruppe als Ganzes betrachten, sondern viele Einzelne aus und in dieser Gruppe. Nur vom Einzelnen können wir lernen, denn nur er ist selber lernfähig. Doch dazu braucht er und brauchen wir Training. Was man nicht übt, verlernt man. Diese Binsenweisheit gilt nicht nur für Sprachen und für die Lebensfreude, sondern auch für das Leben selbst.
Und wenn Sie nun sagen: „Na schön, aber dafür brauch’ ich doch die Schwulen nicht zu kennen“, dann lautet die Antwort: „Stimmt! Aber helfen tut es schon.“














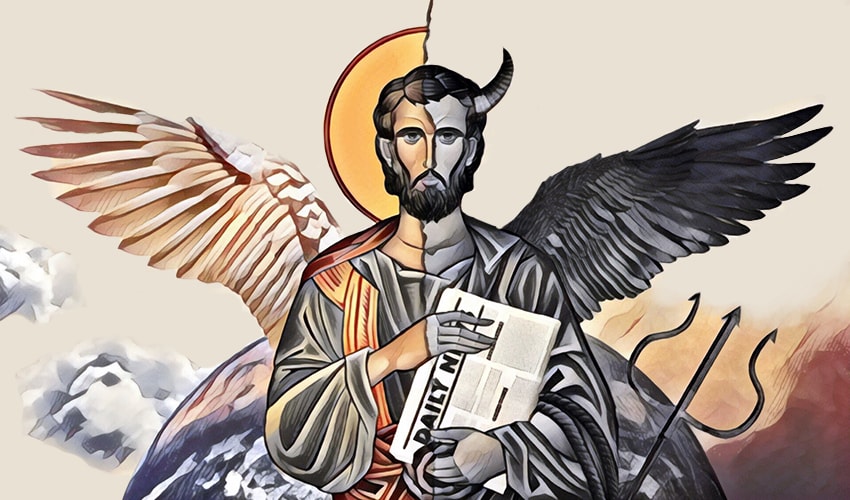

















































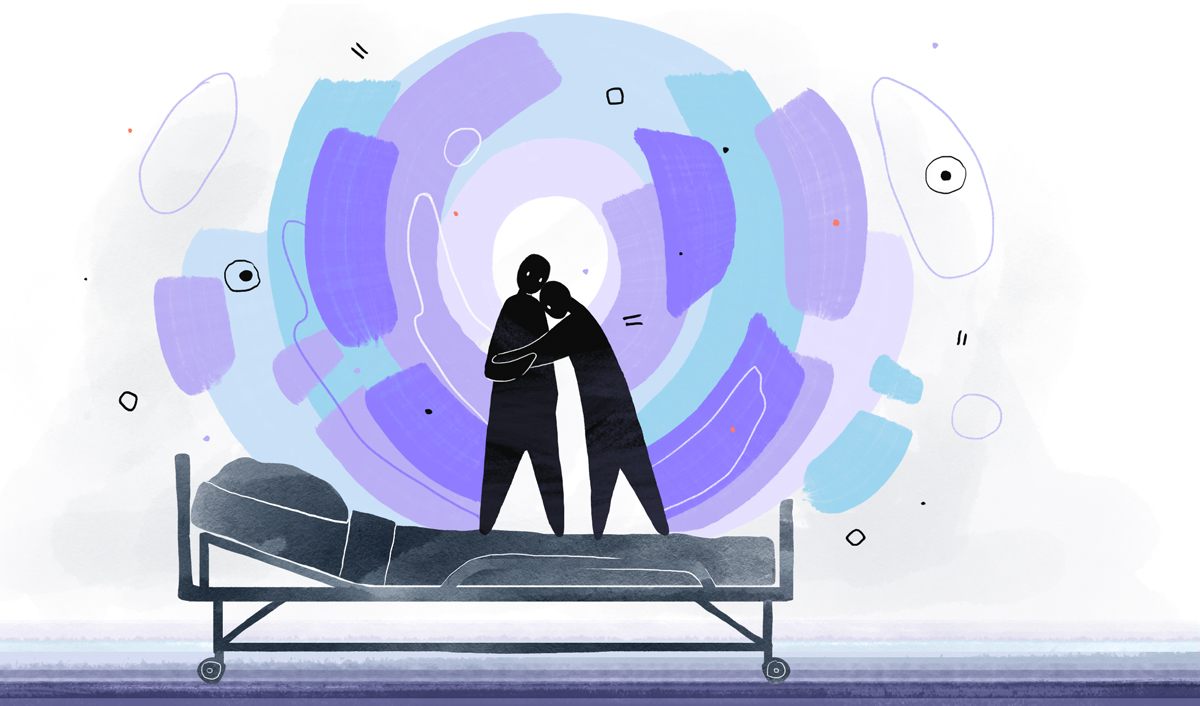




„Ist das eigentlich Kohlrabi? Es schmeckt so. Dann fehlt auch der Muskat.“ Hahaha, Klasse Einstieg!
Der hat mir auch gefallen 😂 Das Warten auf die neue Reihe hat sich jedenfalls gelohnt. Trotz einiger Reihen, die ich bisher von Ihnen gelesen habe, bin ich immer noch überrascht.
Ich habe mich ebenfalls sehr amüsiert. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieser Lehrgang weiterentwickelt.
Ihr gesamter Blog ist ja manchmal schon eine Art Lehrgang über Zwischenmenschliches und das Leben selbst. Aber dieses erste Kapitel fand ich auch außerordentlich witzig. Freue mich auf mehr!
Es bleibt nicht witzig, aber wird es immer wieder.
Über die Dramaturgie braucht man sich ja in der Regel keine großen Sorgen machen. Da wo sie das Leben nicht gleich selbst schreibt, sorgt die Rinksche Erzählweise ja für das Übrige.
„Schwule reden sich so lange Lebensfreude ein und tun so viel dafür, sie in sich hochzukitzeln, dass am Ende etwas für sie dabei herauskommt, wofür es dann auch im nuancenreichsten Sprachgebrauch kein anderes Wort mehr gibt als Lebensfreude“ !!!
Tun wir das nicht alle bis zu einem gewissen Grade?
Manche nur bis zu einem sehr ungewissen Grade.
Wie lernfähig der Einzelne ist, darüber lässt sich sicher streiten. Aber ich schaue mir die von Ihnen präsentierten Exemplare erst einmal weiter an.
Was der Einzelne nicht lernt, lernt die Masse nimmermehr.
Man darf die Hoffnung in die Menschen aber auch nicht aufgeben. Auch wenn es manchmal schwer fällt.
Oha! Selbst für den geübten Rinke-Leser gibt es hier allerhand Neues zu entdecken. Ich lese mich nochmal etwas ein. Die sehr hübsche Aufmachung des Lehrgangs fällt aber auch schon auf den ersten Blick auf.
Das ist mir auch gleich aufgefallen. Aber man ist in letzter zeit ja auch nichts anderes gewöhnt.
Danke! Wir geben uns Mühe: ich mit Briefing, die Grafik mit Talent.
Normal ist die Bezeichnung für alles, was weder super noch scheiße ist. Hanno Rinke, you made my day!
Vokabeln machen die Sprache.
Dieser Vokabel-Abschnitt hat mir auch gefallen. Ich habe nicht nur geschmunzelt, es ist ja zudem auch alles äußerst treffend.
Man heiratet, adoptiert Kinder und lässt sich scheiden. Zumindest da ist die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben komplett vollzogen.
Im demokratischen Westen.
Leider ist das wohl wahr. Man vergisst immer wie gut wir es hier eigentlich schon haben.
Was sind eigentlich Schwule? Ich wüsste ja sofort ein paar Leute, die ich zu diesem Lehrgang mal anmelden sollte.
Haha, ja das könnte nicht schaden.
Schicken Sie diesen Leuten den Link!
Ich bin über Ihren Youtube-Trailer auf diesen Blog bzw. auf diese Lehrgangs-Erzählung gestoßen. Glückwunsch, Sie haben sicherlich einen der interessanteren Literaturblogs, die mir bisher begegnet sind.
Danke! Schön, dass Ihnen des Trailer aufgefallen ist. Heute gilt mehr denn je: Etwas zu machen, reicht nicht. Die, die man erreichen möchte, müssen es auch erfahren.
Den hatte ich auf Instagram auch gesehen. Echt gelungen.
Freut mich sehr! Empfehlen Sie mich weiter, bittet der Animateur. Elfenbeinerner Turm war gestern, heute ist Fernsehturm.
Mein Interesse ist geweckt, mein Humor angesprochen 😉 Schöner Start in das Osterwochenende.
Ostern wird dieses Jahr etwas nachdenklicher. Auch im Blog.
Wie so viele Tage seit dem Ausbruch des Coronavirus. Aber Nachdenklichkeit (in Maßen) kann ja auch nicht schaden.
Und trotzdem: Ein Frohes Osterfest wünsche ich allerseits!
Helfen tut es. Und unterhaltsam wird es wohl auch wieder.
Also wie man sich körperlich und seelisch vor Krankheiten schützt – das Thema könnte ja aktueller gar nicht sein.
Einfältige Großmütter und weitere Verwandte gab es in meiner Jugend auch noch zu genüge. Vielleicht war das aber auch einfach nur ein Verdrängungsmechanismus.
Zynisch und albern fand ich diesen ersten Exkurs schon mal nicht. Im Gegenteil. Aber ich befinde mich trotz Corona auch nicht in Existenznöten. Zum Glück. Es gibt ja genügend traurige Beispiele.