
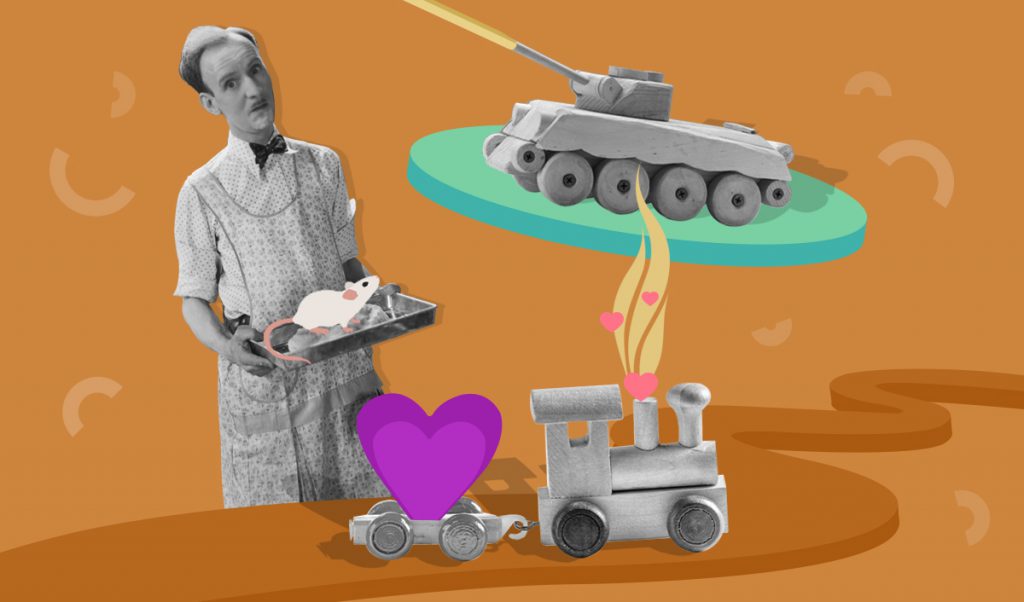

Hier setzt nach zwei Tagen Pause wieder meine eigene Geschichte ein – oder zunächst die Geschichte meiner Mutter. Geboren wurde sie im ‚Storchenhaus‘ Danzig-Langfuhr, das erfuhr ich ziemlich früh und fand den Namen der Klinik für eine Entbindung sehr passend. Allerdings wusste ich nicht, dass diese Bezeichnung auf den Storch aus Eisen auf dem Dachtürmchen des Krankenhauses zurückgeht. Aber vielleicht war der Vogel wegen seines Rufs als Kinderbringer dort angebracht. Das wäre zumindest angebracht gewesen.

Foto: Alexander_P/Shutterstock
Maria Wydoff konnte über die Geburt ihrer Tochter nicht recht froh sein. Sie hatte noch Glück, dass sie diesen Herrn Wydoff aufgetrieben und zur Heirat überredet hatte. Mehr ist über ihn auch nicht bekannt. Er verschwand und meine mutterseitige Maria, die ja denselben abgedroschen-verheißungsvollen Namen vor sich hertrug wie meine väterliche Großmutter, sie war zwar Alleinerziehende, hatte aber kein uneheliches Kind (als ‚Gebärerin‘), sondern ein untergeschobenes (dem Nichtvater). Ohnehin wurde aus meiner mütterlich-mütterlichen Verwandtschaft nur wenig Personal auf die Bühne gelassen, und nicht mal die paar Darsteller garantieren Glaubwürdigkeit:
Eine spanische Tänzerin, die mein polnischer Urururgroßvater aus den Napoleonischen Kriegen mit nach Hause brachte. Die Polen sahen, anders als Preußen und Österreicher, Napoleon als Befreier und folgten ihm 1808 willig in den Krieg auf der Iberischen Halbinsel. Damals waren die Spanier die Ersten, die sich aus der französischen Herrschaft befreiten. Dass einer der polnischen Kämpfer sich eine tanzerprobte Einheimische aus Saragossa nach Warschau mitnahm, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Dass sie eventuell meine Urururgroßmutter wurde, ist mir allerdings nicht wirklich anzusehen.


Fotos (4): gemeinfrei/Wikimedia Commons


Ein russischer Schwarzviehhändler, dessen Berufsbezeichnung meinem Vater sehr gut gefiel. Irena trug Guntrams liebevollen Spott darüber mit Fassung. Schließlich soll seine eigene Mutter Maria, dem Vernehmen nach, in der Brauerei ihres Vaters in Essen bisweilen Bouletten verkauft haben – auch nicht besonders vornehm.
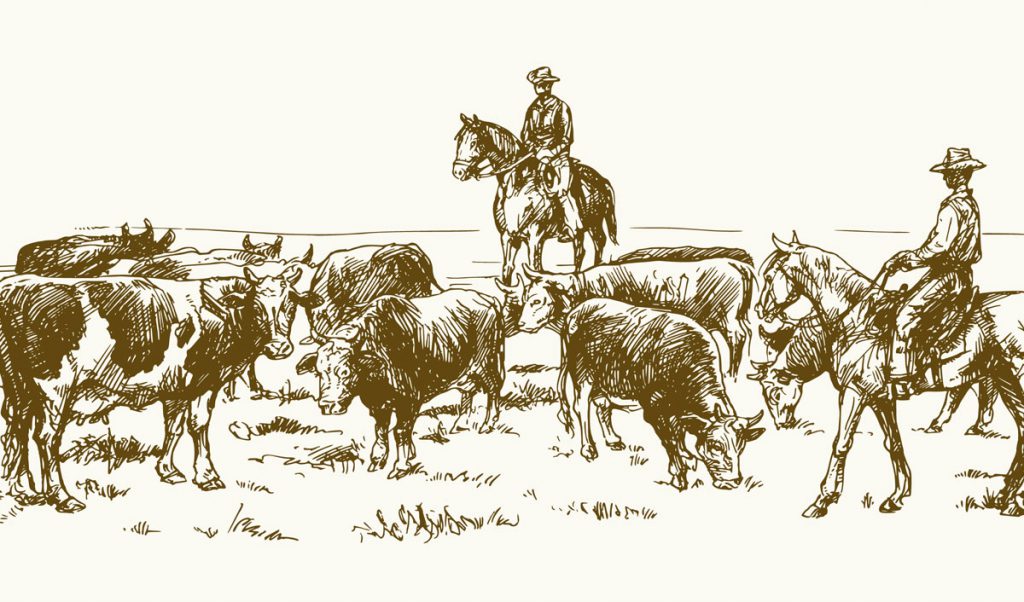
Bild: Canicula/Shutterstock
Eine Bäckerfamilie aus Bromberg, das damals, als die neunjährige Irena dort einige Zeit bei Onkel und Tante verbrachte, Bydgoszcz hieß. Die deutsche Bevölkerung war nach dem Ersten Weltkrieg zur Minderheit geworden: durch Auswanderung und Enteignung. Damals schien das unbedeutend für die kleine ‚Irenka‘. Aber nicht mehr lange. Meine Mutter erzählte immer, wie gutgläubig sie früher war – vielleicht um ihr späteres Misstrauen zu erklären. Zu Kriegsbeginn hatte sie ja noch darauf vertraut, dass die polnische Regierung recht hatte. Nach dem Motto: ‚Deutsche Wehrmachtspanzer sind nur für die Paraden gebastelt worden und bestehen aus Pappmaché.‘ Zehn Jahre zuvor hatte Irena ganz harmlos dem Sonntagnachmittagsbesuch vorgeschwärmt: „In der Backstube ist es lustig. Da laufen immer so kleine Mäuse rum.“ Irena wurde verprügelt und zurück nach Danzig geschickt.

Foto: FooTToo/Shutterstock
In Danzig wuchs Irena innerhalb der polnischen Minderheit auf und hatte Sehnsucht nach Unauffälligkeit. Sie schämte sich ihrer exaltierten Mutter, die nirgendwo unbemerkt blieb. Aber auch Irena war es nicht vergönnt, unscheinbar zu sein – dafür war sie einfach zu groß. Wenn Verwandtschaft kam, hörte sie immer: „Mein Gott, Kind, du bist ja schon wieder gewachsen!“ Das klang in Polnisch sicher nicht weniger vorwurfsvoll.

Fotos (4): Privatarchiv H. R.



Die deutsche Besatzungsmacht kam, als Irina 19 war, und gleich in den ersten Kriegstagen überredete sie ihre zögerliche Mutter zu fliehen. Schnell wurde klar, dass die Polen die Deutschen nicht wie versprochen vertreiben würden. Irenas Mutter zog es bis nach Warschau, das hielt Irena für sinnlos. Sie blieb in Posen. Das war sehr gut, denn der ‚Warthegau‘ wurde Deutschland einverleibt, deshalb waren die Kontrollen in den Zügen von Posen nach Berlin nicht so streng wie vom Generalgouvernement aus. Maria Wydoff hätte 1936 die Chance gehabt, für sich und ihre Tochter einen polnischen Pass zu bekommen, aber sie hatte die Frist dafür verstreichen lassen, so waren beide staatenlos. Irena besorgte sich den Ausweis eines NS-Frauenvereins, mit dem schaffte sie es bis Berlin. „Heute wäre das gar nicht mehr möglich, heute hätten sie mich geschnappt“, mutmaßte sie. Ein SS-Offizier hatte schon Erkundigungen über sie eingezogen.

Fotos (4): Privatarchiv H. R.



In der Höhle des Löwen, in Berlin, würde sie besser untertauchen können, hoffte sie, und außerdem wollte sie versuchen, über die türkische Botschaft nach Istanbul zu kommen. Aus diesem verwegenen Plan wurde aber nichts. Im Zug lernte sie meinen Vater kennen. Auf diese Weise kam sie zu einem unehelichen Kind und ich zu einem gespenstischen, zerbombten Geburtsort. Ich wurde ein Enfant sensible, aber meine Mutter war raus aus dem Osten und somit aus dem Schneider.



Fotos (3): Privatarchiv H. R.
Berlin, das war eine Stadt! Nicht mehr, als ich geboren wurde, aber als sie 1943 kam, standen doch noch recht viele Häuser an den Straßen. Heimatverbundenheit als Kraft und Sehn-Sucht hat mir meine Mutter also logischerweise nicht in die Wiege gelegt. Guntram war damals noch anderweitig verheiratet, was die Sache nicht leichter machte. Aber dann klappte doch alles. Der Krieg war vorbei, Guntrams erste Ehe auch, und für die notgedrungen verspätete Eheschließung meiner Eltern war ich ausgesprochen dankbar, als ich es noch viel später erfuhr. Denn so blieb mir erspart, was damals in gehobenen Kreisen höchst unbeliebt war: Kind einer alleinerziehenden Mutter zu sein. Na, als abwägender Nachwuchs hätte man Frau Wydoff ‚senia‘ wohl sowieso nicht freiwillig als Be‚treu‘erin gewählt, wenn man denn die Wahl gehabt hätte. Hatte man wohl nicht, bevor der Storch einen geholt hat. Aber, hol’s der Teufel! Womöglich hat man sich, um sich zu erproben, vor der Menschwerdung solch eine besonders schwere Aufgabe gestellt. So wie Jesus. Es sei denn, der experimentierfreudige Gott war’s selber, der einen in die Wüste oder ins Eis geschickt hat. Ich jedenfalls konnte mich über mein Umfeld nicht beklagen, über meinen Charakter schon eher. Da hatte es Irena deutlich schwerer. Schon, dass ich sie später manchmal aus Schabernack in der Fräulein-Form als ‚Wydoffuwna‘ bezeichnete, gehörte nicht zu ihren Lieblingsscherzen.





Fotos (5): Privatarchiv H. R. | Titelillustration mit Bildern von Shutterstock: Everett Collection, A7880S, pim pic, Merkushev Vasiliy

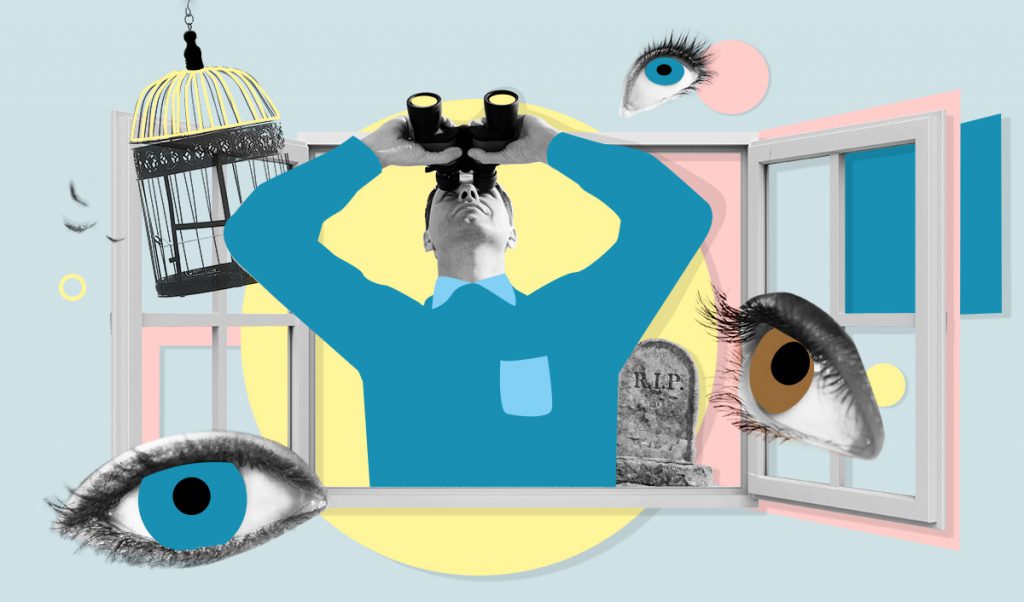


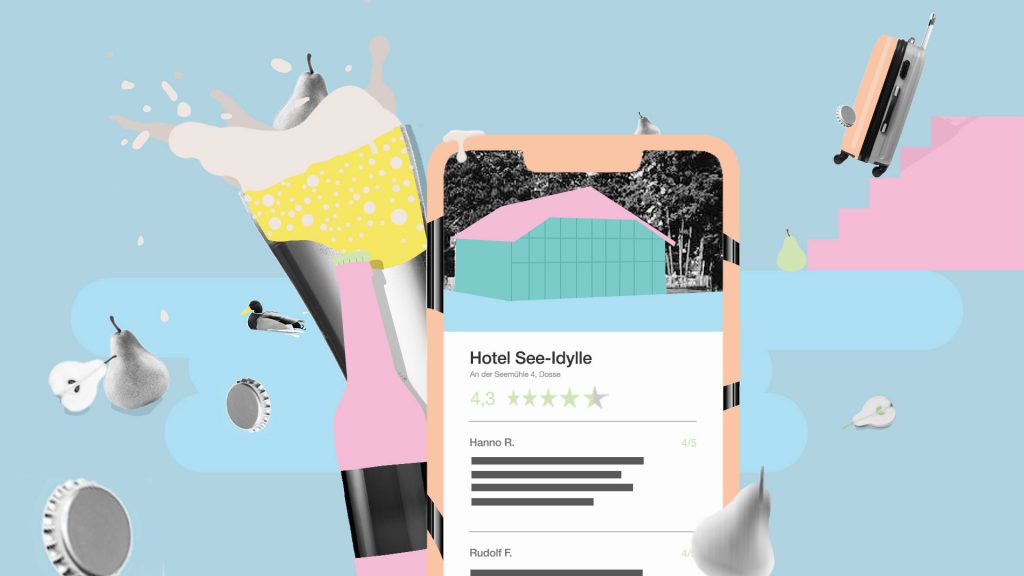



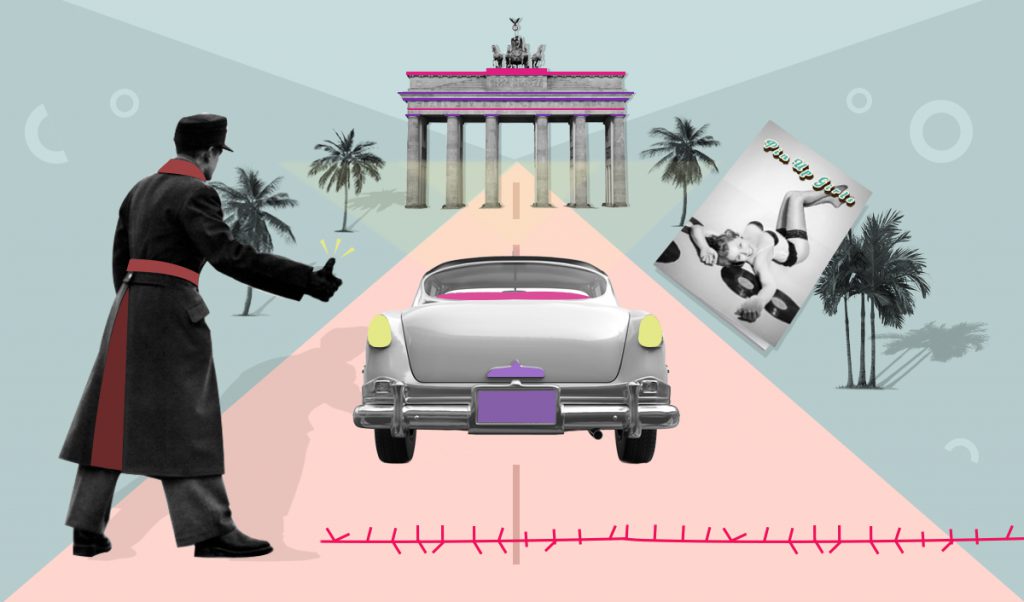
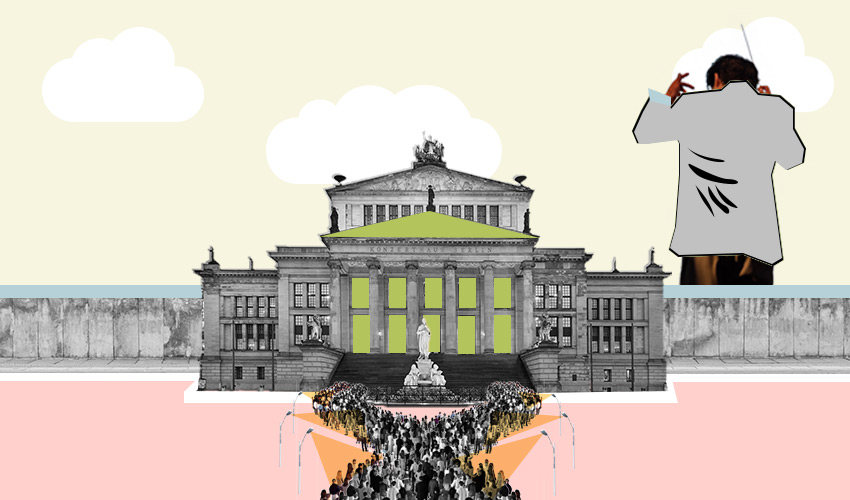

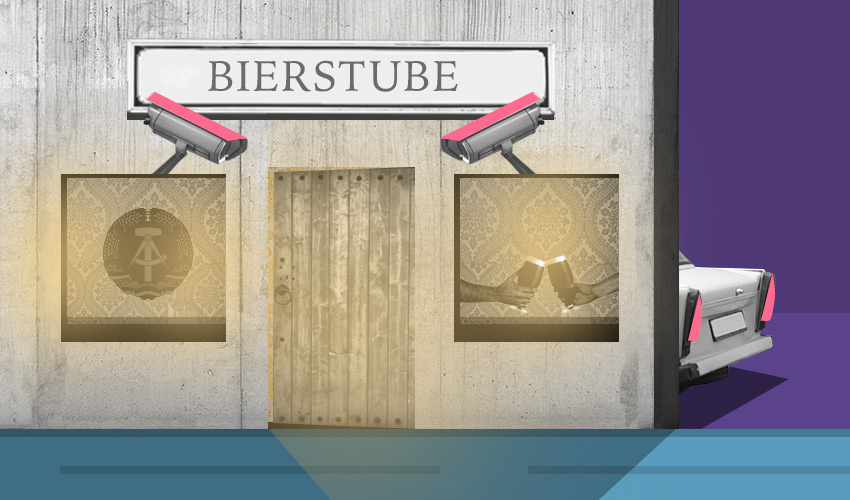













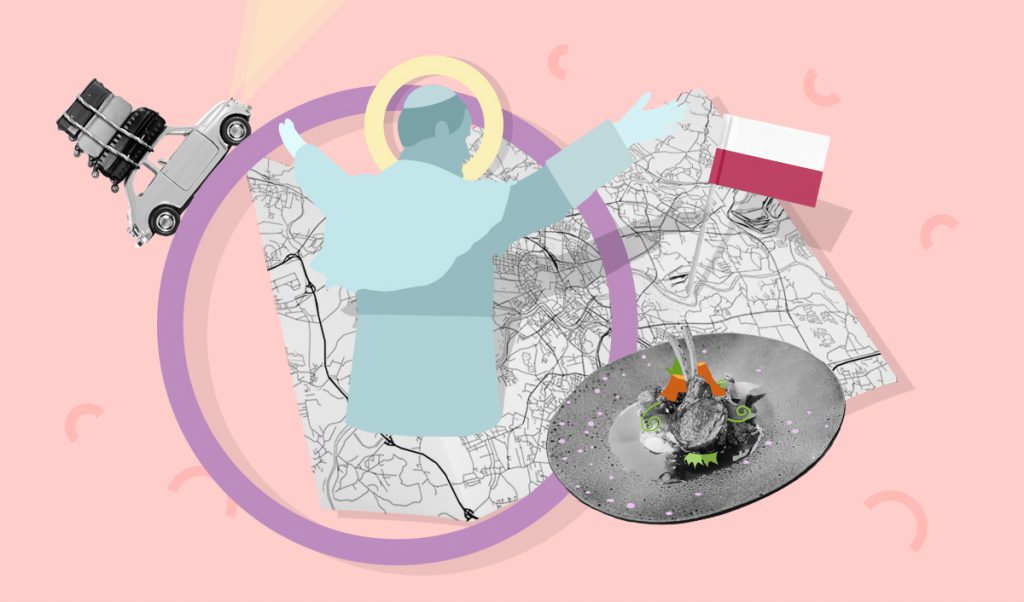

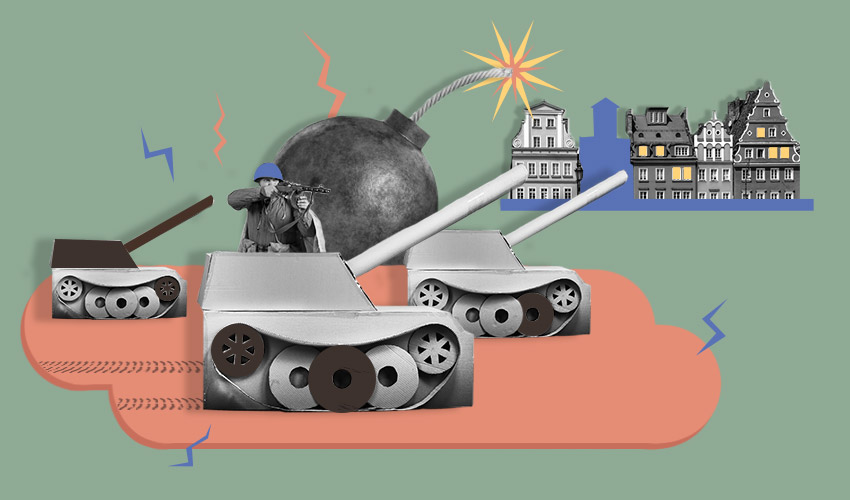





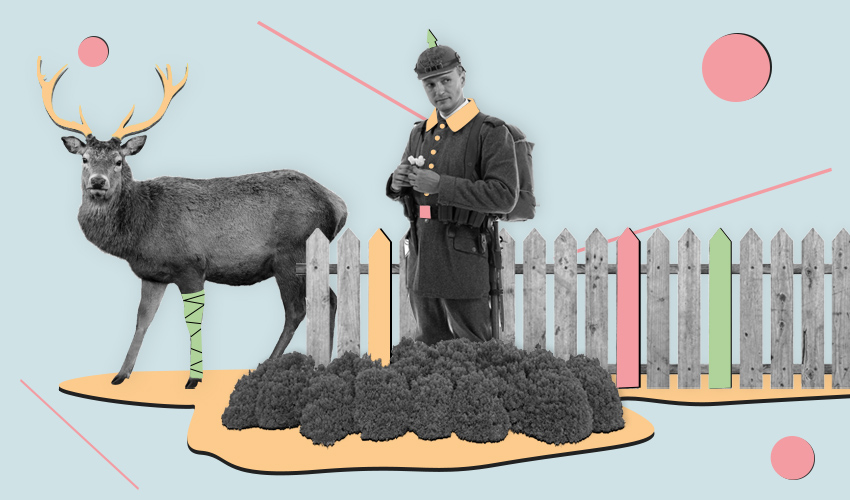







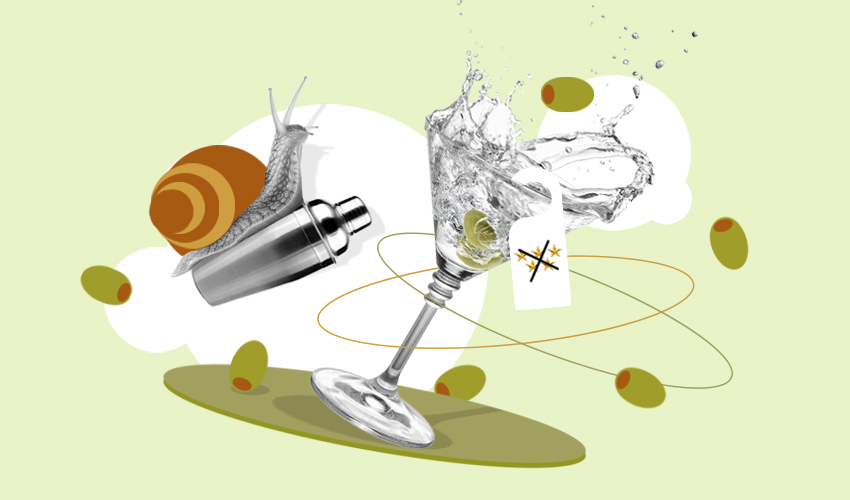





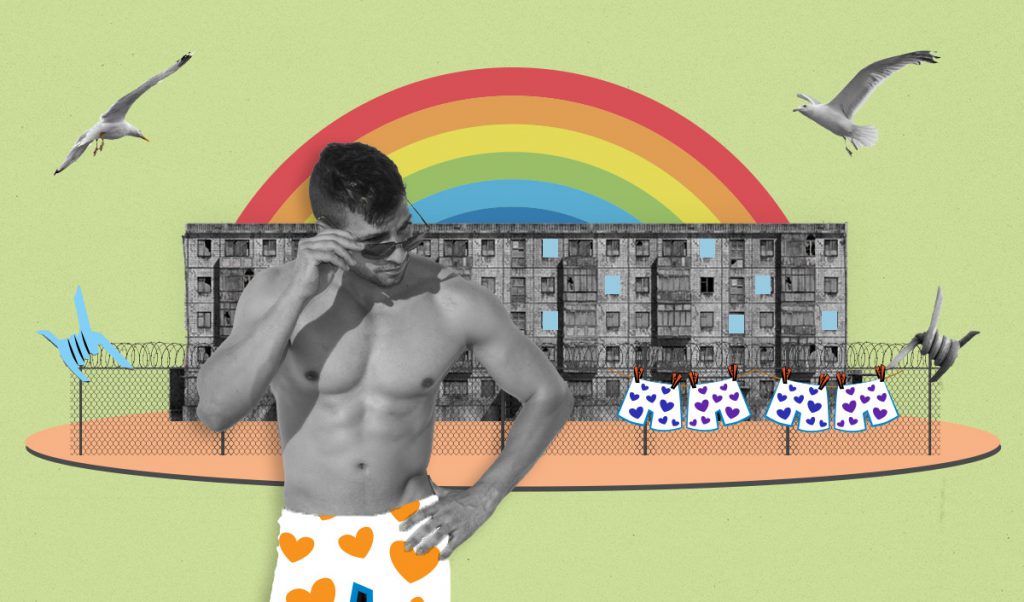





Herr Rinke! Das Baby-Bild! 🙂
Ganz ganz großes Kino!
Welches? Das meiner Mutter oder das mit mir?
Das Photo „Baby auf Fell“ natürlich
Also die Mama!
Ach, da habe ich mich vertan. Eine deutliche Ähnlichkeit gibt es wohl aber.
Berlin, das war in der Tat eine Stadt! Heute ist es eine ganz andere, aber besonders ist Berlin noch immer.
Und immer noch die Höhle des Löwen. Das Nachtleben dort macht mich fertig.
Es ist nicht die Stadt, sondern jeder selbst, der nach Mitternacht noch auf die Piste muss. Erlebnislosigkeit liegt nun mal nicht allen.
Gelegenheit schafft Diebe. Oder im Falle Berlins: Exzess.
berlin ist auch nur eine stadt. die leute dort sind schon selbst für ihr tun verantwortlich.
Oft bekomme ich das Gefühl, dass es auch heute noch relativ unbeliebt ist alleinerziehende Mutter zu sein. Jedenfalls werden die betroffenen Mütter nicht immer ganz ernst genommen.
Wer wird denn heute rundum ernst genommen? Trump? Greta Thunberg? Björn Höcke? Je „kosmopolitischer“ wir werden, desto weniger sind wir von Allgemeingültigem umgeben.
Sehr wahr. So einfach sind die Schubladen wirklich nicht mehr. Und trotzdem beanspruchen immer mehr Menschen ihr Urteil über alles und jeden abgeben zu dürfen/müssen.
Mäuse in der Backstube, ach du großer Gott! Da merkt man wieder, dass man gar nicht so richtig wissen will, was in der Küche so alles passiert.
Ich kenne immer nir die Kakerlaken-Stories. Mäuse sind auch nicht schlecht.
Ratten mit Pesterreger im Kochtrakt sind natürlich noch eindrucksvoller.
Ich hoffe immer, dass die ganzen Gruselgeschichten aus der Gastronomie nichts anderes sind als das: Gruselgeschichten.
Vielleicht sollte man, wie in anderen Ländern auch, eine Hygiene-Plakette am Restauranteingang einführen. In Berlin gab es laut Abschlussbericht 2018 ungefähr 2.500 Betriebe mit Hygienemängeln. Schon ziemlich erschreckend.
Sehnsucht nach Unauffälligkeit, irgendwo habe ich das schon einmal gehört. Gott sei dank ist das an mir vorbeigegangen 😉
Der eine versucht sein Leben lang nicht aufzufallen, der andere will um jeden Preis gesehen werden. Die Menschen sind unterschiedlich.
Nicht auffallen zu wollen zeugt von Minderwertigkeitskomplexen oder vom Selbsterhaltungstrieb. Es kommt auf das Regime an, unter dem man lebt.
Auch wieder wahr. In einer freien Gesellschaft fällt der Drang zum Auffallen-wollen wesentlich leichter.
Enfant sensible. Die Kategorie muss ich mir merken.
Unter dem Originaltitel „Enfant Terrible“ dreht Oskar Roehler gerade einen Film über Rainer Werner Fassbinder und zwar „interpretiert“ er laut ‚Blickpunkt: Film‘ „Leben und Wirken der Filmlegende in künstlerisch innovativer Form.“
Oha, das klingt gar nicht so unspannend. Man darf wohl gespannt sein. Jedenfalls gibt es uninteressantere Menschen als Fassbinder.