Genau gegenüber der Fleischerei beginnt eine Querstraße, die geradeswegs auf den Roosens Weg zuführt. Sie heißt Ernst-August-Straße, und kein Mensch interessiert sich dafür, wer das wohl mal war. (Der Pinkel-Prügel-Prinz aus Hannover kann ja nicht gemeint sein.) Wir bewegten uns die Ernst-August-Straße herunter: Guntram, von mir geschoben, ich von Erinnerungen, Irene von Wehmut erfüllt. Die Ernst-August-Straße, die parallel zur Bernadottestraße verläuft, machte diesen Ausflug zum Rundweg, und mehr hat Guntram nie gewollt: nicht umkehren müssen, weitergehen, weiterrollen – und am Ende wieder am Anfang ankommen.



Fotos (2): Wikimedia Commons/gemeinfrei
Er brauchte von New York aus nicht nach San Francisco und von Meran aus nicht nach Florenz. Aber wenn er in Meran ‚hinzu‘ die Passeier am rechten Ufer entlanggegangen war, dann lief er ‚rückzu‘ am linken Ufer entlang. Inzwischen hatte Irene dann geduscht und Kartoffeln geschält; ich hatte für mich selbst Notizen und für uns alle das Mittagessen gemacht: Meraner All- und Sonntag. Aber jetzt, hier, Guntrams erster geschobener Samstag: Das war schon ein Einschnitt. Alle drei taten wir so, als merkten wir es nicht.
Die Ernst-August-Straße verläuft etwas abschüssig, wenn man vom ‚Teich‘ her kommt. Ich musste abbremsen, um Guntram nicht davonfahren zu lassen.

Foto: Privatarchiv H. R.
Ohne störende Ablenkungen mündet die Ernst-August-Straße in den Roosens Weg, Nebenstraßen gibt es nicht. Manche Straßen und manche Menschen haben weder Abzweigungen noch Kreuzungen noch Gabelungen. Sie brauchen keine Wegweiser, weil es keine Scheidewege gibt. Beneidenswert? Von Durchgangsstraße zu Durchgangsstraße zu führen, vorwärts wie rückwärts, ohne dass es vorne oder hinten gibt und auf keiner von beiden Seiten weitergeht – ich beneide das nicht. Die Sackgasse hat wenigstens ihre Ausweglosigkeit und für Fußgänger ihre Schlupflöcher: So lebe ich seit langer Zeit.

Foto: Ricardalovesmonuments, Villenstrasse Süd 23 Kottgeisering, CC BY-SA 4.0
Der Roosens Weg, zu dem die Ernst-August-Straße führt, ist auch nicht gerade das, was der Amazonas unter den Flüssen ist, denn er führt seinerseits nur zum kaum befahrenen Teil der Bernadottestraße, das allerdings, am ehemaligen Haus von Maria Augstein vorbei, aufwärts. Wäre ich lieber eine Sackgasse für Millionäre oder die Autobahn, auf der Lastwagen von Reinbek nach Rom donnern? Möchte ich lieber mit Füßen getreten oder überrollt werden? Na, solch gedankliche Faxen vergingen mir schon, als ich Guntrams Rollstuhl der Bernadottestraße entgegenpresste, und mir wurde dabei klar, dass diese Steigung ungefähr das Äußerste war, was ich mit Schieben als Strecke bewältigen konnte.
Wir überquerten die Bernadottestraße, ich schob Guntram in den Taxusweg. Von nun an würde der Rückweg wie der Hinweg verlaufen. Irene ging so schleppend, wie es mein Schieben des Rollstuhls gebot, und sie fühlte sich dabei – vielleicht zum ersten Mal – so alt, wie sie war.

Foto: Privatarchiv H. R.
Ich schob Guntram von der Fußgängerschneise zwischen Bernadottestraße und dem Platz, der Taxusweg hieß, und auf dessen Mitte die Rosen noch lange nicht blühen würden, auf den Asphalt. „Hoppla“, sagte er. Dass ein Bordstein, eine Stufe oder eine Tür, die sich nur nach außen öffnen lässt, unüberwindliche Hindernisse sein können, gilt für Schnecken wie für Behinderte. Schmerzlich ist es, etwas nicht zu können, was die anderen Schnecken und die Nichtbehinderten schaffen. Guntram hat, aus seiner Sicht heraus, immer alles geschafft: der Armut zu entkommen; der Kriegsgefangenschaft zu entgehen; Frauen zu haben, die ihm nicht davongelaufen sind; Karriere zu machen; vermögend zu werden; seinen Golfpartner zu besiegen und sich überall dort durchzumogeln, wo fundiertes Wissen oder Können nicht vorhanden waren. Wer von sich selbst 87 Jahre lang so verwöhnt worden ist, muss es als grauenhaft empfinden, an einer fünf Zentimeter hohen Schwelle zu scheitern. Ich brauchte schon mit sechzehn eine Brille.

Inzwischen hatte ich Guntram das namenlose Straßenstück entlanggerollt. Wo kein Briefkasten und keine Eingangspforte sind, sind Namen überflüssig. Und die Stadt verschwendet schon genug Geld für Ampeln, die nicht gebraucht werden, und für Betonkübel, die stören. Irene hatte rechts und links geguckt, sie ist vorsichtig. Ich hatte mich auf mein Gehör verlassen und Guntram zwischenfallfrei über den im Rhythmus der Ampelschaltungen belebten Halbmondsweg gebracht, geradewegs auf den unbelebten Zypressenweg, der zu nichts führt als zu unserer rückwärtigen Gartenpforte.

Foto: geralt/Pixabay
„Ich würde gerne wieder mal die Waitzstraße sehen“, sagte Guntram. Irenes Gesicht war anzumerken, wie unverständlich ihr dieser Wunsch war. Schon dass sie nichts sagte, war ungewöhnlich, aber weise. Da sah man ringsum, dass bald die Weiden grünen würden und dann: die Waitzstraße! Genauso gut hätte er sagen können: „Ich würde so gerne mal wieder die Ostfront sehen!“


Foto links: gemeinfrei/Wikimedia Commons | Foto rechts: hh oldman, Groß Flottbek, Hamburg, Germany – panoramio (10), CC BY 3.0
Aber Guntram hatte das Tatar häufig in der mondänen Waitzstraße gekauft, nicht am biederen ‚Teich‘, und so war es ganz einleuchtend, dass ihm diese Erinnerung mehr bedeutete als die verheißungsvollen Weidenkätzchen.

Foto: fotomarekka/Shutterstock
Ich öffne die Pforte, sie geht nach außen auf, ich muss Guntrams Rollstuhl wieder ein Stück zurückschieben, es gibt einen Ruck am Kantstein. „Ach Gott, nein, Kinder!,“ schreit Guntram, „nun sagt doch mal selber: Muss das denn noch sein!“
Die Noch-Lebenden machen es den Noch-Lebenderen schwer, das weiß ich von Roland. Irene versucht, ein Gesicht zu machen, als ob sie nichts fühlte.


Fotos (2): _Alicja_/Pixabay
Am liebsten ist einem der Körper, wenn man ihn nicht spürt. Schön, mal ein Orgasmus oder ein Gefühl von Sonnenwärme auf der Haut – aber sonst: Den Körper zu merken, heißt fast immer, zu leiden: Schmerzen, Jucken, Kitzeln. Schwäche, Atemnot, Schleim, Ausscheidungen. Und es gibt kein Entrinnen. Ich habe mich, auf meine unbescheidene Art, so um das Äußerste bemüht, im Fressen wie im Hungern! Aber das Niederziehende dabei ist: Wenn man das Äußerste erreicht hat, muss man das Alleräußerste erreichen. Im Grunde fängt man immer wieder von vorn an, und die Stationen, die einmal die Entscheidung über Leben und Tod zu bedeuten schienen, wehen vorbei wie früher, als der Zug dort noch nicht halten durfte, der Bahnhof ‚Stadtmitte‘.

Foto: Frits Wiarda, 891118k berlin u bahnhof stadtmitte, CC BY-SA 3.0
Ich schloss die Pforte, die vom Zypressenweg zu unserem Grund und Boden führt, auf. Der anschließende Gehweg, vorbei am Herrenhaus ist zu schmal für uns drei. Erst kommt Guntram, im Sitzen, dann ich, im Schieben und zum Schluss Irene wie die Nachzüglerin einer Fronleichnamsprozession. Doch dann überholte sie uns, indem sie über den Rasen ging und öffnete die Kette. Ich fuhr Guntram auf seinen Hof. „Wer hätte gedacht, dass ich mal so enden würde“, sagte er. Irene drückte das äußerste Glied der Kette in den Haken am Pfosten zurück, der Hausmeister des Herrenhauses hatte die Kette stramm gespannt. Es kostete Irene sichtlich Anstrengung, ihr Eigentum wieder gegen den Weg (auch ihr Eigentum) abzugrenzen.

Foto: dmdartworx2016/Shutterstock
Nun waren wir zurück an unserem mit viel Liebe und Geld hübsch gemachten Kutscherhäuschen: Das Fachwerk leuchtete rostbraun zwischen dem weißen Putz, die roten Ziegel waren bloß Fassade über der Styropordämmung, und wo früher die Kutschen gestanden hatten, stand jetzt links der Herd und rechts das Fernsehungetüm. Dazwischen lag die Diele, davor der Rasen.


Fotos (2): Privatarchiv H. R.
Ich griff durch das Gitter und drückte den weißen Knopf, mit einem Summen ging die Tür auf, in Richtung von Guntrams Füßen. Auf dem Weg zur Haustür überholte uns Irene wieder, um aufzuschließen, aber sie fand den richtigen Schlüssel nicht in ihrem Portemonnaie, und so schloss ich mit dem Schlüssel aus meinem Bund auf.

Foto: Capri23auto/Pixabay
Irene packte Guntram links, ich packte ihn rechts, und so halfen wir ihm aus dem Rollstuhl heraus an seinen Rollator, damit er, auf den Gehwagen gestützt, die Stufe zur Haustür bewältigen konnte.

Foto: Josk at Dutch Wikipedia, Rollator1, CC BY-SA 3.0
Während ich den Rollstuhl zusammenklappte und ihn am Haus vorbei auf die Terrasse brachte, zog Irene in der Diele Guntram die Jacke aus. Mit seinem Gehwagen war es ihm möglich, selbstständig seinen gewohnten Platz im ‚Hockstübchen‘ zu erreichen, auf dem er wartete, bis wir ihn zum Mittagessen abholten.

Foto: 3dman_eu/Pixabay
Guntram ließ sich schwer in den frisch bezogenen Sessel fallen. Er war auf eine zufriedene Art erschöpft: „Das war wirklich schön. Und so durch die Gegend gefahren zu werden, ist auch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Es hat mir ganz gut gefallen, das muss ich sagen.“ Er blickte vor sich hin oder hinter sich her. Irene ging gerührt in die Küche, ich holte ungerührt Wein aus dem Keller.


Fotos (2): Privatarchiv H. R. | Titelillustration mit Bildern von Shutterstock: VINCENT GIORDANO PHOTO, Giordano Aita, V_Lisovoy, Maxx-Studio, rawf8, The Mumus, Victor Metelskiy, Kevin Tichenor
So weit mein Déjà-vu aus dem März 2000.

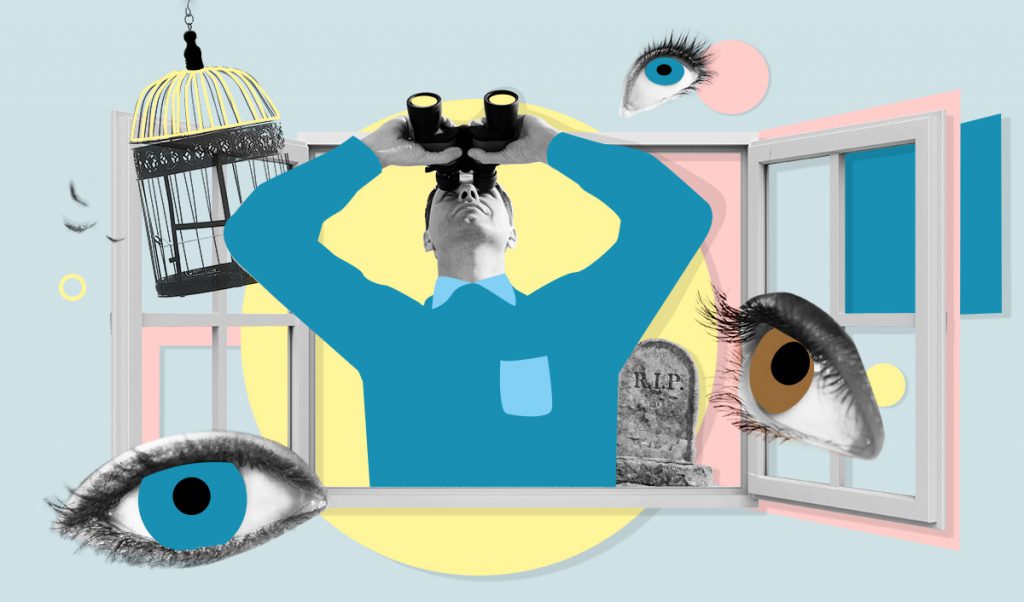


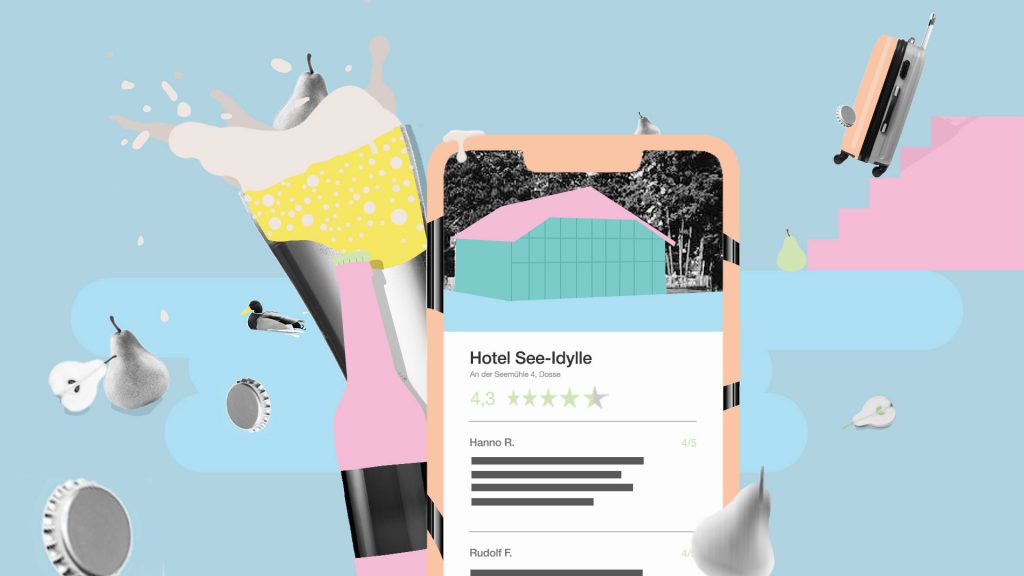



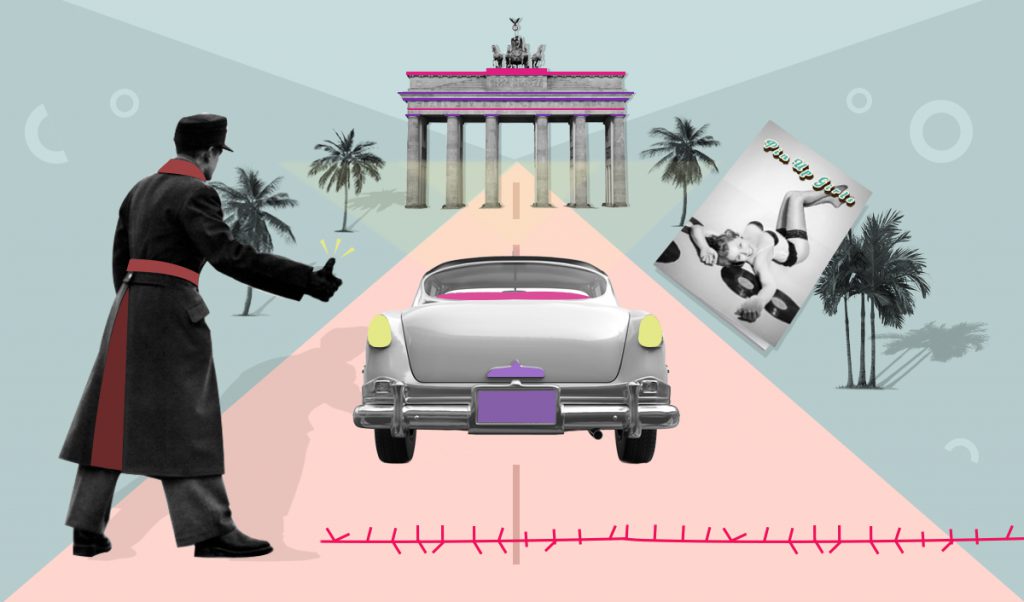
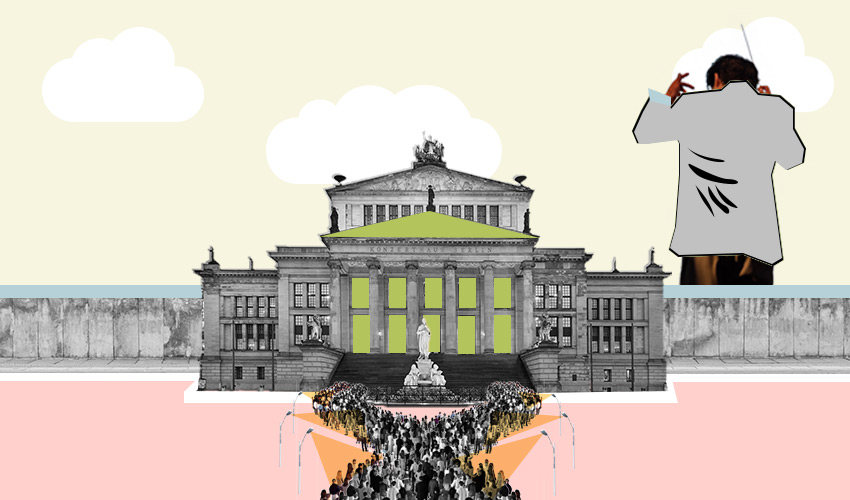

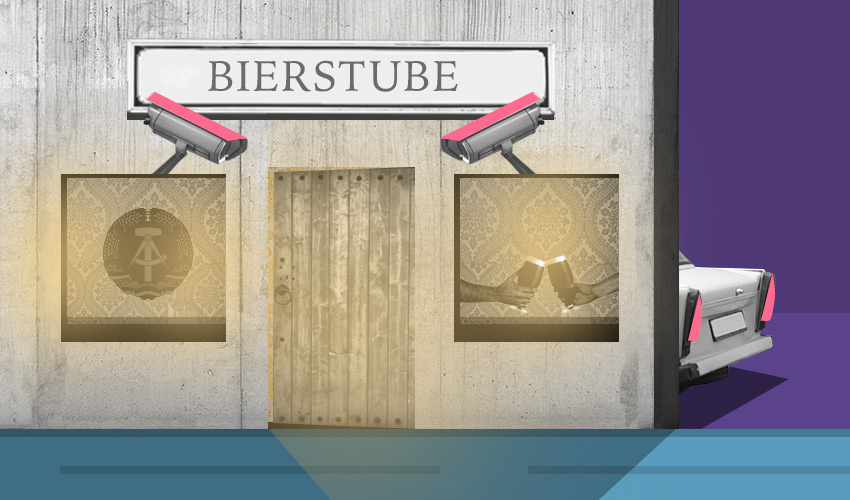












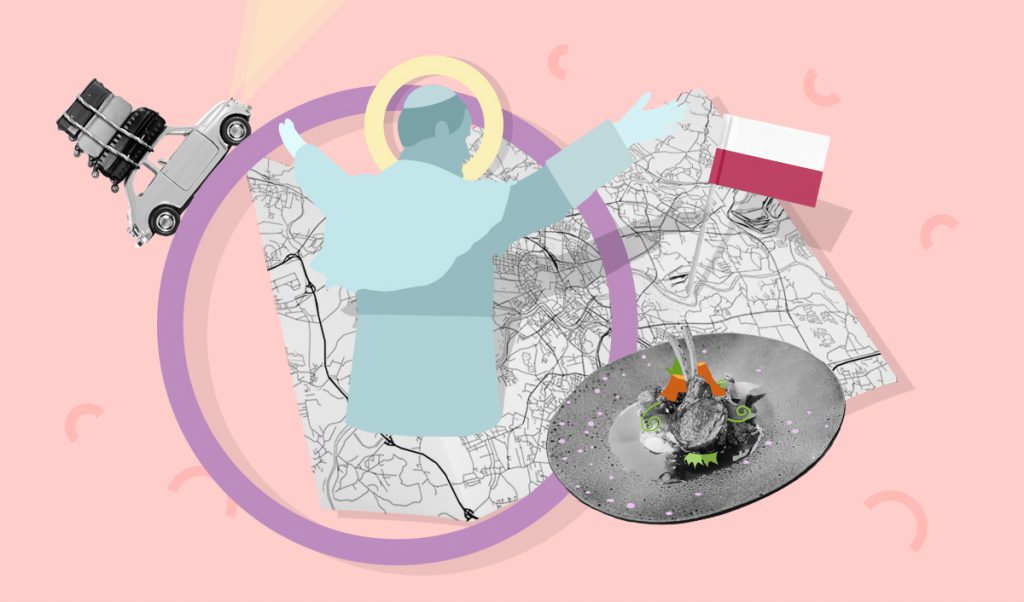

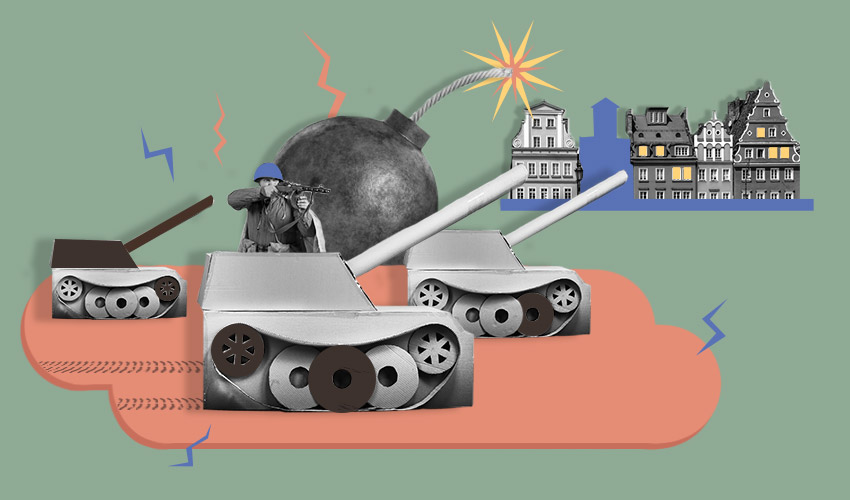





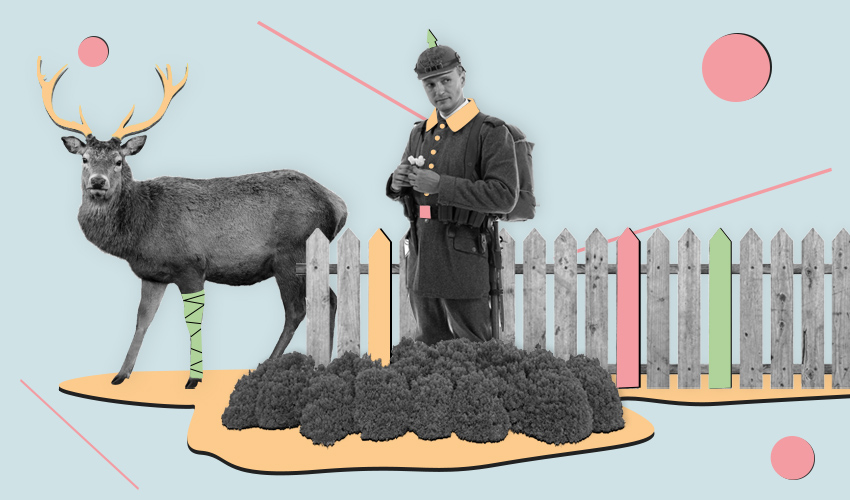


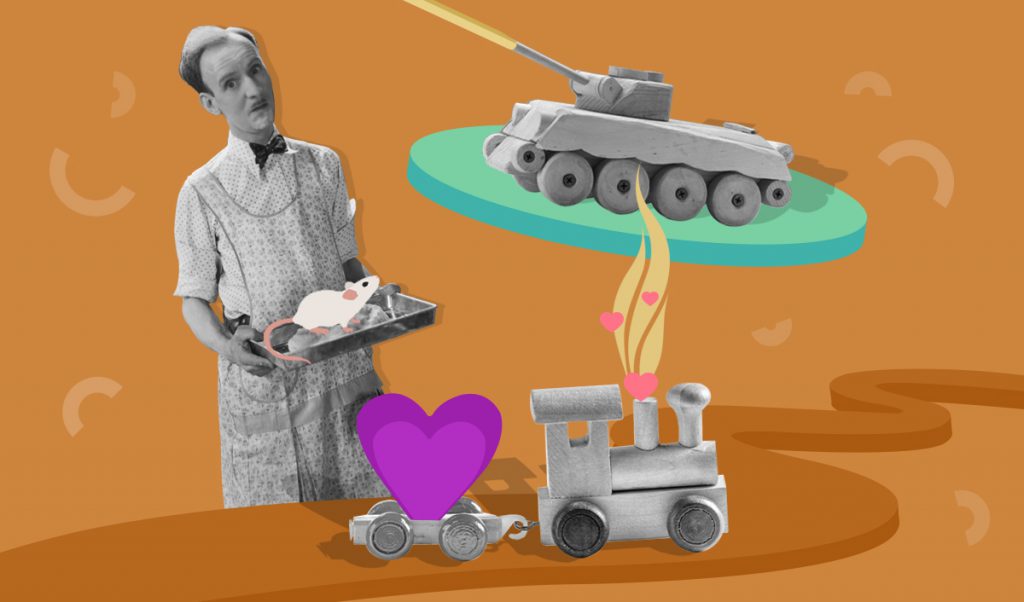





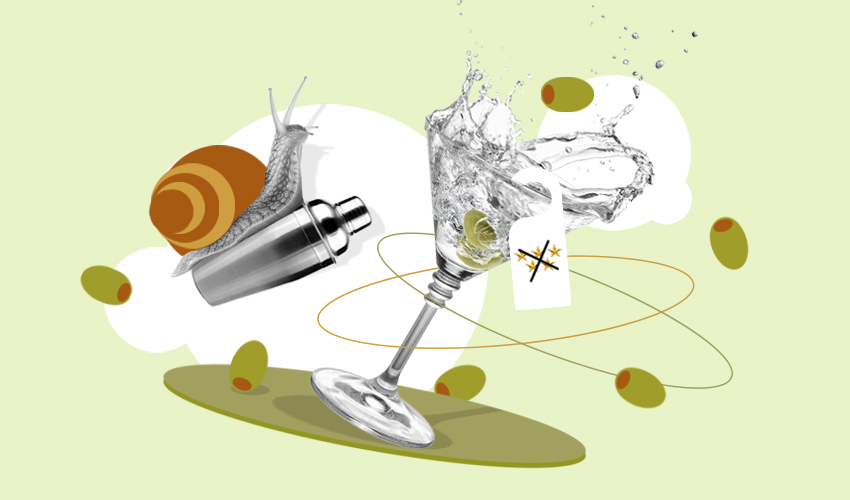





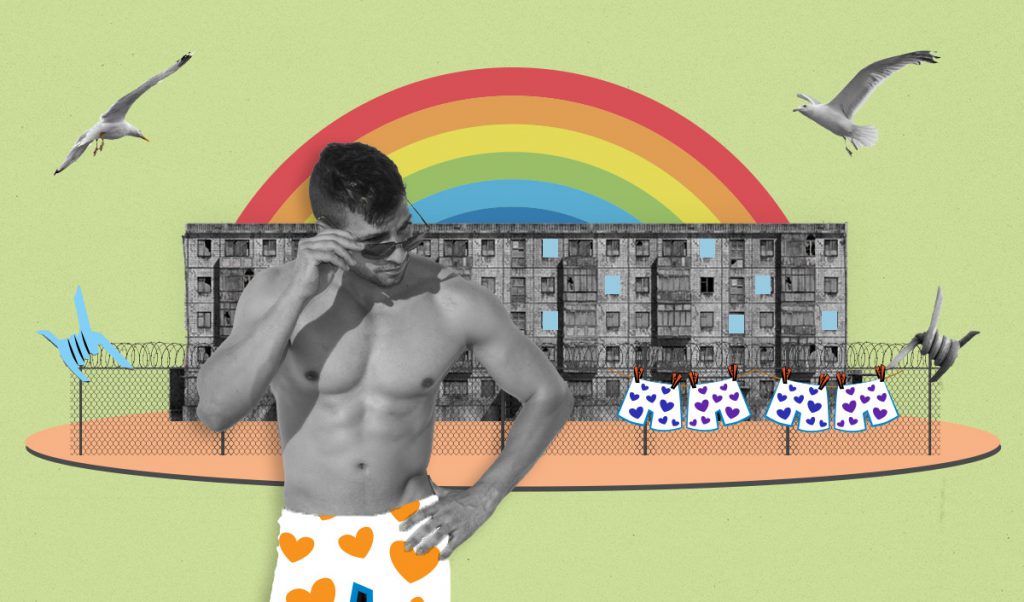





Gibt es das wirklich, Menschen ohne Abzweigungen? Also ganz geradlinig?
Nicht aus meiner Erfahrung…
Nein. Oder? Manche Menschen behaupten, sie seien völlig gradlinig. (Dumm)
Andere behaupten von Menschen, die sie zu kennen glauben, das seien Leute, die sich nie Gedanken machen. (Sehr dumm)
Und dann gibt es noch die, auf die das sogar zutrifft. (Am dümmsten)
Haha, und gekonnter hätte man das wohl nicht zusammenfassen können 😉
Ich glaube „den Körper zu merken, heißt fast immer, zu leiden“ stimmt nur, weil wir so wenig positive körperliche Erfahrungen machen. Das klingt vielleicht esoterisch, aber ich glaube die meisten schöpfen das Potential dort gar nicht aus.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Die Fitness-Gemeinde spürt den Körper sehr viel intensiver als die Seele. Gut so. Den trainierten Körper gibt es. Eine Seele ist nicht nachweisbar.
Der Fitnesswahn ist wie so vieles völlig übertrieben, aber wer weiss wie er regelmäßig genügend Endorphine und Dopamin freisetzen kann ist sicher im Vorteil.
Im Grunde fängt man tatsächlich immer wieder von vorn an. Wieder einmal ein so richtig wahres Wort!
Es gibt halt einfach wenig Neues im Leben. Alles schon mal gesehen, alles schon mal gemacht.
Na ja. Täglich gibt es halbwichtige „News“ und täglich gibt es die Möglichkeit, das Gesehene aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und anders anzugehen.
Oder man sagt gleich Fake News und braucht sich nichtmal mehr die Mühe eines neuen Blickwinkels machen.
Interessant, dass Hindernisse oft erst als unangenehm wahrgenommen werden, wenn andere sie problemlos überwinden, nicht wahr? Was für alle Menschen gleich schwer ist, kümmert uns viel weniger.
Menschen denen alles gelingt, egal was sie anfassen, faszinieren mich natürlich. Nachvollziehen oder glauben kann ich es trotzdem kaum.
Na jeder hat halt mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen. Da brauch man sich keine Illusionen machen. Auch Leute, denen oberflächlich alles gelingt, haben ihre Dämonen.
Was ist denn eigentlich aus dem Pinkel-Prügel-Prinz geworden? Man hört und liest so wenig.
Schlimm, wenn man nicht mal mehr beim Friseur geblättert wird.
Der Untergang!
Die letzten Nachrichten, die mir in Erinnerung sind, waren eine lebensbedrohlichen Entzündung der Bauchspeicheldrüse und ein bösartiger Tumor. Wirklich nicht, die Art von Nachrichten, die irgendjemand glücklich machen würden.
Am liebsten ist einem das Leben, wenn man es nicht spürt. Darum ist Alkohol so beliebt.
Manche spüren das, was sie für sich selbst halten, mit Alkokol intensiver. Weiß ich aus Erfahrung …
Man muss dem Leben einfach immer um mindestens einen Whisky voraus sein. 😉
Ein Leben im Rollstuhl unterscheidet sich von einem Leben ohne Rollstuhl. Auch wenn die progressive politische Korrektheit gerne etwas anderes sagen würde.
Die Idee ist wohl auch nur, dass man Menschen gleich behandelt. Nicht, dass man alle Menschen über einen Kamm schert.
sagen Sie das mal den neuen linken