Lieber Pali!
Ich sitze hier an einem mickrigen Schreibtisch, dabei groteskerweise einen runden Spiegel so dicht vor Augen, dass ich nicht umhinkomme, mir beim Schreiben zuzusehen; das ist, als sähe man sich beim Gehen zu: Man fängt an, über die Buchstaben zu stolpern, die einem sonst ganz natürlich aus dem Filzstift flössen. Nichts ist natürlich, alles ist willkürlich. Ich schreibe dir nicht; ich schreibe dir ja nie nette, einfühlsame, um dein Wohl bedachte, möglichst noch literarisch bedeutsame, also nicht effekthascherische, Briefe, sondern ich schreibe bloß egomane Rettungsanker, die ich unhöflicherweise in deinem aufgebrachten Meer an rasselnder Kette runterlasse, bisher haben sie sich ja auch immer irgendwo in dir festgezurrt. Ich misstraue meinen Möglichkeiten, mehr als zu gefallen (und gefallen könnte ich ja auch bloß durch Saucen statt Soßen und Blicken statt Glotzen).

Eben stoße ich bei der Suche nach etwas ganz anderem auf meinen Brief an Pali. Da ich – ganz wie das Universum – keinerlei Scheu vor Ausdehnung habe, fällt es mir nicht schwer, meine Beobachtungen von 1997 nachträglich auf diesen Bericht draufzupfropfen.

Foto: yasuhiro amano/Shutterstock
Der Balanceakt, dich abzustoßen und zu verstören scheint mir Spaß zu machen, ist mir also wichtig; Irenes Ansprüche an Lokale und deine Erwartungen von Zusammensein haben mich der Normalität entwöhnt, und so kann ich euch beiden wirklich ganz selbstlos die Schuld daran zuschieben, dass ich nicht mehr zur Imbissbude gehe und nicht mehr gern über Alltägliches rede. Du hast mich sogar noch mehr verdorben als Irene, denn einen Hamburger kann ich noch genießen, ein Gespräch auf diesem Niveau nicht. An seinen Vorbildern ist man selber schuld, nicht die Vorbilder. Komisch, dass da die Vorwürfe immer so verkehrt zugeteilt werden. Sobald ich den Mund aufmache, gebe ich etwas preis und fordere etwas ein. (Bei McDonalds bitte ich allenfalls demütig um Ketchup). Du weißt ja, ich muss mir, undank dieses in den Schreibtisch eingelassenen Spiegels, dauernd zusehen beim Formulieren, und ich sehe mir ins Gesicht, während ich mich frage, ob das ein bisschen happig klingt: ‚Resümee‘ – klingt vollmundig, ist trotzdem wahr. Aufschnittverkäuferinnen, Blumenbinderinnen, Tankwarte, die Handvoll anderer Leute, denen ich sonst noch begegne – ja, ich mute mich ihnen voll zu, in der Hoffnung, etwas Persönlicheres als üblich vampirhaft aus ihnen herauszusaugen. Serviererinnen: Aufgeblasen, eitel, effekthascherisch bin ich, die will mir doch bloß das Glas Wein hinstellen, sonst nichts. Na schön. Und dass ich nun eine Minibeziehung zwischen Äußerung meines Wunsches und Übergabe der Ware aufbauen will – Selbstgefälligkeit, Menschenzuneigung? Jedenfalls schneiden mir die Verkäuferinnen den Parma-Schinken immer einen Hauch dünner.
Hier gibt’s allerdings keinen Parma-Schinken.

Zoppot/Danzig 26.08.1997
Dafür gibt es hier wolkenlosen Himmel, laue Nächte und das, was dich und meine Eltern bei aller Verschiedenheit eint: die Möglichkeit, sich dort, wo andere sich wohlfühlen, fehl am Platze zu fühlen. Die Fenster sind nicht offen genug, der Wind bläst nicht kräftig genug – trotz ARAL-Tankstellen und Coca Cola ist das Ganze nicht ostblockentlüftet. Irene, die gewohnt ist, dass die Damen wie auf Gemälden von August Macke über die Promenade schwebten, kann sich schwer an den Anblick dessen gewöhnen, was sie ja in Travemünde und Baden-Baden auch nicht sehen muss. Guntram ärgert sich mehr darüber, dass das alles nun polnisch ist, wobei er ihnen, den Polen, die Probleme mit dem oberschlesischen Bergbau durchaus gönnt. Nach unserem Durchgang durch Danzig sagte er: „Wir“, und meine vielen Vorhaltungen im Sinn sich korrigierend „die Deutschen haben Vabanque gespielt und verloren. So ist das eben.“

Bild: gemeinfrei/Wikimedia Commons
Irene störte, nein, verstörte mehr, dass alles, was sie als die Schauplätze ihres Alltags kannte, jetzt eine Art bunt bemaltes Disneyland ist, schmuck, aber von Reiseführern und ihren Gruppen so durchwuselt, dass man sich zur Auflockerung ein paar hungrige Hyänen im Straßenbild gewünscht hätte.

Foto: Mark Bridger/Shutterstock
Irenes Irritation über die touristenverpestete Gelacktheit des Zentrums verstehe ich. Aber Guntrams Bemerkung ist ja mindestens so originell: Denn ich denke, Hitler hat ja – skrupelloser, fanatischer Bohemien, der er war – wirklich Vabanque gespielt, aber Millionen, die an das Propagierte glaubten, wir/die Deutschen, haben die denn nach deren Selbstverständnis (im Überlebensfalle) Pommern, Schlesien und die Achtung der Welt am Roulettetisch verloren?

Foto: © Ralf Roletschek, 13-02-27-spielbank-wiesbaden-by-RalfR-093, CC BY-SA 3.0
Wenn man die Juden nicht düpiert, sondern mit einbezogen hätte („Also, wenn ich nicht Jude wäre – ich wär doch selbst Nazi!“, hat Guntrams Chef zu ihm gesagt), dann hätten die Amerikaner (und deren treibende Kraft, die Juden) nicht in den Krieg eingegriffen – kurz: Nicht die Juden waren Deutschlands Unglück, sondern – nicht ganz neue Erkenntnis – Hitler! Denn sonst, ohne diesen Scheißantisemitismus, wäre Danzig heute deutsch, und – da bin ich sicher – die Fassaden wären weißer und das Wasser flösse energischer in die Badewanne.

Foto: torwaiphoto/Fotolia
Wer, wie ich, nicht von Belang findet, ob Borussia Dortmund oder Schalke 04 ein Match gewinnt (Entfernung Luftlinie: 35,86 km), den schert auch nicht groß, ob ein Örtchen zu Deutschland, zu Frankreich oder zu Polen gehört. Fremde Sprache, fremdes Geld – sonst bin ich kein Fremder, sondern bloß unterwegs – ein Europäer. Die Sprache ist das Wichtigste. Das wissen wir nicht erst seit dem Turmbau zu Babel. Obwohl: Einen sorgsam artikulierenden Norditaliener verstehe ich besser als einen sprachschlampigen Schwaben. Sowieso wird nonverbale Kommunikation immer bedeutsamer. Während eines zornigen oder zärtlichen Blicks brauche ich nicht zu wissen, mit wie vielen ‚s‘ man das(s) schreibt. Die Sprache verflacht und verroht. Das sagen die Alten seit Jahrhunderten. Vielleicht aber sind bloß sie stehen geblieben, während die Sprache fortgeschritten ist.

Foto: Irina/Adobe Stock

Foto: DisobeyArt/Adobe Stock
Guntram und Irene – auf Harmonie bedacht wie immer – wahren die Balance: Am ersten Tag fühlte Guntram sich schlecht, am zweiten Tag fühlte Irene sich schlecht, am dritten fühlten sich beide schlecht. Sich ‚schlecht‘ zu fühlen, ist nicht dasselbe wie unglücklich zu sein, aber man kann nicht glücklich sein, wenn man sich schlecht fühlt. Die Frage ist dennoch: Was ist Schwäche, die einen Schubs braucht, um sich in Lebenslust zu verwandeln, was ist krankheits- oder altersbedingtes Leiden, das der Schonung bedarf? Auch da ist Balance gefragt.

Foto: Corgarashu/Adobe Stock
Ich komme mir ein bisschen vor wie auf der letzten Reise mit Roland, nach Bayreuth, bloß, dass es statt fünf Stunden Wagner die ganze Nacht hindurch Discogewummer vom Strand-Vergnügungspark gibt, der unsere zum Meer hin gelegenen Zimmer mit jugendlichem Leben erfüllt. Das erste erwähnenswerte Ereignis war, dass sich Guntram seinen Champagner über sein champagnerfarbenes Hemd in seine champagnerfarbene Hose goss. Die Farbabgestimmtheit tröstete ihn wenig, weil er nur ungern mit nassem Schritt auf nassen Polstern sitzt. Du musst wissen, dass die LOT nicht wie Lufthansa poplige Gläschen ausschenkt, sondern großzügig Flaschen verteilt, die die Kreuzung aus Rentner-Piccolos und den gängigen Dreiviertelliterflaschen darstellen. Ein hilfsbereiter Steward grapschte Guntram mit handtellergroßen Papierservietten im Schoß rum, aber der verzog sich lieber in die leere vordere Reihe, um seinen Unterleib der durchs Bullauge scheinenden Sonne entgegenzurecken. Dann aßen wir alle brav unsere Businessclass-Stullen mit gemischtem Aufschnitt und starrten erwartungsvoll auf die von weit oben her noch recht blaue Ostsee.


Foto links: Yevgeniya Shal/Shutterstock | Foto rechts: Andrei Kuzmik/Shutterstock | Titelillustration mit Bildern von Shutterstock: Vector-3D, Aaron Amat

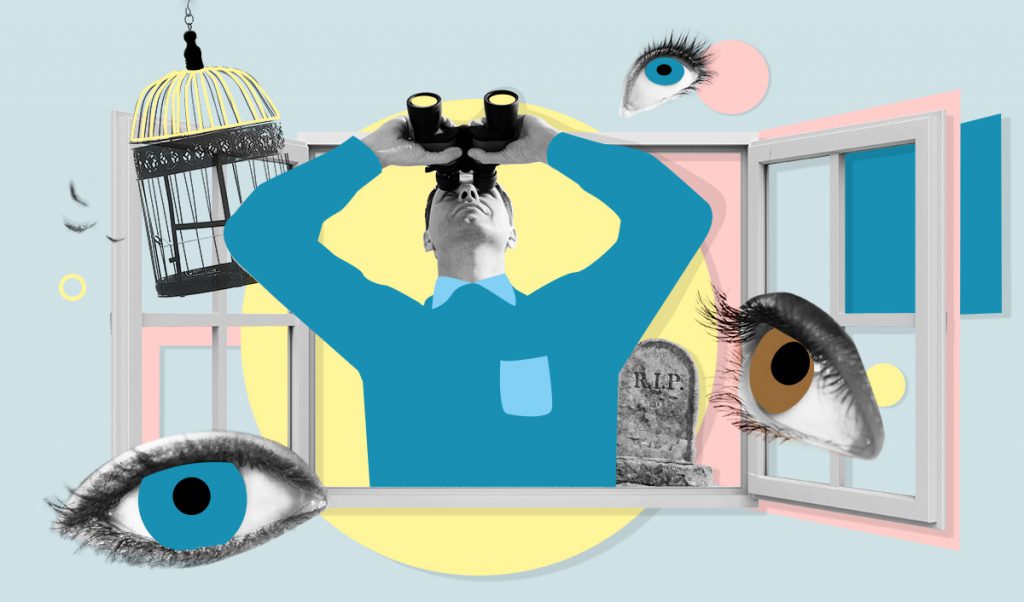


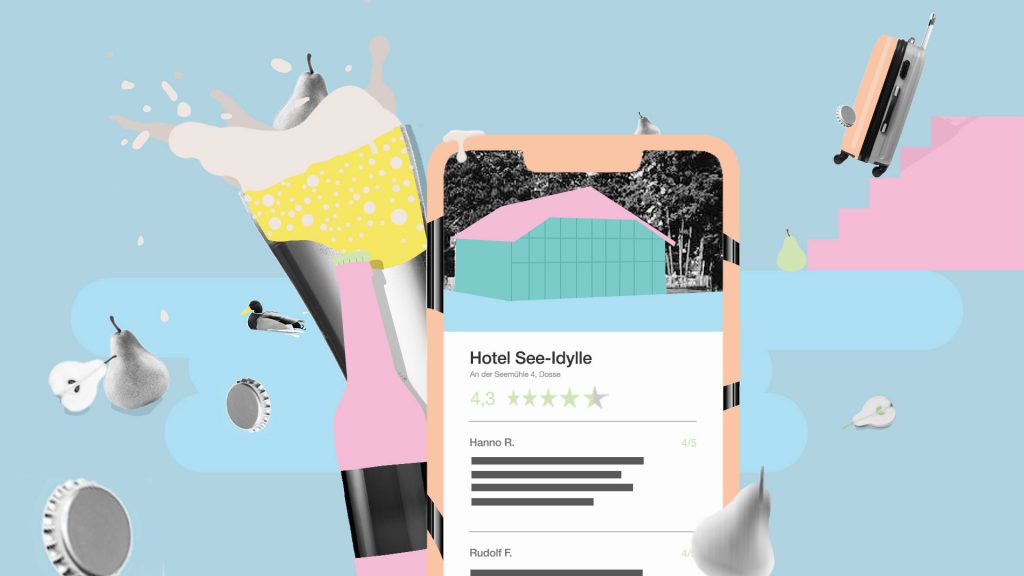



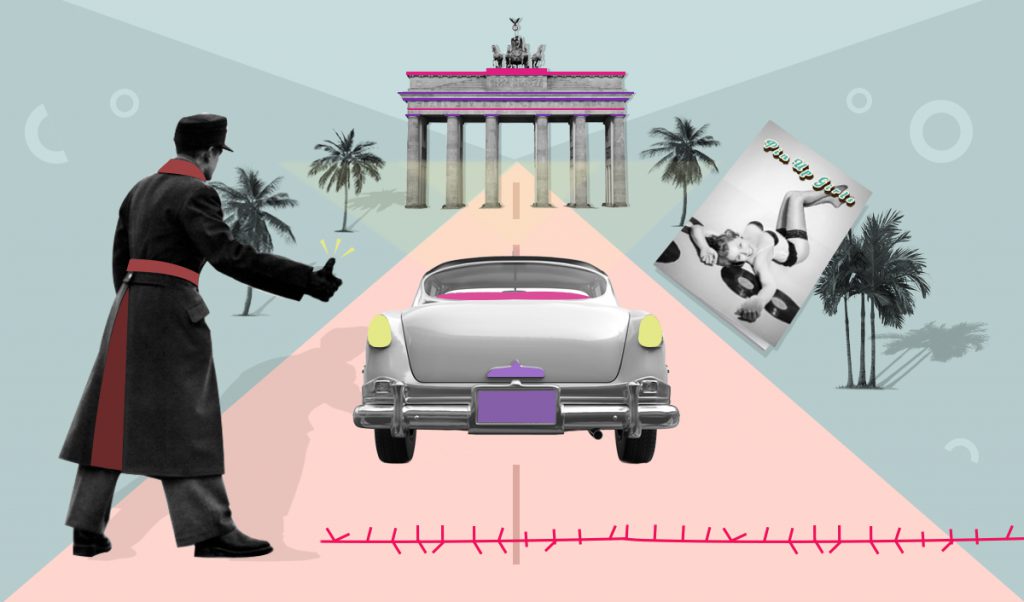
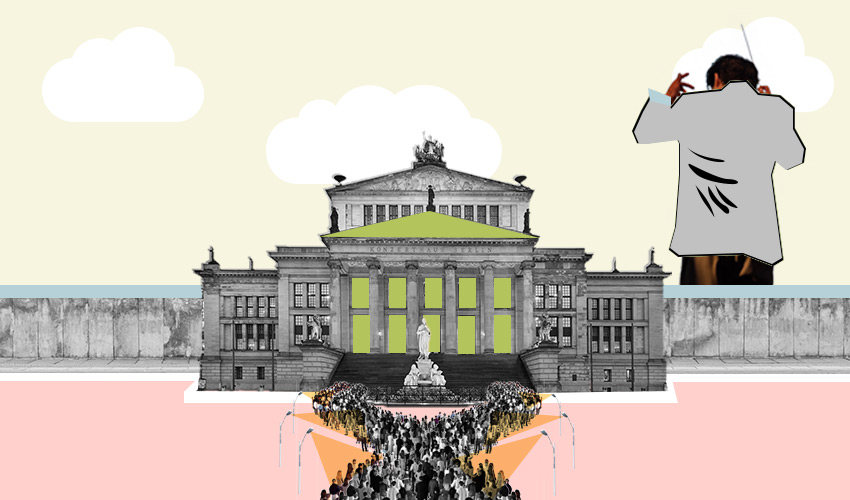

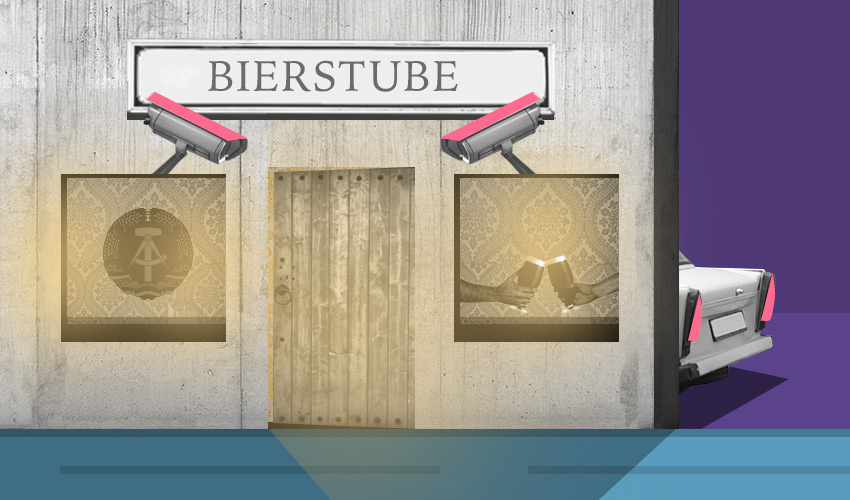













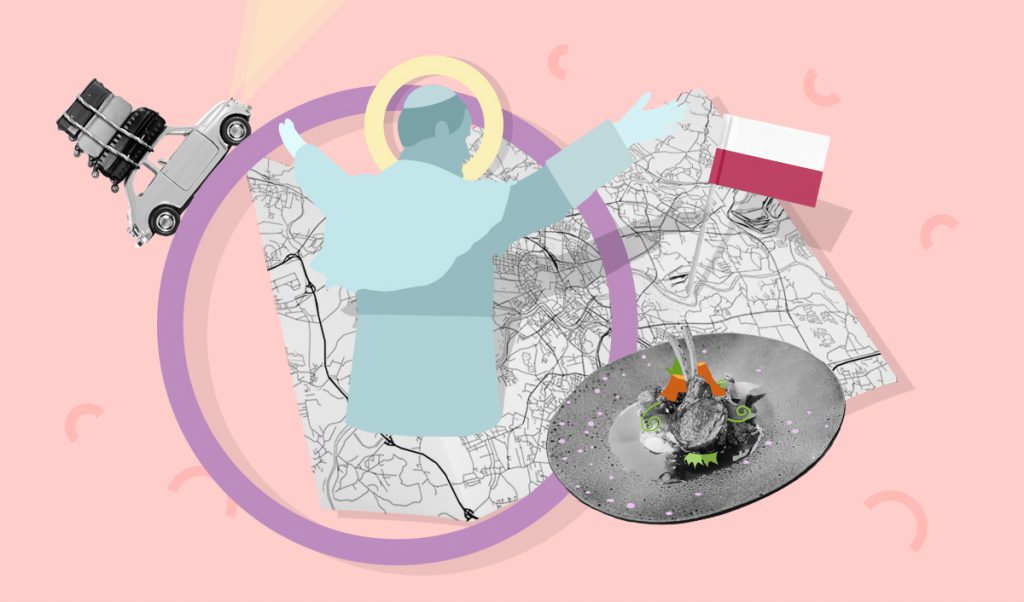

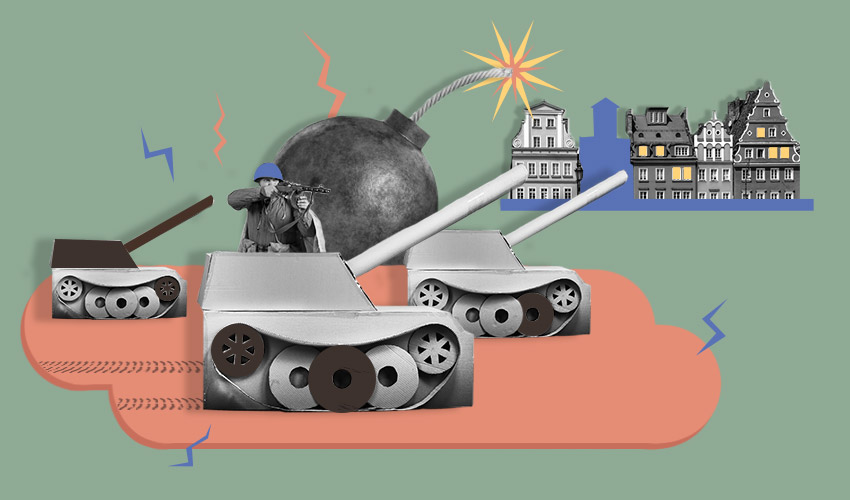





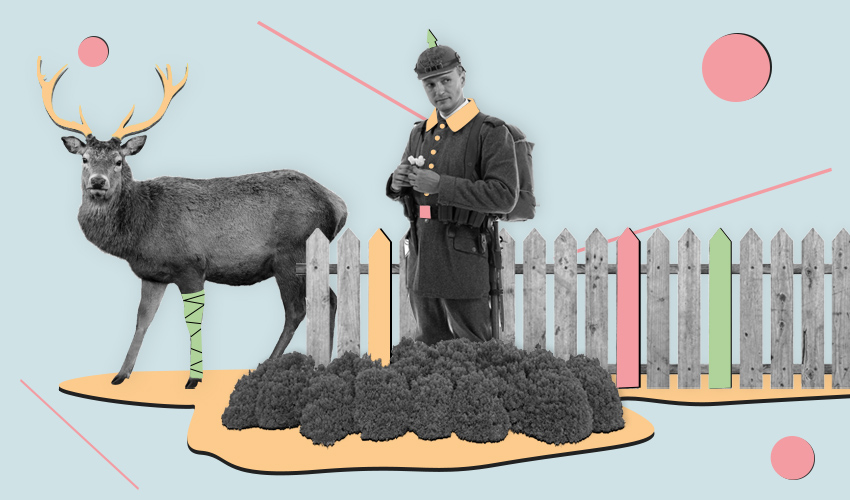


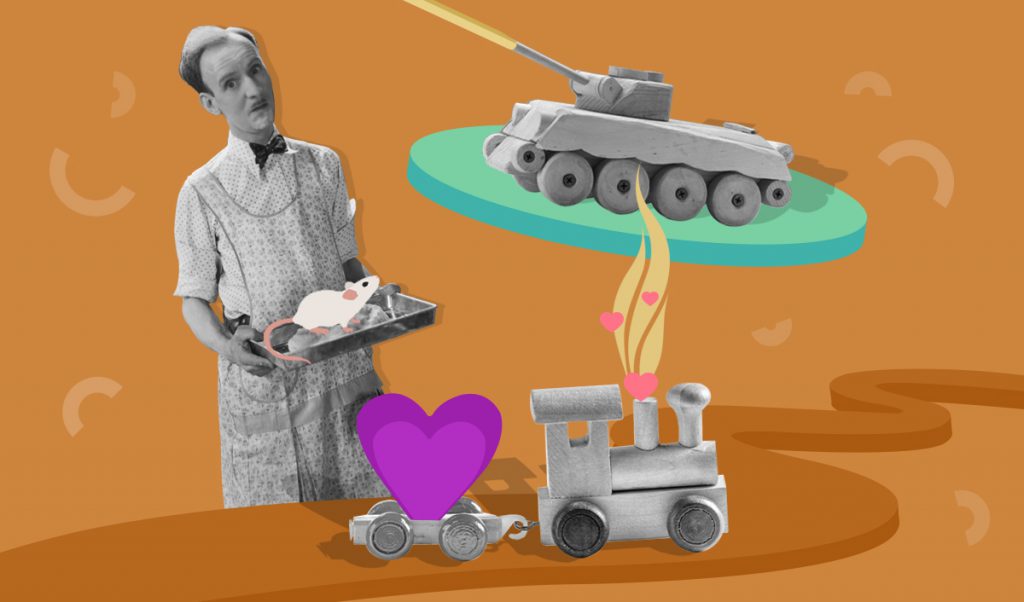




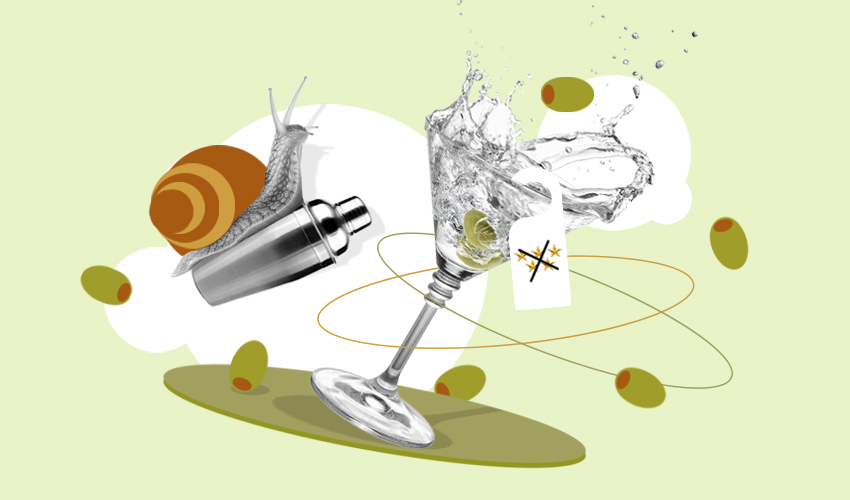





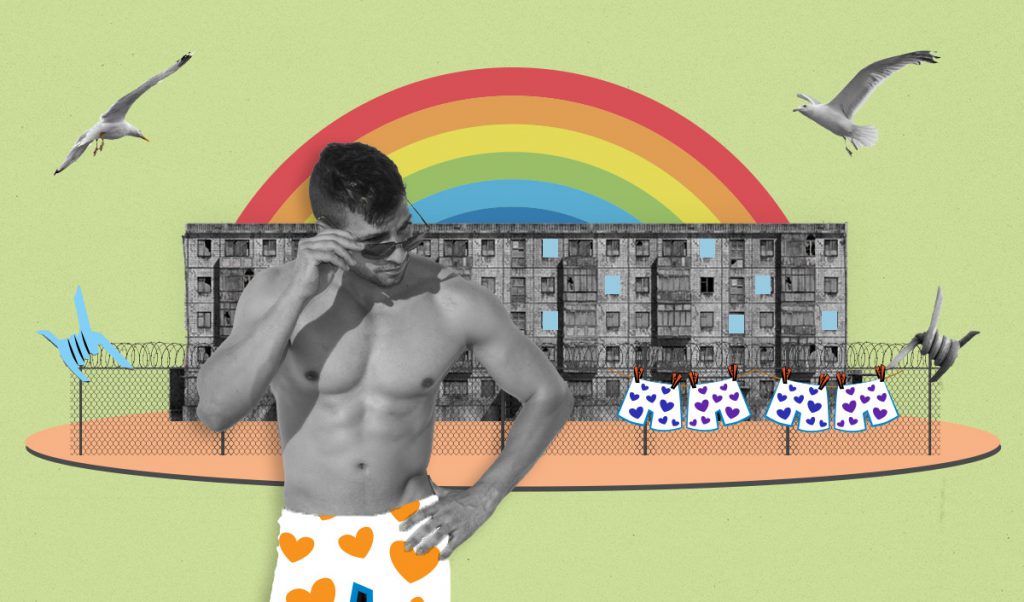





Maximalismus is the new Black. Der kurzen Aufmerksamkeitsspanne unserer Zeit diese Briefe entgegenzusetzen ist ziemlich klasse.
Danke. Ich fühle mich bestätigt.
Wer in der Weltpolitik ‚vabanque‘ spielt, hat definitiv nicht alle Strippen richtig verkabelt. Hitler ist natürlich ein Extrembeispiel. Es gibt aber viele ungefährlichere Zeitgenosse, die ähnlich riskant spielen.
Wenn alle Menschen Risiken konsequent vermieden hätten, pflückten wir jetzt noch Beeren oder wären längst Bären erlegen. Hitler gab 1939 (stolz?) zu: „Ich habe in meinem Leben immer Vabanque gespielt.“ Alles auf eine Karte zu setzen, bringt Sieg oder Niederlage. Zu zögern kann dieselbe Konsequenz haben. Auf sein Herz hören, auf sein Hirn hören, auf seinen Finanzberater hören? Ist Leben überhaupt erlernbar? Wir fragen weiter.
Erinnert mich an Lars von Trier, der zu Nymphomaniac-Zeiten eigentlich nur noch 7-Stunden-Filme drehen wollte.
Übrigens gehörte dies zum Maximalismus. Nicht zu Hitlers Weltpolitik.
McDonalds, urrgh, da bitte ich nur um Gnade. Das fieseste Fast Food.
Wenn man in der Nacht hungrig wird und nichts anderes in der Nähe ist muss es halt auch einmal McDo sein. Es gibt wirklich schlimmeres.
Ein Hamburger in der Hand ist besser als ein Schwein auf dem Dach.
Ein bischen echtes Schwein im Hamburger wäre noch toller 😉
Eine Gemeinsamkeit von Juden und Moslems:
für beide unessbar.
Noch ein Pluspunkt für den Atheismus 😉
Ist die Sprache wirklich fortgeschritten, wenn sie immer weiter vereinfacht wird? Wahrscheinlich bin ich tatsächlich einfach alt.
Nicht resignieren! Wo „kämen“ wir hin, wenn wir den Konjunktiv nicht mehr kennten und nur noch „kommen würden“?
5 Stunden Wager, ewig ists her, dass ich mir dieses Vergnügen live angetan habe… 🙂
Bayreuth bei 40° ist immer noch ein Erlebnis.
Ganze Flaschen Champagner in der LOT-Business-Class? Ist das heute auch noch so?
Ich halte es seit meinem Schlaganfall wie Greta Thunberg und fliege nicht mehr. Allerdings nutze ich das bisher nicht als PR-Effekt. Die Flaschengröße erwähne ich ja im Beitrag: „Kreuzung aus Rentner-Piccolos und den gängigen Dreiviertelliterflaschen“, also ein riesige Piccolo.
Fliegen sollte für die Fluggesellschaften und ihre Passagiere ohnehin so teuer werden, dass sie nur noch stilles Wasser ausschenken können: der Umwelt zuliebe. Champagner bloß noch auf Kreuzfahrten am Markusplatz vorbei.
PR-Effekt trifft es in Greta’s Fall wohl ziemlich gut. Auch wenn es PR für einen vermeintlich guten Zweck ist. In die Hose gegangen ist die Segelfahrt in die USA wohl trotzdem.
FYI https://www.spiegel.de/politik/deutschland/vergesst-greta-thunberg-kolumne-a-1282632.html
Ich teile die Irritation über die touristenverpestete Gelacktheit der Stadtzentren allerorts. Oft trifft man ja tatsächlich nur Touristen an und fragt sich was dieser Teil der Stadt überhaupt mit dem jeweiligen Ort zu tun hat.
Nur leider ist man ja meistens selbst Tourist. Nur besser angezogen …
Hahaha, das Gefühl sich als Tourist über die vielen Touristen zu ärgern kenne ich sehr gut 🙂
Alles ist willkürlich. Ich frage mich, ob das nicht auch ein Kapitel im Lehrbuch LEBEN LERNEN ist.
Damit wären dann allerdings alle Gebete und Bitten an den lieben Herrgott ziemlich nutzlos. Ob die Religion dieses Kapitel gutheissen würden … ich bin etwas skeptisch.
Dass sich Menschen seit Jahrtausenden gegenseitig umbringen, weil sie unterschiedliche Vorstellung darüber haben, was den Sterblichen nach diesem Leben blüht – ich fasse es nicht. Schade, dass man den Selbstmord-Attentätern und Inquisitoren nach deren Tod nicht zurufen kann „Siehste, hier is nix!“. Das wäre mal eine Schadenfreude, die ich genösse. Und nicht mal in die Hölle käme ich dafür.
Jepp, schade eigentlich, dass es nach dem Tod keine Einsicht mehr geben kann.
Das ist der Streich, den uns das Leben spielt. Maximaler Cliffhanger und dann kommt nix…
Unwillkürlich reizt es mich zu widersprechen. Nicht jede Tat ist Willkür. Es gibt Einsicht, Barmherzigkeit, Kunst und die Hoffnung, dass das nicht nur Reflexe sind wie Niesen und Aufstoßen.
Über Schicksal kann man streiten. Aber unsere eigenen Entscheidungen treffen wir immer noch.
Die nonverbale Kommunikation erreicht immer neue Höhen. Heute kommuniziert man mit dem richtigen Blick auf einem gekonnten Selfie. Je nach Plattform (LinkedIn, Instagram, Grindr) weiss man wie man sich angesprochen zu fühlen hat.
Angesprochen, abgesprochen. Ausgesprochen undurchsichtig.