Am Übergang brach natürlich das Grauen über mich herein. Mein Gewissen wird automatisch schlecht, wenn es eine Grenze spürt, was aber völlig nebensächlich ist, weil ich ja weiß, wie nahe selbst dem reinsten Gewissen die Scheiterhaufen der Inquisition und die Gulags Sibiriens sind. Zagend passierte ich die Mauer. Alles war grau, barsch, feindselig. Schaudernd lenkte ich meinen Kadetten in Richtung Marx-Engels-Schlossplatz.
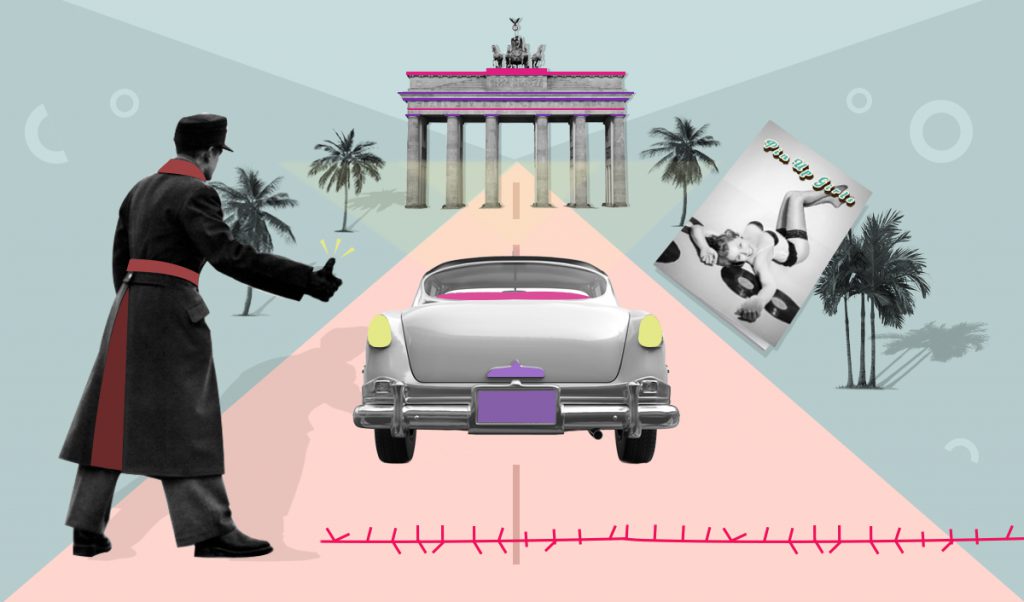

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-11424-0001/CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Irgendwo abseits des kuppellosen Doms parkte ich, weniger wegen des Doms als um des Abseitigen willen. Das Zeughaus ist Unter den Linden das letzte Haus vom Brandenburger Tor aus, also von Charly Marx und Freddy Engels ihrem Platze aus das erste auf der rechten Seite. 1706 wurde es eingeweiht und seither nicht wieder gestrichen. (Scherz!)

Foto: Wikimedia Commons/gemeinfrei
Dreimal umkreiste ich den verlotterten Barockbau, bevor ich den richtigen Eingang für die Transvestitenerteilung fand: Die entsprechende Stelle war auf dem Flur ganz, ganz hinten, aber das ist natürlich relativ, weil von hinten ja hinten vorn ist.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-39881-0002/CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Es war also nicht weiter schlimm im Zeughaus, ich brauchte nicht mal zu zeugen. Ich wurde nur zusammengeschlagen, ausgepeitscht und bekam alle erforderlichen Stempel.

Foto: Gentle07/Pixabay
Danach konnte ich jedoch meine Leidenschaft Plätzen und Straßen gegenüber nicht eindämmen. Ich tobte deshalb die lange Straße herunter. Auf dem Straßenschild stand ,Unter den Linden‘, es hätte genauso gut ,Über den Palmen‘ drauf stehen können. In dieser Gegend weiß der Kundige, dass seit 1933 nichts Wahres mehr auf all den Schildern, Transparenten und Tafeln steht, für die sogar die Bäume umgehauen wurden.
,Solang’ noch Untern Linden die alten Bäume blühn,
kann nichts uns überwinden: Berlin bleibt doch Berlin.‘

Foto: Wikimedia Commons/gemeinfrei
Diese von Walter Kollo bis Paul Lincke und vom Funkturm bis zum Tierpark Friedrichsfelde immer noch mauersprengend gern gehörte Weise ist so komisch wahr: Die alten Bäume stehen nicht mehr; Berlin ist überwunden, und nu jibt es ooch noch zwee davon. Aber das trotzige ‚doch‘ wies ja bereits darauf hin, dass sich der Autor der Zeilen nicht ganz sicher war.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-J30142/CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Tränenüberströmt vom wütigen Zugwind stemmte ich mich bis zur Friedrichstraße an Fassaden entlang, die nur dann schön waren, wenn sie weg waren: Da konnte man sich wenigstens noch was hinträumen. Ich ging die Friedrichstraße, eher das, was davon übrig ist, bis zur Französischen, lief wieder an den Kirchtrümmern mit dem großen Bau dazwischen vorbei, da, wo ,U-Bahn Mitte‘ steht, aber nicht ist. Die Treppe nach unten ist vergittert. Sie sind dort am Restaurieren. Ich habe auf dem Plan nachgesehen, was es mal war. Es muss der Gendarmenmarkt sein. Diesen Verdacht sehe ich dadurch bestätigt, dass es dort genauso viele Gendarmen gibt, wie Linden unter den Gleichnamigen.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-67040-0002 / CC-BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Ich stieß unbeirrbar auf die Leipziger, ging zum Spittelmarkt, den Eduard Gaertner recht frohgemut zu malen wusste, um dort die letzte Bestätigung zu finden, und ich fand sie. Auf dem Spittelmarkt gibt es kein Spittel! Nun habe ich die sowjetische Besatzungszone endgültig durchschaut: Da gibt es gar nichts von dem, was die Straßenschilder behaupten. Zufrieden und enttäuscht trottete ich zum Dom zurück, alles ziemlich abscheulich: dreckig, verkommen, hoffnungslos. Falls es in diesem Viertel jemals nicht nur lebendig, sondern auch schön gewesen sein sollte, dann muss da aber viel Pracht versunken sein.

Foto: Wikimedia Commons/gemeinfrei
Berlin, so wie Gaertner es gemalt hat, ist es mir reaktionäre Sau fast immer noch am liebsten: herrschaftliche Gebäude, Menschen nur als Staffage, aber adrett gekleidet – Biedermeier mit Abgründen, nicht wie jetzt: geheimnislos und trotzdem bedrohlich. Gaertner hatte zwölf Kinder – arme Frau! Nach dem Tod ihres Mannes erbat Henriette Gaertner den Künstler-Unterstützungsfond der Akademie der Künste um eine jährliche Beihilfe von 150 Mark. Ihr Antrag wurde abgelehnt. Gute alte Zeit! In der neuen Zeit ist die ostdeutsche Antwort auf Che Guevara zu bewundern: die fortschrittliche Elite des Sozialismus.

Foto: picture-alliance/dpa
Nach eingehender Kontrolle war ich knapp dem Osten entronnen, da fragte mich Brauner in seiner knoblauchgeschwängerten Diele an der Koenigsallee, ob ich ihn nicht am Abend zum Ostbahnhof (ehemals Schlesischer Bahnhof) fahren könne. Sein Zug: 22:30 Uhr. Ich sagte entsetzt zu. Schließlich wohne ich in der Nähe, wenn auch etwas feiner, am stilleren Ufer des Koenigssees, und wenn mein freundlicher Nachbar, Guntrams Prokurist Herr Schönhorst, schon meint, man habe Brauner zu vergasen vergessen, dann kann ich ihm nicht auch noch die Anfahrt nach Polen verweigern. Vom Übergang ist der Ostbahnhof nicht weit. Eine Station hinter Jannowitzbrücke, entgegengesetzt vom Alexanderplatz (wissenswert für sozialistische Bahnfetischisten).

Foto oben: Wikimedia Commons/Frits Wiarda [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] |
Foto unten: Wikimedia Commons/Frits Wiarda [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Punkt halb zehn war ich bei ihm. Er schien es allerdings weniger eilig zu haben als ich. Dreiviertel zehn fuhren wir los. Am Ku’damm befahl er mir: „Links ab!“, und ich erwartete nun Grauenhaftes aus einem seiner Spionagefilme. Irgendwo ließ er mich halten, entstieg, verschwand mit einer jungen Dame im Hauseingang, kehrte nach vollbrachter Tat zurück und weiter ging’s zu Heini Heines Straße. Dort bellte der erste Kontrolleur an der Schranke, Brauner als Berliner müsse Friedrichstraße rüber, ich käme nach zwanzig Uhr gar nicht mehr rein, und regte sich auf, als ob wir ihm die Sowjetunion wegnehmen wollten. Brauner brabbelte was vom polnischen Innenminister, der andere verteidigte weiterhin zäh sein Territorium, Brauner murmelte in keiner mir verständlichen Sprache Erregtes; auch Fetzen aller möglichen Weltreligionen glaubte ich aufzuschnappen, dies umso mehr, als er dazwischen dauernd „um Gottes willen!“ schrie.


Foto links: Wikimedia Commons/gemeinfrei | Foto rechts: Denis Apel/flyingpixel.de/Wikipedia
Endlich gab der Kontrolleur seinen Staat preis: Wir durften in die Baracke. Brauners Hab wurde beschlechtachtet, mehr noch aber sein Gut: Im Koffer unzählige ,BRAVOS‘ und französische Schweinemagazine, die die Beamten so lange durchgierten, bis er sie ihnen entriss, mir in die Arme schmiss und japste, ich solle sie wieder mitnehmen. Für ihn war eine Taxe am anderen Ende der Welt bestellt, mich schickte man fort, was ich nicht als ehrenrührig erlebte, sondern mir kein zweites Mal sagen ließ.

Fotomontage oben: VIACHESLAV MATIUKHIN/Shutterstock | Foto unten:Gerd Danigel , ddr-fotograf.de, Bornholmerstraße Grenzübergang 1984, /bearbeiten, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Ich wendete und passierte gänzlich ohne jede West- und Ostkontrolle. Es war wirklich verblüffend, zumal ich dabei die ganze Zeit an der Hand aus einer Schnittwunde blutete, die keine Ruhe gab. Der Schnitt kam bestimmt von keiner der ‚BRAVOS‘, sondern von einem dieser Pornos. Waren da nicht Fräuleins mit Rasierklingen zwischen den Schamlippen abgebildet gewesen? Ich ging meinem Verdacht nicht weiter nach, sondern beschränkte mich aufs Fahren und Bluten. Mein Auto sah aus, als hätte ich einen Mauertoten dabei. Als ich am nächsten Tag bei Brauner zu Hause die Hefte ablieferte und nachhakte, ob er den Zug denn noch bekommen habe, sagte die Putzende: „Ick weeß von nischt. Dea Herr Brauna is nich da. Dea is in Warschau!“

Foto: Privatarchiv H. R. | Titelillustration mit Bildern von Shutterstock: Rob van Esch, Petrenko Andriy, Everett Historical, Pack, Dimitris Leonidas, gan chaonan
Das Bild zeigt mich als Putzfrau, genau zehn Jahre später.

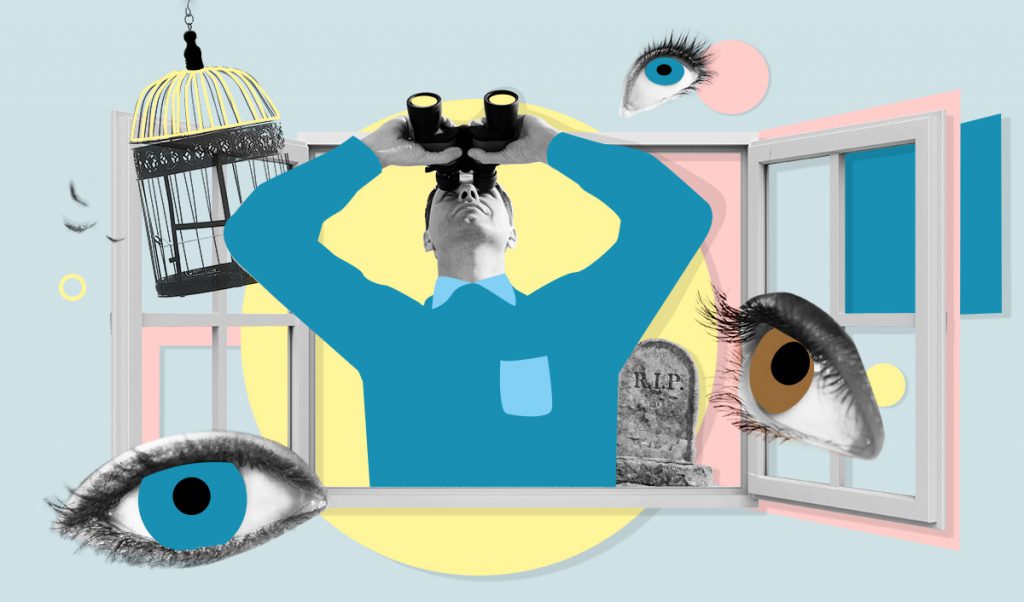


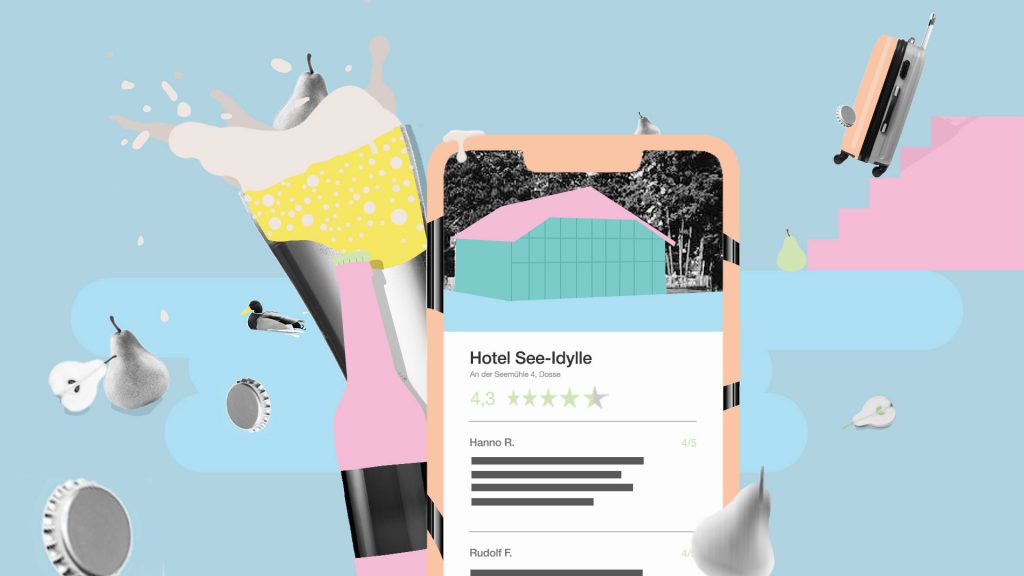



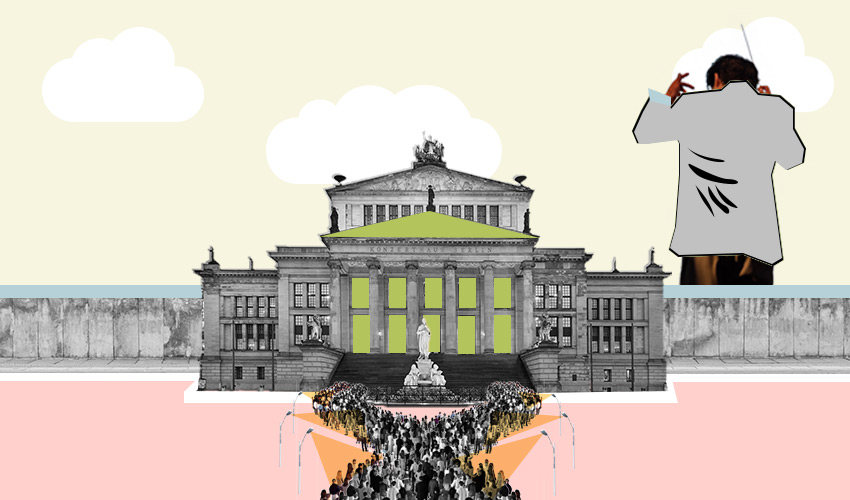

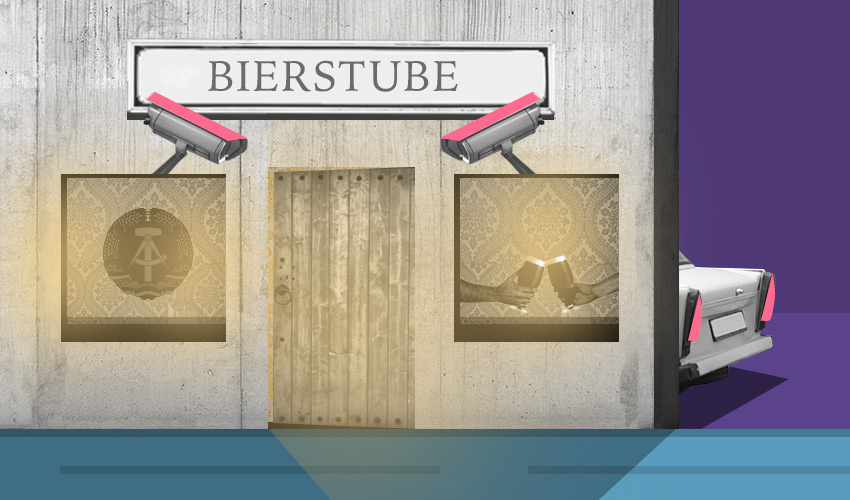













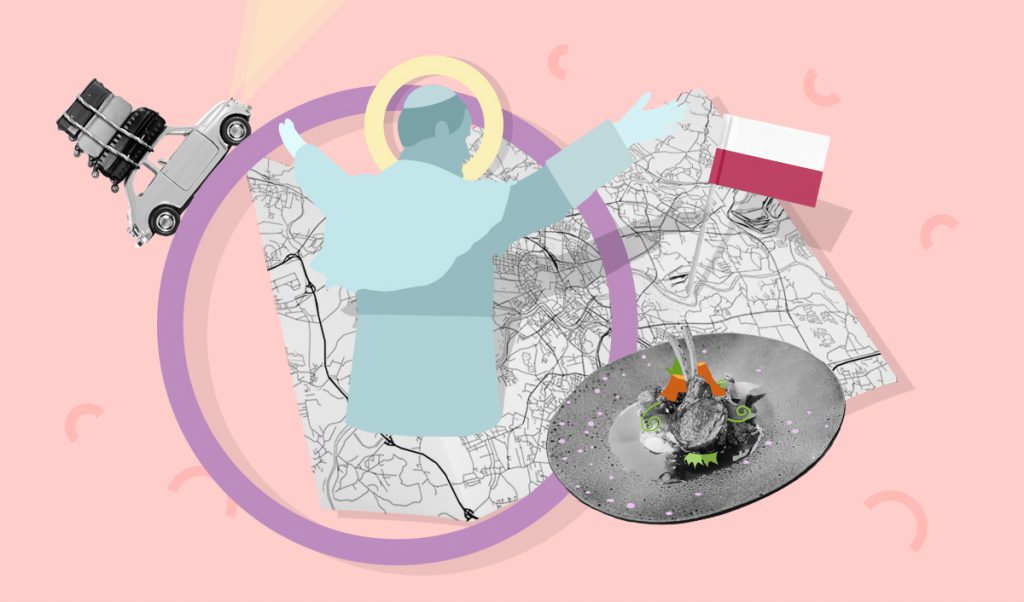

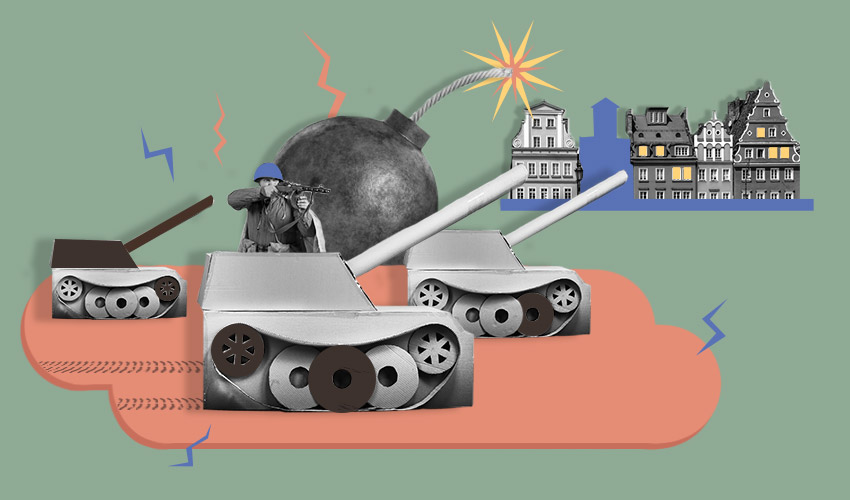





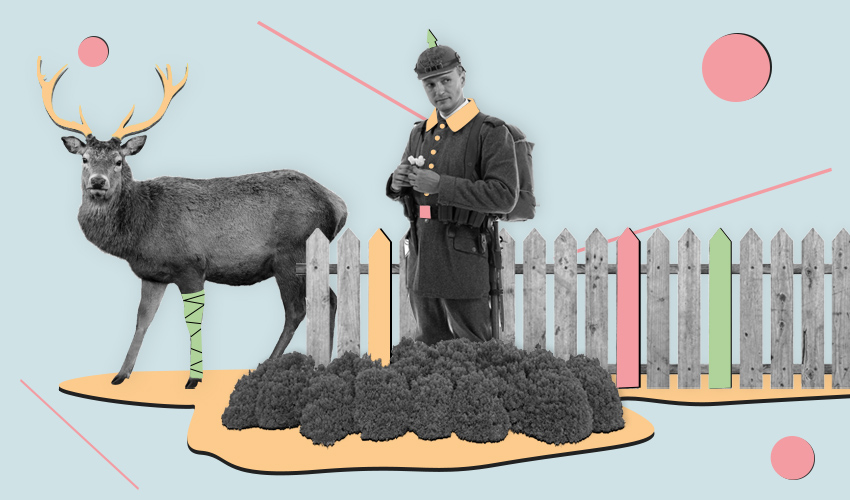


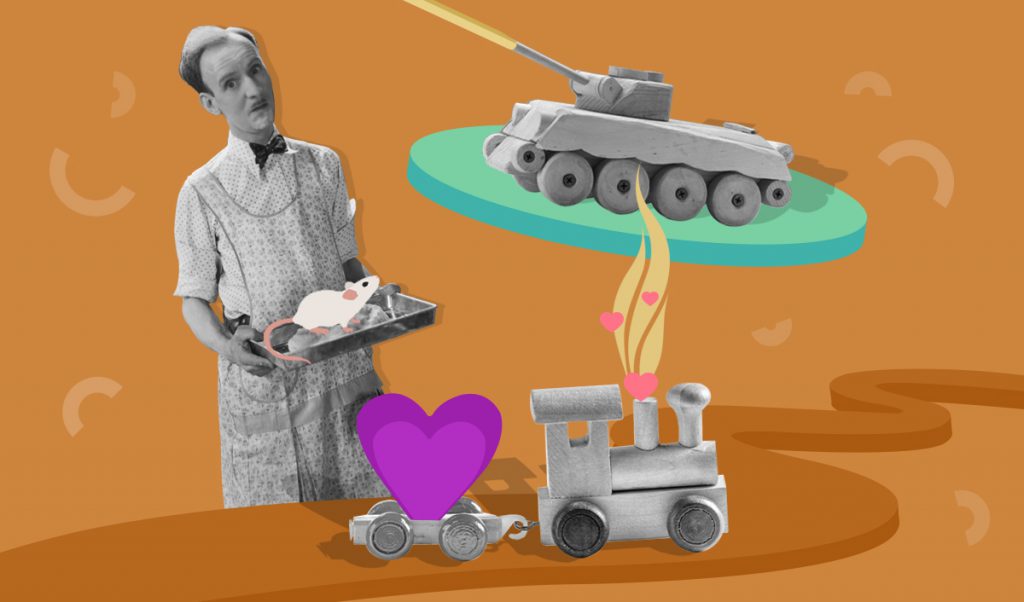





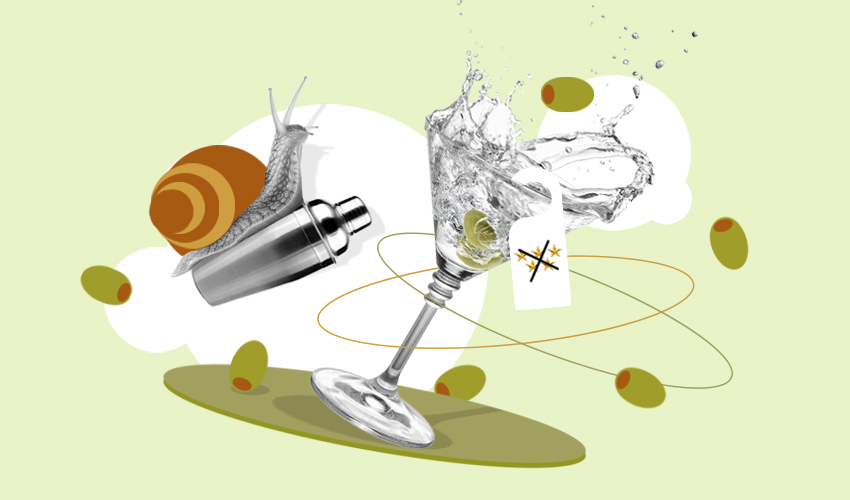





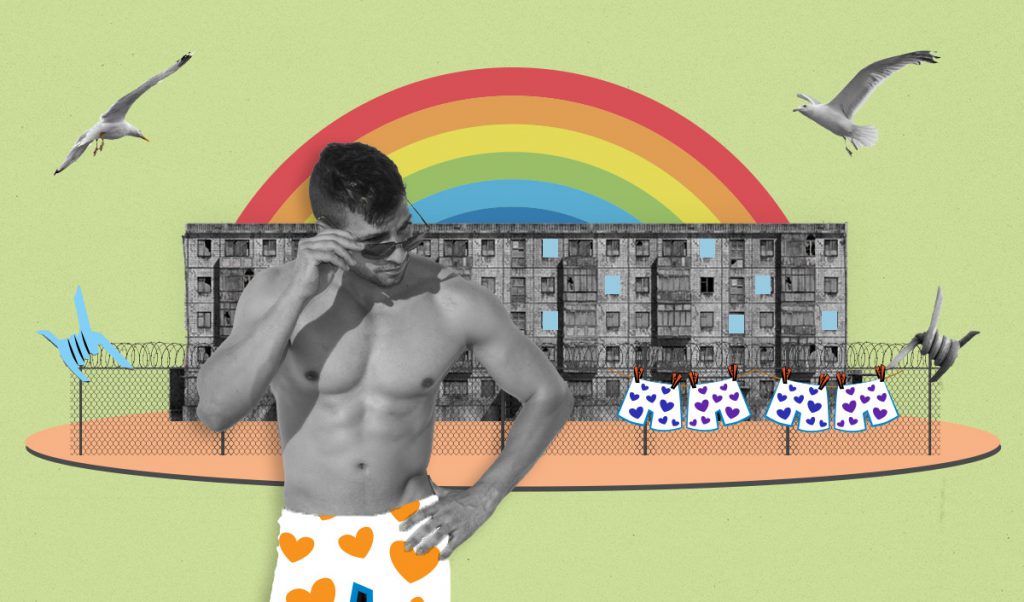





Grenzübergangs-Posse mit französischen Schweinemagazinen. So stell ich mir die DDR vor 🙂 Hahaha
Leider war es nicht nur witzig damals. Gerade an der Grenze nicht.
Schon interessant, dass gerade die Bevölkerungsgruppe, die jahrelang von einer Mauer umgeben leben musste, nun die AfD wählt.
Ohne Süffisanz gehe ich auch – 52 Jahre nach dem Vorfall – davon aus, dass das Material von den Polen erbeten war oder der erklärenden Vorbereitung einer Ko-Produktion dienen sollte. Erstens waren „frivole Hefte“ damals viel harmloser als heute. Zweitens hat Brauner mit dem Geld, das er an seinen Schnulzen verdiente, sehr beachtliche Filmprojekte finanziert.
Aber wie weit ist Gaertners Berlin entfernt von dem Berlin, das ich kenne.
wie weit denn? sehr weit nehm ich an?
Städte, die immer noch so aussehen wie vor zweihundert Jahren, sind von Touristen überlaufen und leben davon, Museums-Aldi zu sein.
Auf den Punkt. Deshalb hadere ich auch mit Rom, Budapest, Barcelona, Wien. Alles tolle Städte, aber es hängt immer etwas museales in der Luft.
Ja. Aber wenn originelle Konzepte nicht eingereicht wurden, ziehe ich doch restaurierbares Altes dem phantasielosen Neuen vor.
Wer mir sagt Berlin ist hässlich, den schicke ich gleich mal zum Dom, am Lustgarten vorbei, durch die Museen, über/unter den Linden entlang… Es gibt nicht nur Plattenbauten in der Hauptstadt.
Joa gibt halt beides ne. Für jeden Geschmack was dabei.
Wer andere Großstädte kennt, die sich auf Park-Oasen beschränken, weiß Berlins grüne Alleen zu schätzen.
So ist es. So grün wie Berlin sind andere Großstädte nämlich wirklich selten.
Bravos im Koffer von Brauner? Ich bin geplättet. So richtig passt das eigentlich nicht in meine Vorstellung.
Man erinnere sich an die Zeiten als so etwas wie die Bravo noch skandalös war. Heutzutage schaut man eher Pornos auf dem Schulhof. Sicherlich keine sonderlich positive Entwicklung.
Stimmt. Man hat irgendwie das Gefühl, das die Jugend trotz unendlicher Informationsmöglichkeiten weniger aufgeklärt ist.
Tabulos macht lustlos.
Hahaha, selten so was Wahres gehört 😉
Das schlechte Gewissen an der Grenze bzw. jedes Mal wenn ich am Flughafen durch den Zoll muss kenne ich auch. Obwohl es keinen Grund gäbe. Woher das wohl kommt?
Die katholische Erziehung vielleicht? 😉
Also, ich jedenfalls war viel katholischer als meine Eltern. Trotzdem mochte ich meine Untaten. Ich wollte bloß nicht erwischt werden, und diese Befürchtung hat sich an Grenzen einfach verselbständigt.
Ich denke manchmal das ist was kafkaeskes. Man traut den Beamten einfach die totale Beliebigkeit zu und kommt allein dadurch ins schwitzen.
Habe ich denn etwas verpasst? Ich dachte „Unter den Linden“ wird seit den dreißiger Jahren konstant mit neuen Silberlinden nachbepflanzt?
Dreißig Linden machen noch keinen Tiergarten, aber Berlin hat mehr Bäume als Venedig Brücken. In NS- und SED-Zeiten waren natürlich Plakate wichtiger als Pappeln. Hat trotzdem nichts genutzt.
Ich fand Berlin immer so überbewertet. Weltstadt im Kleinformat halt. Aber man muss ja nicht überall übereinstimmen. Sonst wäre es ja langweilig.
Jeder hat seine Vorlieben. Zum Glück, sonst würde es nicht nur langweilig sondern auch recht voll 😉
Welche deutschsprachige Stadt ist „Großformat“, und woran beurteilen die Einheimischen und Ausheimischen das?
So viele ‚Weltstädte‘ gibt es im deutschsprachigen Raum auch gar nicht.
Ich freue mich ja über jeden, der Berlin überbewertet findet. So wird die Stadt wenigstens nicht so sehr überlaufen wie Paris oder London. Die relaxte Atmosphäre macht Berlin doch gerade besonders.
!
In der Politik, in der Wirtschaft und auf Wohnungssuche finden einige Berlin nicht „relaxt“, sondern anstrengend. Andererseits können es für Beherbergungs-Gewerbe, Gaststätten und Einzelhandel nie zu viele Gäste sein: Hauptsache, die Ankömmlinge haben Geld und Lust, es auszugeben.