Harry Kraut war Leonard Bernsteins Manager und krank geworden. So blieb er mit Grippe im Hamburger Hotelbett liegen, statt den Maestro weiter zu begleiten: nach Berlin. Wer sollte nun diese große Verantwortung übernehmen? Da fiel Harry nur einer ein. Also gut. Zum Besten meiner Künstler gehe ich gern durch die Hölle, denn schließlich ist das eine meiner wichtigsten Strategien, um in den Himmel zu kommen. Zunächst mal aber musste ich für meinen Künstler Bernstein nicht in die Flammen, sondern aus Westberlin in die DDR: So wie die stelle ich mir Fegefeuer vor, wenn das Brennmaterial ausgegangen ist.
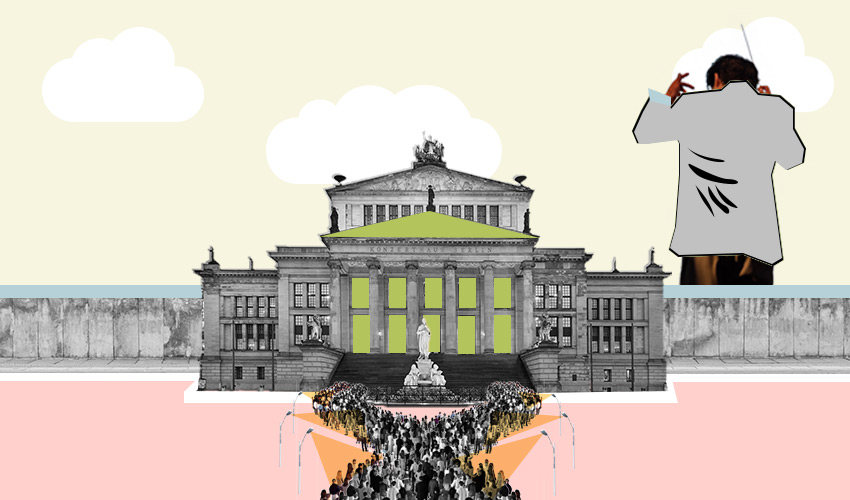
Von solchen Erlebnissen kann ich viele ausgraben. Ich beschränke mich auf nur ein weiteres, siebzehn Jahre später, im Oktober 1984:

Foto: Bundesarchiv/Wikimedia Commons
Um Bernstein auch im Osten auf den Fersen bleiben zu können, brauchte ich eine Sondergenehmigung, denn es war klar, dass er nicht vor Mitternacht in den Westen zurückkehren würde, ich aber hatte vor Anbruch des neuen Tages die Hauptstadt der DDR zu verlassen: Tagesvisum eben. Kühner noch: Ich musste in Bernsteins Limousine den Checkpoint Charly passieren, der nur für Ausländer bestimmt ist, denn die Be-Er-De gilt – merkwürdig genug – in dieser Beziehung nicht als vom anderen Deutschland unabhängiger Staat, obwohl die DDR sonst doch mit (Sowjet-)Macht auf ihre Souveränität pocht.

Foto: Bundesarchiv/Wikimedia Commons
Ich hatte schon in Hamburg ein paar Mal mit dem US-Konsulat gesprochen, das einen Kilometer stadteinwärts von meinem Bürozimmer an der Alster rumliegt. Aber die (Un)Befugten hatten mich schließlich an Westberlin weiterverwiesen, doch den US-Repräsentanten dort, diesen bösen Tanten, war mein – also Bernsteins – Schicksal völlig egal. Schließlich sagte mir irgendjemand, dessen Zuständigkeit ich fernmündlich nicht anzweifeln konnte, dafür müsse ich mich an die US-Botschaft in Ostberlin wenden. Na, das tat ich dann auch, auf meinem ‚Kempinski‘-Hotelbett sitzend. Die US-Pressesprecherin war natürlich über den Gastauftritt bestens – für sie also schlechtestens – im Bilde und in ihrer ostzonalen Ruhe empfindlich gestört. Sie versprach dennoch, mir einen Passierschein zu besorgen.

Foto: Photographee.eu/Shutterstock
Wie in solchen Fällen üblich passierte nichts, jedenfalls nichts, wovon ich etwas mitbekam, und als ich zwei Stunden später wieder anrief, sagte sie, ja, ja, das sei schon in Ordnung, ich könne ‚da durch‘ mit Bernstein. „Was, einfach so?“, fragte ich erstaunt. „Ja“, sagte sie auf Deutsch, „wir haben das gemeldet, das ist okay.“ Ich blieb ungläubig, aber was sollte ich machen? Mehr konnte ich nicht erreichen. Ich konnte nun entweder die letzte S-Bahn ab Friedrichstraße nehmen und am nächsten Tag Bernsteins Manager Harry zerknirscht beichten, dass Lennie sich, nachdem ich ihn im Stich gelassen hatte, so unmöglich benommen habe, dass die Gastspiele der nächsten Jahre in Sibirien stattfinden würden. Oder ich riskierte das Äußerste. Dazu entschloss ich mich dann und kam mir vor wie Paul Newman in Hitchcocks „Zerrissenem Vorhang“.

Foto: FOX/Pexels
Ich fuhr per S-Bahn ab Savignyplatz. Da bin ich mit allen möglichen Zielen fast genauso häufig eingestiegen wie pflichtbewusst in Othmarschen. Diese ‚Einreise‘ über Friedrichstraße ist immer ein Albtraum. Während der Grenzbeamte Passbild und Physiognomie vergleicht, fallen einem gleich alle Straftaten ein, die man nicht begangen zu haben hofft. Der Weg die Friedrichstraße hinunter zu den ‚Linden‘ ist an Trostlosigkeit nicht zu überbieten. Die einzige Steigerung wären noch ein paar aufgehängte Deserteure an den Laternenmasten vom vorigen Regime. Terror und Horror hängen nach wie vor in der Luft, und man weiß nicht, ob man sich mehr vor der Vergangenheit gruselt oder vor der Gegenwart.

Foto: Bundesarchiv/Wikimedia Commons, bearbeitet
Ich war mit Tontechniker Jobst Eberhard im ‚Hotel Unter den Linden‘ verabredet. Dieser Prachtbau sozialistischer Gastfreundschaft sieht von außen aus wie die Vielzweckhalle einer Flüchtlingssiedlung, von innen nur unwesentlich schlimmer.






Fotos (6): H. R./Privatarchiv | Foto unten: Bundesarchiv/Wikimedia Commons

Im dortigen Sperrmüll-Café saß Jobst mit einem hübschen, schnauzbärtigen Freund aus Ostberlin, den er bei Brahms-Aufnahmen in Prag kennengelernt hatte. Thomas wollte sehr gern weg aus Ostberlin, wofür ich viel Verständnis, aber gar keinen Ratschlag hatte, zumal ich selber ja nicht genau wusste, wie ich da wieder rausgeraten würde. Während unseres Gesprächs in der gut besuchten Örtlichkeit sah sich der Fluchtwillige dauernd so verstohlen um, als hätte er sich heimlich ein Stück Buttercremetorte in seine Hosentasche gestopft. Ich wurde auch schon ganz hibbelig und überlegte mir vor jedem Satz genau, was ich sagen würde. Eine Neuerung, die ich vielleicht beibehalten sollte.

Foto: Bundesarchiv/Wikimedia Commons
Viel Zeit war sowieso nicht, denn dann mussten wir zum ‚Platz vor dem Schauspielhaus‘. Dieser geschraubte Name war den Herrschenden notwendig erschienen, weil der ursprüngliche Name ‚Gendarmenmarkt‘ ihnen offenbar mindestens so auslöschenswert vorkam wie die Potsdamer Garnisonskirche. Warum die Verantwortlichen das von nicht besonders vielen Häusern beeinträchtigte Geviert nicht einfach in ‚Volkspolizistenmarkt‘ umbenannten, ist eines der vielen Rätsel, die mir dieses Regime aufgibt.

Foto: Bundesarchiv/Wikimedia Commons
Einige Häuser gab es aber doch und die waren in der offenbar neu erfundenen Stilrichtung ‚Platte antik‘ gefertigt. Man hatte also höherenorts den gestalterischen Aufwand genehmigt, die Betonquader mit Mustern zu versehen, so dass für Blinde der Eindruck entsteht, Gebäude von früher vor sich zu haben.

Foto: AjayThomas/Shutterstock
So wenige Häuser, so viele Menschen. Das Schauspielhaus selbst ist äußerlich möglichst ehrwürdig und innen sensationell bunt wiedererstanden, und wenn die beiden Dome rechts und links genauso originalgetreu errichtet werden, dann kann das ein schöner Platz werden, vorausgesetzt, die Idee dieser albernen Disney-Häuser rundherum wird nicht weiterverfolgt. Potemkin wäre von Katharina der Großen dafür gefeuert worden.

Foto: -jkb-/Wikimedia Commons
Wie alles in der DDR stimmt nichts: Das ‚Schauspielhaus‘ ist eine Konzerthalle, Honeckers klassizistisch-revanchistische Antwort auf die kühn-moderne Philharmonie knapp westlich der Mauer. Auch vielen Westberlinern gefiele so ein Traditionsbau vielleicht besser, aber nur in einer Diktatur lässt sich das erzwingen. Im Westen wählen Stimmberechtigte selbst ganz legal ihre Vertreter, die anschließend etwas ganz anderes beschließen können als das, was ihren spießigen Wählern gefällt. Hier nicht. Trotzdem Riesenandrang: Menschen auf den vielen, vielen Stufen der breiten Treppe zum Foyer, Menschen auf dem Platz davor und eine lange Schlange seitlich, dort, wo sich auch der gut sichtbare Künstlereingang befindet.

Foto: Bundesarchiv/Wikimedia Commons
Es war nun meine heikle Aufgabe, Frank und Lutz in dieser Menschenmenge ausfindig zu machen, um ihnen die von Harry versprochenen Karten zu überreichen. Was mir meine Mission erschwerte, war, dass ich mir zwar die von Harry genannten Namen gemerkt, aber die beiden Herren noch nie gesehen hatte. Während Irene und ich im Mai bei Bernstein im ausgedörrten Tel Aviv zurückgeblieben waren, hatte sich Harry mit dem Flugzeug nach Budapest abgesetzt, um dort für das kommende Jahr Konzerte zu organisieren. Dabei war er über das urlaubende Freundespaar aus Ostberlin gestolpert, das sich ihm gegenüber sehr aufgeschlossen gezeigt hatte und nun dafür mit Eintrittskarten entgolten werden sollte.

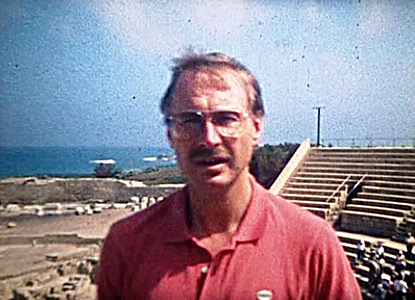

Fotos (3): Privatarchiv H. R.
Doch zunächst einmal musste ich zum Maestro durchdringen. Weil ich nichts Effektvolleres vorzuweisen hatte, benutzte ich dafür meine ‚Deutsche Grammophon‘-Visitenkarte, und da ich dem Türsteher nicht so ehrerbietig entgegentrat, wie er das von seinen Landsleuten gewohnt war, ließ er mich auch – mit einer gewissen Bitterkeit um die Mundpartie – passieren.

Foto: pxhere/gemeinfrei
Dass Bernstein tatsächlich den Weg aus der Fasanenstraße durch die Mauer bewältigt hatte, war mir gleich zu meiner Erleichterung aufgefallen, als ich den fetten Mercedes neben der schmächtigen Tür gesehen hatte. Ich kenne – Gott sei’s geklagt – viele Künstlereingänge vieler Länder: Sie sehen ausnahmslos aus wie Dienstboteneingänge, durch die alle Stars aller Abende wie Reinigungspersonal in die Stätte ihres Triumphes Einzug halten müssen. Nur dem Umstand, dass immer mal wieder auch eine Harfe da durchgetragen wird, ist es zu verdanken, dass sogar betagte Wagner-Sänger in ihre Garderoben gelangen können, ohne sich im Türrahmen zu verklemmen. Zugegeben: Das Bild jetzt ist etwas übertrieben.

Foto: bablab/Fotolia
Für den kleinen, bis auf sein Bäuchlein schlanken Bernstein kein Problem, und so saß er auch schon, nicht schlimm gelaunt, in dem ihm zugewiesenen Raum, wie üblich umlagert von jungen Männern und reifen Frauen. Auf dieser Reise hat er nicht, wie sonst meistens, einen als Dirigier-Eleve bezeichneten jungen Blonden dabei, sondern einen nussknackerigen Mittdreißiger, von dem ich mir immer noch nicht darüber im Klaren bin, ob Dean (‚Dekan‘) sein Name oder sein Beruf ist. Ich glaube, hinter dieser Verschleierung steckt Methode. Allerdings wirkte er mehr wie ein geiles Luder als wie ein aufgeschlossener Geistlicher.

Foto: muro/Fotolia | Titelillustration mit Bildern von Viktor Birkus/Shutterstock, pixelklex/Shutterstock, andersphoto/Shutterstock, Quality Stock Arts/Shutterstock
#2.6 Schmutzige Bilder, blankes Grauen#2.8 Symbolfigur der freien Welt

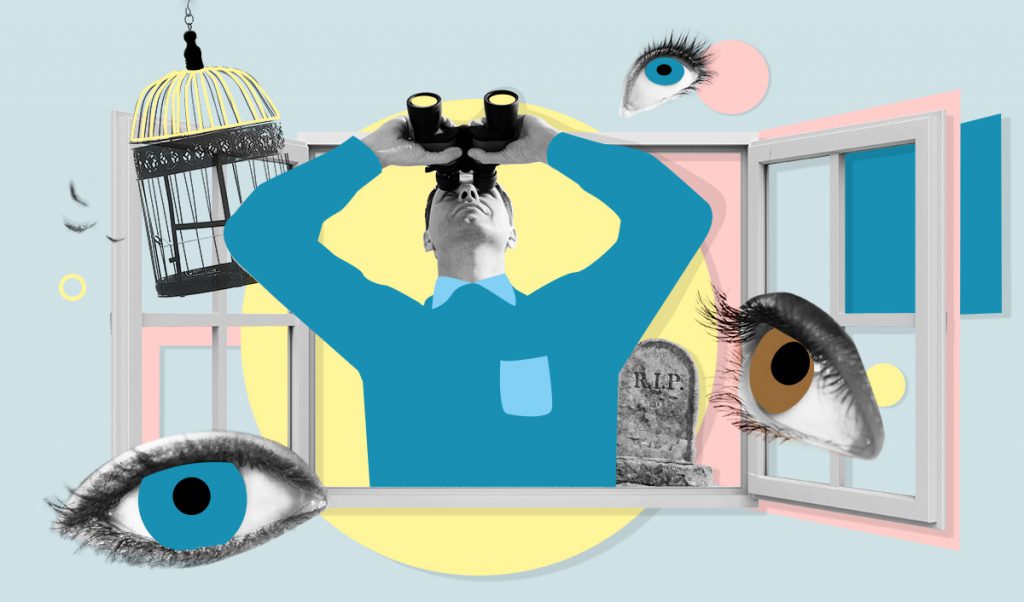


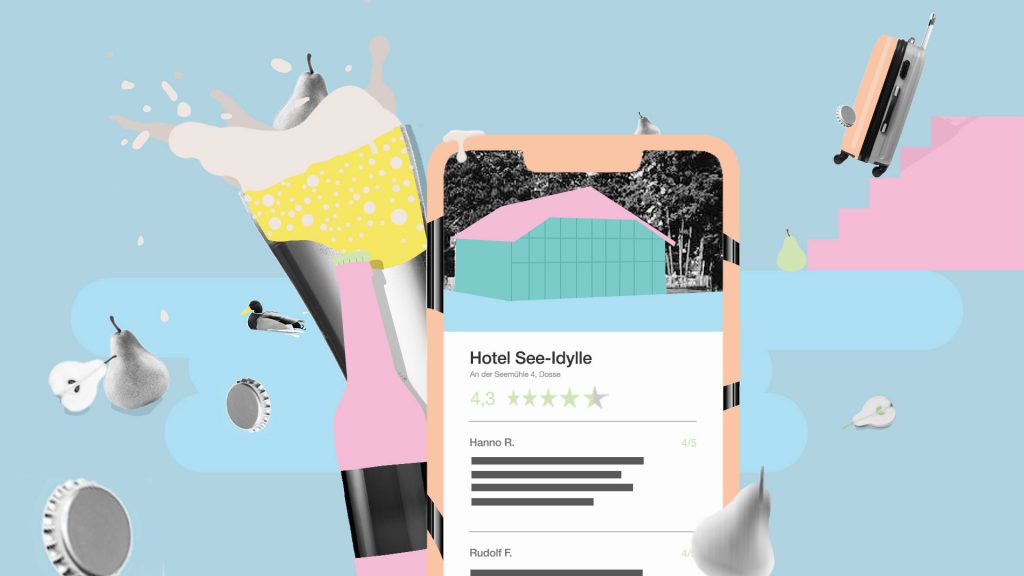



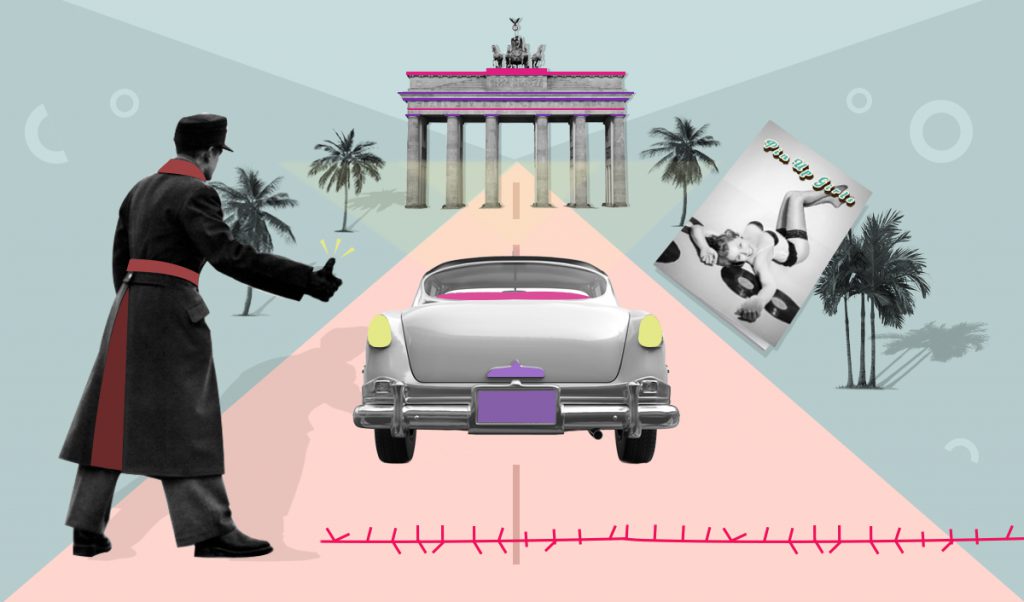

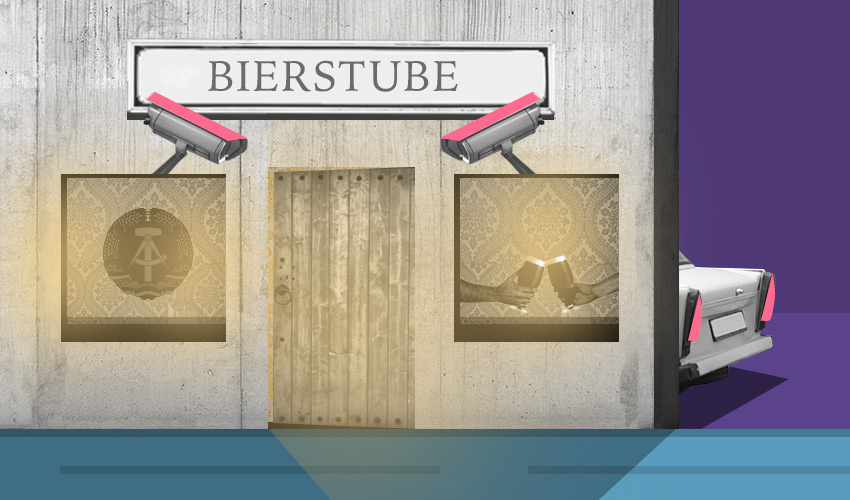













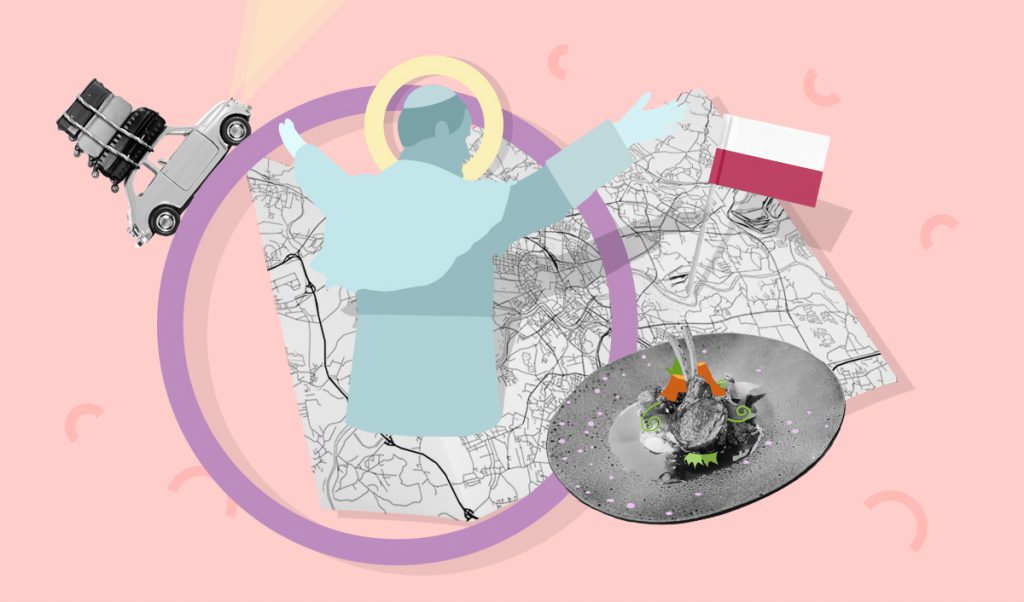

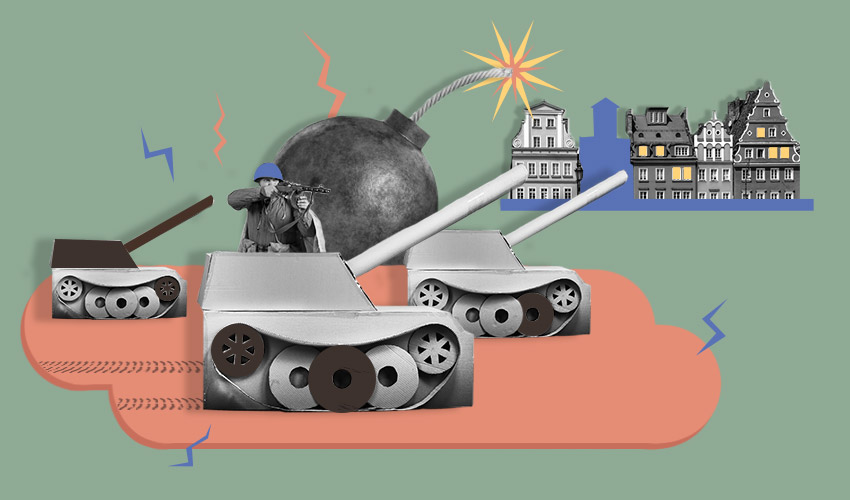





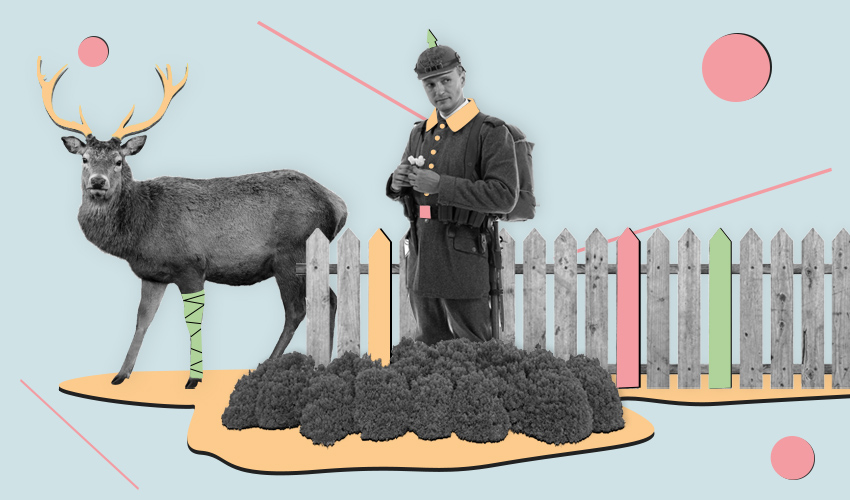


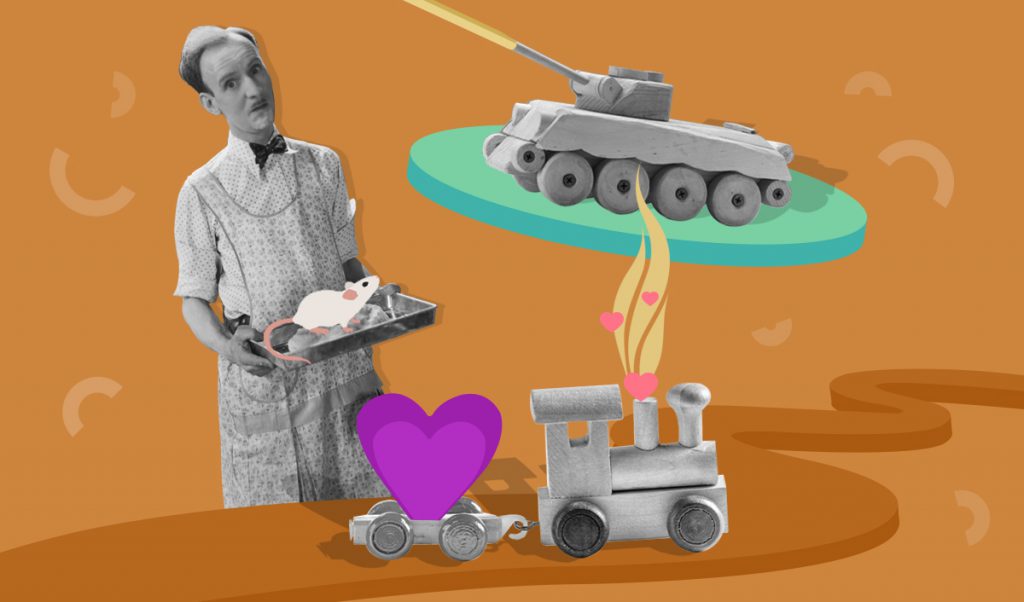





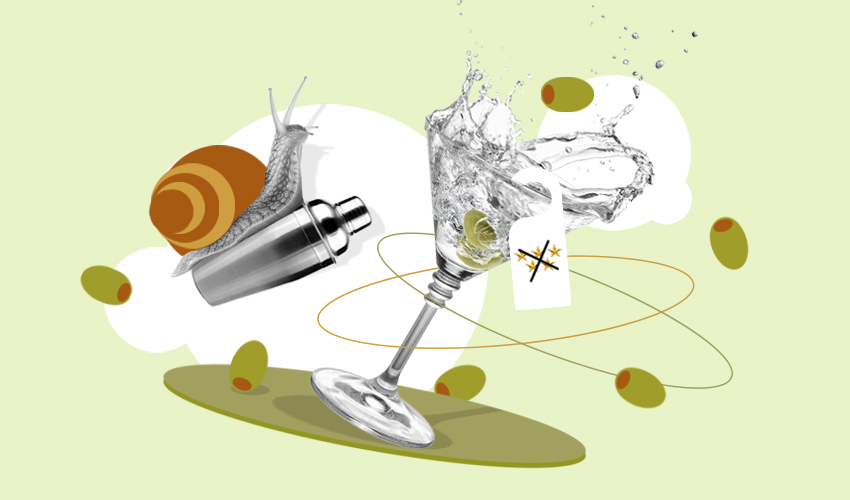





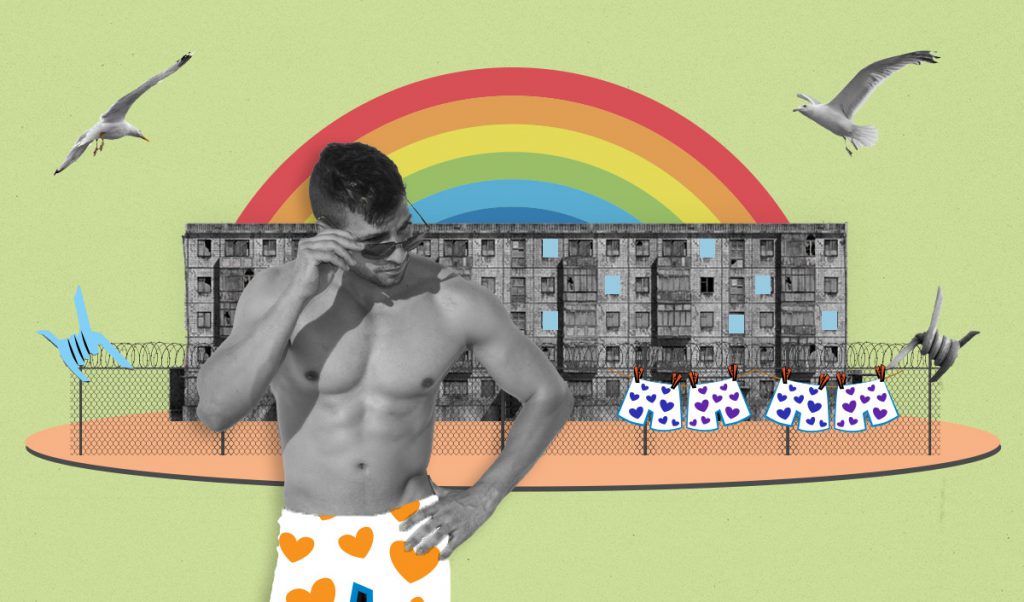





Zwischen einem geilen Luder und einem Geistlichen gibt’s ja eh oft genug keinen Unterschied.
Der zerrissene Vorhang ist übrigens wohl einer der am meisten unterschätztesten Filme Hitchcocks.
Naja, darüber kann man streiten. Ein recht platter Spionage-Thriller für Hitchcocks Verhältnisse würde ich ja sagen. Jedenfalls sagt man, dass Hitch nicht sonderlich begeistert von Newman und Julie Andrews war.
Noch schlimmer sind die nicht authentischen DDR-Sequenzen. Spannend fand ich es trotzdem, mit sehr viel besserem Ende als beim Spionagefilm „Topas“.
Oh an Topas erinnere ich mich so gut wie gar nicht mehr. Dabei mag ich sein Spätwerk eigentlich.
Platte antik ist super 🙂 Da weiss ich sofort was Sie meinen!
Wie in solchen Fällen üblich passierte nichts. Der alltägliche Verwaltungswahnsinn schlägt nämlich immer in gleicher Weise zu. Nicht nur in der DDR. Ein großer Graus.
Ich bin immer wieder fasziniert wie unser Gehirn funktioniert. Wie beim Überfliegen des Artikels die Wörter zusammengesetzt werden so wie sie scheinbar am meisten Sinn ergeben. Oft entstehen die Surrealsten Dinge. (Harry Kraut war Leonard Bernsteins Krankenpfleger und mager geworden.)
Wenn Artikel über den Zustand der Welt nur überflogen werden, kann das Ergebnis den Leser in ganz falsche Richtungen führen. Wie mein Vater es formulierte: „Händedruck und Hundedreck ist nicht immer dasselbe.“
Informierter wird man durch’s Überfliegen nur wenn man wahnsinnig konzentriert dabei ist. Ansonsten dient es wohl eher der Unterhaltung 😉
Was für ein Glück, dass die Zeiten von Passierscheinen, Grenzübergängen und dem damit verbundenen Behördenwahn (vorerst) erledigt sind. Es muss ein Witz sein, dass manche Menschen zurück zu diesen Zeiten, zu mehr „Unabhängigkeit“ wollen.
Um auf Ihre Fragestellung weiter oben einzugehen: Mich gruselt es tatsächlich mehr vor der Gegenwart. Rückblickend kann man immer sagen, dass man es nicht besser wusste, oder dass man keine andere Wahl hatte. Zumindest mit sehr viel Wohlwollen erklärt sich so einiges. Wer aber auch heute noch das Geschehene verteidigt, ja sogar wieder zurück zu denselben Ideen will, der löst nicht nur Unverständnis aus, sondern der macht mir Angst.
@ Sarah Ostermann und Markus Klein:
Ich bin gar nicht so sicher, ob jemand zurück zu Grenzkontrollen will. Jedenfalls nicht in diesem bürokratischen Sinn. Die meisten AfD-Wähler haben doch schlichtweg Angst vor Veränderung. An die Konsequenzen vom neuen Nationalismus denkt doch keiner wirklich.
Viele wollen „best of both worlds“. Die Freizügigkeit des Kapitalismus gepaart mit der Sicherheit des Sozialismus. Mit einem Sparbuch wird man nicht reich, und mit Akien oder einem Start-up kann man alles verlieren – allerdings auch so viel gewinnen, dass die, die nichts riskiert haben, das ungerecht finden.
Verwöhnte Demokratie-Gören!
Die meisten wollen halt Bequemlichkeit. Da passt Veränderung nicht so richtig dazu.
Und wieder dieser Harry Kraut, dessen Name in jedem Spionage-B-Movie ein Renner wäre…
Künstler sind ja immer auch irgendwie Dienstboten.
Diener der Kunst. Ob sie sich selbst auch so sehen!?
Bestimmt! So wie Politiker sich als Diener des Volkes sehen.
Hahahaha, guter Punkt!
Marie von Ebner-Eschenbach hat so viel Schlaues zur Kunst und zum Verhältnis von Künstler/Publikum gesagt. Zum Beispiel:
– Künstler haben gewöhnlich die Meinung von uns, die wir von ihren Werken haben.
– Am unbarmherzigsten im Urteil über fremde Kunstleistungen sind die Frauen mittelmäßiger Künstler.
Fabelhaft!