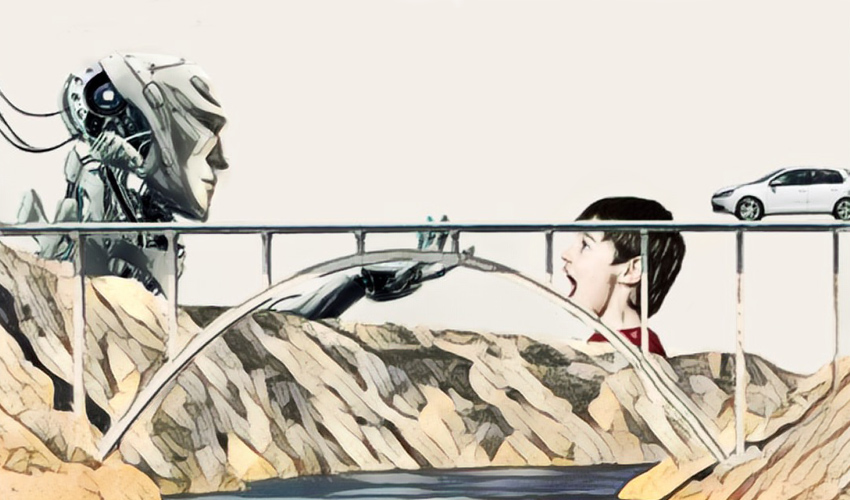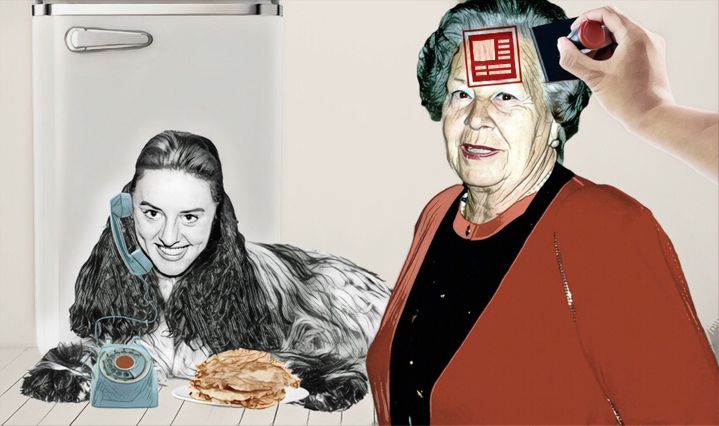Sonntag, 17. Juli
Um 10 Uhr waren wir schon wieder in Slowenien. Wir hatten es geschafft, uns eine halbe Stunde eher als vom Plan befohlen, auf den Weg zu machen. Rafał hatte meine Habseligkeiten eingesammelt und verstaut, während ich in mein ‚Reisekostüm‘ geschlüpft war: taubenblaue Jeans, taubenblaues Polohemd, taubenblauer, serviettendünner Pullover über den Schultern. „Ton in Ton“, machten sich Roland und Pali über mich lustig. An mir prallte das ab: Wenn sich alle Menschen von Kopf bis Fuß in einer einzigen Farbe kleiden würden, egal ob Shocking Pink oder Béchamel-Beige, dann wäre die Touristenwelt keine solche ästhetische Katastrophe, wie sensible Augen sie allsommerlich durchleiden müssen. Während Rafał beim Verfrachten des Gepäcks in ersten Morgenschweiß geraten war, hatte ich meine American-Express-Karte aus dem Portemonnaie genestelt und die Rechnung beglichen. Wenn ein Rechtshänder das mit links macht, wirkt es nicht besonders lässig. Silke ist sowieso immer als Erste fertig. Ihre Zeiteinteilung ist perfekt. Sollte sie nicht auf die Sekunde pünktlich sein, weiß man, sie kommt gar nicht mehr.
Dieses Mal fuhren wir nicht an der Küste entlang, sondern abkürzend durch das slowenische Inland. Das Auffälligste hinter der sonst kaum erkennbaren Grenze waren die Schweine. Alle zwei, drei Kilometer konnten wir sie besichtigen, manchmal sogar einander schräg gegenüber zu beiden Seiten der Straße. Ihre Besonderheit bestand darin, dass sie im Ganzen an langen Spießen über Holzkohlefeuern hingen und schon ersten Schmorduft in den morgendlichen Himmel entsandten. Gewiss, wir waren nicht mehr in Italien, aber zum Islam Bosniens war es noch weit.

Foto: Privatarchiv H. R.
Um das Land nicht einfach zu achtlos zu durchqueren, hielten wir an einer Tankstelle. Ich gönnte dort nicht nur dem Mercedes seinen Diesel, sondern auch mir eine schön verpackte Flasche Whisky mit zwei Gläsern: Johnnie Walker. Silke machte das dazu passende gouvernantenhafte Gesicht, dann ging es weiter nach Kroatien. Die Grenze war offen auf unserer Seite, auf der Gegenfahrbahn herrschte Andrang. Überall denkt man: ‚Flüchtlingsroute‘. Seit vorigem Sommer, als ich ‚Europa im Kopf‘ schrieb, hat sich in allen europäischen Köpfen von Istanbul bis Edinburgh alles verändert.

Foto: Privatarchiv H. R.
Die Landschaft blieb gleich, eine leicht hügelige Ebene mit Wiesen, Laubbäumen, kurzen Häusern entlang der Straße, die jetzt zur gebührenpflichtigen Autobahn ausgebaut worden war. Da kam man sich doch gleich wieder kosmopolitischer vor als bei den slowenischen Schweinen. Aber nachdem wir die Autobahn verlassen hatten, hörte ‚Südkärnten‘ rasch auf. Die Ebene war gar keine gewesen. Wir erreichten eine Anhöhe, und von der aus sahen wir erst, dann fuhren wir, in Serpentinen steil hinab. Unten lag die Adria, weit und blau, oben wurde es von Kurve zu Kurve mediterraner: Pinien, Oliven, Agaven. Der in den Hang gebaute Ort, das war Opatija. Ich war gespannt. Meine Eltern waren 1960 von einem Golfurlaub in Kärnten dort gewesen und hatten es ‚niederziehend‘ gefunden.


Fotos (2): Privatarchiv H. R.
Zwischen 1966 und 1979 war ich fast jedes Jahr in Italien gewesen. 1973 nicht. In Rom war Ingeborg Bachmann gestorben, in Neapel die Cholera ausgebrochen. Beides hatte mich genügend entsetzt, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Die Europäer beschäftigte die Ölkrise, die Amerikaner die Watergate-Affäre, Harald und ich sannen nach Jahren des selbstverständlichen Italienurlaubs darüber nach, ob Ferien außerhalb Italiens möglich wären. So kamen wir auf die Balkan-Route, allerdings von Nord nach Süd, und unser erster Aufenthalt war in Opatija gewesen. Wir hatten im ‚Gailtal‘ in Kärnten übernachtet – damals lieferte der Name noch Munition für Zoten – und wir waren schwelgerisch begeistert gewesen von der Landschaft: zeitlos verträumt. Von Opatija waren wir nicht begeistert. Ostblock! Alexanderplatz am Mittelmeer, so schien es uns. Wir blieben keine Stunde.
Opatija, dieser Adria-Dreck, das war früher ‚Abbazia‘ gewesen, das mondänste Seebad der Donau-Monarchie. So viele gekrönte Häupter gaben sich dort die Ehre und die Klinke in die Hand, dass ‚Das goldene Blatt‘ eine Dependance hätte einrichten müssen. Neben dem Wiener und dem Berliner Kaiser nebst Gattinnen war dort aber auch die Familie Rinke anzutreffen. Maria Elshorst, die schöne ‚höhere Tocher‘ aus Essen, wollte so schnell wie möglich weg von ihrer kaltherzigen Mutter, die an ihren Kindern den Groll darüber ausließ, dass sie statt ihres ärmeren Favoriten den ungeliebten, reichen Bierbrauer hatte heiraten müssen.
Maria hingegen heiratete den feschen Leutnant Reinhold Rinke, die Anträge von Kommerzienräten und Bankdirektoren hatte sie abgewiesen, weil sie nicht nur katholisch, sondern auch doof – na ja, verblendet – war. ‚Offizier‘, das war Ende des 19. Jahrhunderts absolut angesagt, schmückender als jeder andere Beruf. Reinhold gab vor der Ehe sein Ehrenwort, dass er keine Schulden hätte, hatte aber doch welche, die dann sein Schwiegervater bezahlen musste, und obendrauf noch die Rechnung für ein neues Pferd. Das war ein Offizier sich damals wert, wenn er sich herabließ, eine Bürgerliche zu heiraten. Nach dem Ersten Weltkrieg saß Maria dann da: Ihr untüchtiger Gatte fand nie mehr eine vernünftige Position, ihr Vater verlor sein ganzes Vermögen während der Inflation, und ihre vier Söhne mussten großgezogen werden. Noch in den Sechzigerjahren hat sie auch mir gegenüber ihre Entscheidung bereut. Selber schuld. Gott, zu dem sie jeden Sonntag ging, konnte nichts dafür; allerdings hat er ihr den Schenkelhals gebrochen – eine Woche, nachdem sie die Caritas-Spende eingestellt hatte – um sie zu strafen, wie sie ahnte.




Fotos (4): Privatarchiv H. R.
Im Juli 1914 war die Welt der politisch nicht sehr aufgeweckten Maria Rinke noch in Ordnung. Die Familie machte Urlaub in Abbazia. Alle vier Söhne hatten Keuchhusten gehabt, Guntram, den Jüngsten, hatte es am schlimmsten erwischt. Während sich die älteren drei erholten, sahen sich die Eltern schon mal weiße Särge an, weil sie beschlossen hatten, die Leiche ihres Jüngsten nicht extra überführen zu lassen ins Reich, erzählte Guntram gern feixend. Wäre er damals wie befürchtet gestorben, wäre ich nicht geboren worden, und auch ohne Hitler wäre ich nicht auf die Welt gekommen, weil sich ohne seinen Krieg meine Eltern nicht im Zug begegnet wären. Spermien, Eizellen, Gene. Hätte es jemand in Indien oder Kanada, schwarz, weiß, gelb, rot, irgendwann ins Leben geschafft, der trotzdem ‚ich‘ gewesen wäre? Schwer zu sagen, fest steht, dass am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg begann, Reinhold wurde sofort eingezogen, und eine Ära ging zu Ende. Abbazia erholte sich nie davon. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es an Italien, das war nicht so schlimm, aber nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu Jugoslawien und verfiel völlig.



Fotos (3): Privatarchiv H. R.