

Freitag, 12. August
Die Abreise war unkompliziert. Von sieben bis zehn Uhr werden in Portofino die Pfeiler weggeklappt, dann dürfen Berechtigte die Gasse herunterfahren bis auf die Piazza, und wer ist in einem Touristen-Eldorado berechtigter als der Hotelgast? Rafał lud die Koffer ein, ich meine Mitreisenden, per Kreditkarte. Die Strecke über Santa Margherita nach Rapallo war am Ufer genauso malerisch wie auf der Hinfahrt und am Lenkrad genauso nervenzerrend. Man staunt, wie überzeugend sich die Zivilisation in die Natur eingegliedert hat, welchen Luxus es gibt und wie viel Verkehr durch ein so langes, langes Nadelöhr passt.
Auf der Zufahrt zur Autostrada war es dann so weit: Wir mussten uns vom Meer trennen. Siebenmal. Immer, wenn wir dachten, das war’s, tauchte das Meer ein paar Minuten später auf der linken Seite zwischen den Bergen nochmal auf. Die Autostrada verläuft auf halber Höhe über Genua und gewährt so viele Ein- und Rückblicke, dass man am Ende gar keine Lust mehr hat, beim wiedermal letzten Anblick immer noch sentimental zu werden, und man denkt: Nun reicht’s aber.
Ich kenne das von früher: Man verabschiedet sich in der Hotelhalle mit viel Brimborium von einem Künstler oder Manager – und trifft ihn, bis die Taxe kommt, noch fünfmal auf dem Gang. Erst nickt man noch fröhlich, nachher ist man nur noch genervt. Abschiede reichen, wie das Leben selbst, von herzzerreißend bis grotesk.
Ist man glücklicher, wenn man möchte, dass alles so weitergeht, wie es ist, oder wenn man möchte, dass endlich das Meer oder der Adel verschwindet und die Berge oder die Arbeiter kommen? Das Möchten muss bereits froh machen, das Wollen muss glücklich machen, das Müssen ist schon der Untergang, nach dessen Katastrophe das Dürfen bereits wieder einen Aufschwung markiert. Entscheidungen über Leben und Tod ganzer Völker werden natürlich mit dem Müssen, nicht mit dem Wollen, begründet, genauso wie Zwangsehen oder Triebtaten. Demokratie lebt davon, das Wollen zu respektieren. Gegenüber dem autokratischen Müssen ist die Demokratie deshalb immer in der Defensive, wenn ihre Mitglieder denken: ‚Es wird schon alles gutgehen‘, oder ‚die werden das schon richten‘, oder ‚die machen ja doch, was sie wollen.‘ Nein. Jeder Einzelne ist gefragt zu antworten.
‚Es gibt nichts Gutes, außer man tut es‘. Erich Kästners Satz hat Bestand. „Er drückte sich immer einfach und leicht aus, also befürchtete man, es sei einfältig und ungewichtig. Was er zu sagen hatte, war immer ganz klar. Also vermisste man die Tiefe. Er war witzig, also nahm man ihn nicht ganz ernst‟, sagte Marcel Reich-Ranicki über Kästner.

Foto: Wikimedia Commons/gemeinfrei
In den Sechzigerjahren machte Pali mit Kästner Sprachaufnahmen in München. Pali fand ihn einen schwierigen, unwirschen alten Mann. Trotzdem war Pali fair genug zu erzählen, wie er Kästner aus dem Aufnahmestudio in die Sprecherkabine hinein ziemlich verzweifelt Anweisungen gab, um dem Text akustisch aufzuhelfen, und wie Kästner ganz ruhig erwiderte: „Sie brauchen mir das Gedicht nicht zu erklären. Ich habe es geschrieben.“
Wer nicht zur Wahl geht, ist es nicht wert, in einer Demokratie zu leben. Wer ‚Dschungelcamp‛ guckt, statt sich darüber zu informieren, wie Gewaltenteilung in der Demokratie funktioniert, ist es nicht wert, eine Wahlstimme zu haben. – Zwei zutiefst undemokratische Aussagen.
Dann war das letzte Mal irgendwann doch das allerletzte Mal und das Meer war weg – für immer, für dieses Jahr zumindest.
Die Fahrzeit zwischen Genua und Verona hatte ich mit zwei Stunden in Erinnerung und deshalb gedacht, eigentlich könnte ich meinen Begleitern/Geleitern noch einen letzten Abstecher bieten: Genua. Ich war da viermal gewesen, es hatte mich allerdings kein Mal überzeugt, mit Irene nicht, mit Harald nicht, mit Pali nicht, mit Roland nicht und nicht mit Roland und Harald, als wir mit der Autofähre über Nacht von Barcelona gekommen waren. Inzwischen war Genua vermutlich nicht eigentümlicher geworden, sondern austauschbarer, wie alle Städte. Muss ich nicht nochmal hin, dachte ich. Kein Antrieb, keine Tat. Wo die Neugier fehlt, bleibt nur die Tugend. Resignation des Alters.




Fotos (4): Privatarchiv H. R.
Dabei war meine Unternehmungsunlust ein Glück für die ‚Zwölf Apostel‛. Unsere Fahrt dauerte und dauerte. Erst durch die Berge, dann durchs Flachland. Vorbei an Cremona, das unter Violine-Spielern einen Ruf als Geigenstadt hat, aber vor allem berühmt geworden ist durch mein Lied von 1978: ‚In Cremona, in Cremona!!!‘. Aber das gehört in einen anderen, wenn überhaupt in einen Zusammenhang.
Genua dagegen spielte schon sehr viel früher in meinem Leben eine, genauer gesagt: keine Rolle. Meine Eltern kamen 1957 riskanterweise mit dem ‚SAS-Vogel‘ nach Amerika geflogen, setzten aber vorher fürsorglich ein Testament auf. Flugzeug, Teufelszeug, dummes Zeug – man weiß ja nie …
Für den Rückweg wählten sie die solide Schiffsreise: ‚Andrea Doria‘. Das mal wieder sicherste Schiff der Welt ging im folgenden Jahr auf dem Atlantik unter. Von da an waren meine Eltern sehr stolz darauf, die Fahrt überlebt zu haben. Immerhin hatte in einer besonders sturmgepeitschten Nacht meine Mutter für alle Fälle ihren Schmuck angelegt, erzählte sie gern. Wäre ihre Leiche später aus dem Meer gefischt worden, hätten die Seeleute gleich gewusst, dass sie nicht zum Personal gehört hatte. „Irene war auch die Einzige gewesen, die bei hohem Wellengang noch ungerührt den Speisesaal besucht hatte“, berichtete Guntram immer ehrfürchtig. Leider habe ich ihre gastrophysische Unsensibilität nicht geerbt, und auch mit der finanziellen Erbschaft dauerte es noch sehr lange, wofür ich bis zu beiden Beerdigungen hin tief dankbar war. Dabei wäre ich als Vollwaise vielleicht doch schneller erwachsen geworden. Behütung ist schrecklich unkreativ. Aber – sie wurde mir zuteil und ich war froh darüber.



Fotos (3): Privatarchiv H. R.
Meine Eltern gingen sicher in Genua von Bord und waren dem Zoll bestimmt unverdächtiger als wir drei Althippies 1977 im perlgrauen VW meiner Mutter. In meinem Tagebuch fasste ich damals zusammen: ‚Für mich gibt es das Alter nicht. Nur jugendlichen Schwersinn. Immer, wenn ich wohlbedacht etwas Unvernünftiges tue, starre ich in das Glas oder in das Gesicht, aus dem ich trinke, und ich sage mir: Du wirst an diesen Augenblick jetzt denken müssen und wie wild entschlossen du warst, wenn morgen die Ernüchterung kommt. Denk an diesen Augenblick, wenn du leiden wirst! Und wenn du sowieso tust, was du lassen solltest, dann vermies dir nicht noch deinen Fehler, indem du ihn dir eingestehst, geh, geh!‘ Und dann ging ich, immer wieder, und immer wieder kam ich zurück, und ich handle bis heute nach meinem Wahlspruch: ‚Bereuen muss man vorher. Nachher nutzt es nichts.‘
Nun sitze ich für immer auf dem Beifahrersitz und lebe mit den Folgen meines Leichtsinns. Natürlich geht das besser, wenn ich mir sage, den Schlaganfall hätte ich sowieso bekommen, gut, dass ich mich vorher getraut habe, nicht nur zu kosten, sondern auszukosten. Und wenn ich Lust habe, noch gesundheitsbewusster zu sein, dann sage ich mir: „Jetzt könntest du vielleicht unbeschwert durch Genua oder Granada oder Goa latschen, wenn du weniger Wein getrunken und weniger Salz gegessen hättest.“ Wären die Jahre bei fader Kost und stillem Wasser das wert gewesen? Ich und unbeschwert? Niemals. Bloß weil man in einen Wolkenbruch geraten ist, muss man sich nicht einreden, dass es gestern hier nicht geregnet hätte, und daraus, dass man in Potsdam unglücklich ist, folgt nicht, dass man in Paris glücklich wäre, hätte Margot Honecker einen Mauertoten getröstet, wenn sie Mitgefühl gehabt hätte. Gedanken bilden Blasen, bevor sie zerplatzen; anschließend kann ich dann die Pupse aufschreiben.

































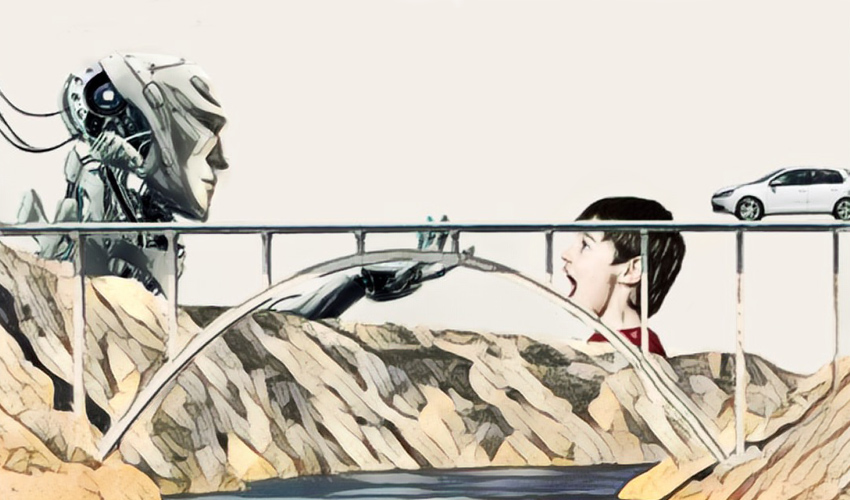


















































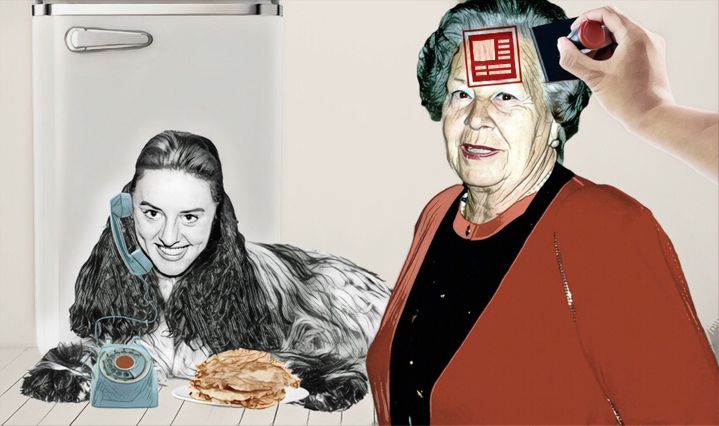















Das Schmuckanlegen bei sturmgepeitschter Nacht ist mir sehr sympathisch. Meine Mutter sagte immer: „Gehe nie schlecht angezogen aus dem Haus. Falls du heute sterben solltest, ist das bis in alle Ewigkeit dein Geisteroutift!“ 😉 Man weiss halt nie…
Menschen, die ihr Wahlrecht nicht in Anspruch nehmen, verstehe ich ebenfalls nicht Herr Rinke. Abscheu und Ungläubigkeit gegenüber dem politischen Geschehen bzw. den Entscheidungsträgern kann man haben, Desinteresse nicht. Ob man dann nebenbei das Dschungelcamp schaut und sich an unter Maden begrabenen Möchtegern-Prominenten ergötzt, ist mir egal. Jedem das Seine.
Jedem das Seine. Inzwischen ist es weit verbreitet, seine Gleichgültigkeit mit dem Begriff „Toleranz“ zu schmücken. Andere Meinungen nicht zu teilen, aber zu achten, ist auch in Talkshows nicht mehr üblich. Das wäre nicht spannend genug. Einmal pro Staffel sehe ich mir das Dschungelcamp übrigens an und weide mich an meiner Verständnislosigkeit, die dem Begriff „Verachtung“ ziemlich nahe kommt.
Naja, Ignoranz ist ja nicht gleich Toleranz. Unterschiedliche Meinungen sind definitiv das Salz in der Suppe. Momentan gibt es aber anscheinend wirklich nur völliges Desinteresse oder gnadenloses Gegeneinander.
Interessanter Ansatz über Demokratie und Autokratie. Ich würde noch hinzufügen, dass ein Wollen auch gerne mit einem Müssen kaschiert wird. Und zwar in beiden Systemen.
Andersherum sagt der Diktator gerne mal ‚Ich will‘ und der demokratisch gewählte Präsident ‚Wir müssen‘. Ist also alles eine Frage der Perspektive…
Bereuen ist immer Kacke. Nutzen tut es eh nichts. Zu seinen Entscheidungen muss man stehen. Und mit den Konsequenzen umgehen. Fertig.
Das ist ja auch mein flapsiger Ansatz. Das einzig Positive am „Bereuen“ ist, dass es dazu führen kann, in ähnlichen Situationen beim nächsten Mal anders zu reagieren. Vielleicht besser.