

Die Überfahrt nach Cres dauerte keine Stunde. Rafał flitzte wie immer durch die Gegend. Ich saß mit Silke auf einer Bank. Ständig traten Leute an die Reling und versperrten uns den Blick aufs Wasser. Sie hatten alle mein Plädoyer für einfarbige Kleidung nicht gelesen, sondern bevorzugten als Lieblingsfarbe Bunt. Menschenfreundlicher wird man wohl nicht im Alter, das kommt nur in rührenden Kinderbüchern vor. Wenn man viel Geld hat, kann man ausweichen, wenn man keins hat, muss man seine Umwelt ertragen.

Foto: Privatarchiv H. R.
Raus aus dem Schiff kommt man immer schneller als rauf auf das Schiff. Das klingt nach Arche Noah und Titanic, ist aber bloß wahr und trifft auch auf Flugzeuge zu. Wir hatten bald Asphalt unter den Rädern und waren in Erobererlaune. Damit wir nicht zu übermütig wurden, mussten wir hinter einer Caravan-Karawane herfahren. Bergauf, bergab. Die Umgebung war ziemlich garstig: karstig, steppig, Gestrüpp. Trotzdem verließ ein Wohnwagen nach dem anderen die Straße, um es sich auf einem der vielen Campingplätze gemütlich zu machen. Hochmütig winkten unsere Blicke ihnen nach: Wir würden es viel, viel schöner haben. Da war ich mir sicher. Silke legt mir unter Briefe, die ich lesen muss, und Vordrucke, die ich unterschreiben muss, immer ein, zwei Magazine, die ich nicht zur Kenntnis zu nehmen brauche. Dazu gehört auch das ‚American-Express‘-Magazin ‚Departures‘.
Bis ich zwölf war, bekam ich 50 Pfennig Taschengeld in der Woche. Nach zwei Monaten hatte ich die vier Mark für eine Caterina-Valente-Platte zusammen. Dann wurde mein Taschengeld auf zwei Mark im Monat erhöht, aber ich mochte Caterina Valente nicht mehr, konnte also sparen. Erst weitere zwei Jahre später kam Mozart, und Shirley Bassey trat ihren Siegeszug in mein Herz nicht vor 1967 an.
Nach heutigen Begriffen wurde ich knappgehalten, aber weil meine Mutter an den Kassen von ‚C&A‘ und ‚Salamander‘ für meine Kleidung und meine Schuhe zahlte, brauchte ich nicht mehr, fanden meine Eltern. Essen gab es ja für mich umsonst, Süßigkeiten mochte ich sowieso nicht, und zu Weihnachten und zum Geburtstag bekam ich neue Puzzles, die konnte ich dann legen. Mir reichte das, ich fühlte mich nicht unterversorgt. Pali sagte später: „Du wurdest immer zu knappgehalten, darum hast du kein Verhältnis zum Geld bekommen.“ In seinen Augen war ich geizig, er in meinen verschwenderisch.

Foto: OlegKovalevichh/Shutterstock
Nach dem Abitur bekam ich vierzig Mark im Monat, das reichte fürs Kino und einmal Restaurant. Für Garderobe war weiterhin meine Mutter zuständig, die Privatstunden für Komposition bei Professor Klussmann zahlte mein Vater. Als ich 1969 Lehrling bei der ‚Deutschen Grammophon‘ wurde, musste ich mir ein Konto zulegen, auf das die 270 Mark im Monat überwiesen wurden. Im zweiten Jahr waren es fünfzig Mark mehr. Mein erstes Gehalt als Festangestellter betrug 1.200 Mark. Da fing ich an, über eine eigene Wohnung nachzudenken. 1973 bezog ich sie. Da verdiente ich schon 1.800 Mark und kam gut damit aus. Inzwischen hatte ich europaweit zu reisen begonnen. Mein Reiseetat überschritt bald mein Gehalt. Damals hatte jedes Land seine eigene Währung, es war praktischer, mit Kreditkarte zu zahlen. ‚Diners Club‘ war die erste am Markt und auch meine erste. Dann wurde es chic, mehrere Kreditkarten zu haben, ich hatte drei. Die ‚American Express‘ habe ich behalten, als ich ‚Deutsche Grammophon‘ verließ, und sogar ‚platinum‘ beantragt. Warum, weiß ich gar nicht. Ich habe sie wohl am meisten genutzt und fand sie ‚exklusiver‘ als ‚VISA‘ und ‚Mastercard‘, dafür ist sie zur Strafe auch weniger einsetzbar.
Zwischen Hawaii und Australien habe ich in den Achtzigerjahren große Summen mit dieser Karte bezahlt. Zwischen 1994 und 2014 wurde wenig mehr als eine monatliche Versicherung bei ihr abgebucht. Jetzt freut sie sich wieder. Mein Leben gliedert sich, die Seele mal weggelassen, per heute in drei Abschnitte: 23 Jahre Entwicklung, 24 Jahre Berufsleben, 23 Jahre Selbstständigkeit. Wie lange nun die Ent-Wicklung dauern wird, bleibt interessiert abzuwarten, auch von meinem ‚kundenorientierten‘ Kreditinstitut. ‚American-Express‘-Mitglied bin ich seit 1979, da waren die meisten Mitarbeiter des Unternehmens noch gar nicht geboren, und das Magazin gab es auch noch nicht. Gegen meine Gewohnheit blätterte ich die Februar-Ausgabe durch und stieß auf das ‚Boutique Hotel Alhambra‘, genauer gesagt, auf dessen Bilder. Die gefielen mir, und ich dachte, das müsse doch von Meran aus für eine Urlaubswoche zu erreichen sein: nach 28 Jahren endlich wieder etwas Neues. Achtundzwanzig Jahre. Kaum zu glauben! Aber seit Maui hatte ich keine Insel, kein Land mehr besucht, das neu für mich war. Die eine Übernachtung in Oslo 1991 zähle ich nicht. Nun habe ich aber, die Festplatte macht es möglich, meinen Bericht von damals an Pali nochmal gelesen: Die norwegische Landschaft passt zu dieser hier, 2000 Kilometer weiter südlich, und die Stimmung von damals ist allgegenwärtig, also zähle ich jenen Aufenthalt doch und füge hier meinen gekürzten Text ein:
Oslo, den 11.09.1991
Erstaunlich. Meine erste Stunde in Norwegen. Ich ging den Weg vom am Hang gelegenen Hotel hügelaufwärts. Man kann lernen von der Landschaft: Sie ist felsig, aber üppig bewachsen, nie eben, aber ganz ehrgeizlos – auf einen unübersehbaren Buckel folgt der nächste, kein höchster Punkt, den es zu erklimmen gilt, nichts, um stolz oder entmutigt zu sein. Man sieht von überall auf alles, und alles ist gestaltet, alles ist Stein, aber kein Stein ist nackt.
Als ich über diese Hügelkette, dicht bewachsen mit Nadelgehölz, in die fast noch weiße Sonne blinzelte, dachte ich qualvoll an den Ausblick auf einen Augenblick, in dem ich den 15. November 1975 bis zum 15. Januar 1991, die Zeit mit Roland, als eine in sich abgeschlossene Periode meines Lebens werde betrachten können, an eine ferne Zeit dachte ich, in der ich mich nicht mehr wichtig genug nehme, um mich umbringen zu wollen, in der ich mich fragen werde: Was ist Erfolg: ‚Deutsche Grammophon‘ auf Hundert Prozent gehalten zu haben; meine Überzeugung gefunden zu haben, dass es Gott ja oder nein gibt; in den Augen einiger Menschen gelesen zu haben, dass ich etwas ausgedrückt habe, was sie gemeint haben; mich zynisch von der Bürde befreit zu haben, anderen etwas geben zu wollen; mich dazu aufgerafft zu haben, anderen etwas bedeuten zu können; jemanden, dem ich nachlaufe wie ein herrenloser Hund und daran Erfüllung finde oder zugrunde gehe; den Mut finde, mich aufzubauen oder aufzugeben; heile oder vernichte; anfange, an meine Macht zu glauben und damit umzugehen – zu mir finde (oder zu etwas anderem), um Wärme auszustrahlen, statt Kaltschnäuzigkeit zu vermitteln –; Roland? – er wäre ja sowieso nicht hier gewesen, aber ich hätte ihn gleich angerufen und ihm erzählt, ich sei begeistert, und dann hätte ich ihn in meiner fernmündlichen Begeisterung dem Fernsehprogramm oder der Sauna überlassen und wäre, irgendwie ja philosophischer als der Rest der Teilnehmer, zum skandinavischen Abendessen gegangen.

Foto: kim7/Shutterstock
Er hat mir verblüffend genau gesagt, dass er hofft, dass sein Tod dazu beitragen würde, dass mir diese leichtfertige Flucht nicht mehr gelänge, sondern dass ich mir unbequemere Wege suchen müsste. Wenn ich in all dem tagtäglichen Abschiednehmen, das mein Leben ausmacht, seit ich es gestalte, je einen Neuanfang auffischen sollte (ein wirklicher Zufallstreffer in dem trüben Bassin), dann außerhalb dieser zu kurzfristigem Erfolg verurteilten Normen, die zu erfüllen man nur ertragen kann, indem man sie lächerlich macht, womit man auch sich lächerlich macht und zerstört.
Endlich wieder beteiligt sein, endlich wieder Abstand gewinnen – das möchte ich. Aufhören, mich so wichtig zu nehmen, dass ich in Selbstmitleid und dessen Umkehrung in Selbstzerstörung vergehe. Endlich anfangen, mich ernst zu nehmen und meinem Schicksal und meinem Körper zuhören, was sie zu sagen haben. Anderen zuhören aus einem anderen Grund als dem, mir die passendste Antwort auszudenken, noch während er redet.

Foto: Privatarchiv H. R.
Schön für Dich, dass ich die Kamera nicht mithabe. So musst Du meinem Drängen, Publikum zu sein, nicht widerstehen. Ich will nichts mehr festhalten. Das heißt aber: Ich will nichts mehr sehen (Offenbar will ich mich aber weiterhin schriftlich ausmähren.) Mein Gott, wenn ich mich doch endlich in Frieden lassen könnte! Aber statt mich einfach gewähren zu lassen, nehme ich mich so wichtig, dass ich mir meine Verfolgung und Zerstörung anordne und deshalb permanent als politischer Flüchtling vor mir und, wenn ich mal zutraulicher bin, in mir Unterschlupf suchen muss.
Roland hat mir diesen Unterschlupf gewährt: dieses Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit. Bei meinen Eltern halte ich mich im Zaum, bei Dir bin ich auf der Hut, bei Roland war ich schrankenlos ich. Irene liebt mich abgöttischer, Du verstehst mich besser, aber keiner kannte mich wie er. Von Euch fühle ich mich ertappt, von ihm fühlte ich mich akzeptiert, vielleicht war er im Gegensatz zu Eurem Glühen mehr resignierend als feurig – mir hat’s gereicht.
Ich bilde mir ein, mal Gottvertrauen gehabt zu haben, zumindest Zuversicht. Nichts mehr davon. Soll ich etwa noch einmal mit jemandem verstohlen Heimlichkeiten austauschen, dessen Leichenstarre mich später aushöhlen wird? Wenn ich von meinen Eltern kam und den sterbenskranken Roland im Bett liegen sah, dann wusste ich: Hier bin ich zu Hause. Aber jetzt?
Wird Totsein schön sein? Ist der Tod das Paradies? Ist die Ungewissheit die Hölle oder himmlisch in ihrer Ahnungslosigkeit, gemessen an dem, was bevorsteht? Wenn es keinen Körper mehr gibt, sind dem Leiden des Bewusstseins keine Grenzen gesetzt, auch zeitlich nicht. Bis zur allerletzten Sekunde des Lebens kann es immer noch schlimmer kommen, wer weiß, vielleicht danach auch noch: Während man unerträgliche Schmerzen erduldet, wird, jede Sekunde neu, der geliebteste Mensch zu Tode gefoltert, in alle Ewigkeit, und man weiß, dass es ewig sein wird.
Vielleicht gibt es Höllenopfer, die niemals jemanden geliebt haben und deren himmelstürmende Liebe zum Zweck der unendlichen Peinigung für sie erst maßgeschneidert erfunden werden musste. Vielleicht hat es Roland nie gegeben, er ist meinem Gedächtnis nur angedichtet worden, um mich zu quälen.



Fotos (3): Privatarchiv H. R.
Ich war nie sicher, ob ich die Menschheit für erlösbar hielt. Jetzt bin ich nicht mal mehr sicher, ob ich sie für erlösenswert halte. Gott sein Dank kann das der Menschheit ganz egal sein und mir, zum Teufel, eigentlich ebenfalls. Wie undankbar ich bin! Anderen geht es materiell viel schlechter, und sie haben nicht das Übermaß an Zuwendung, das mir beschieden ist. Um die sollte ich mich kümmern. Aus Erfahrung reif, sollte ich Aids-Kranken Trost spenden. Ach ja, Menschen selbstlos und aufopfernd pflegen, das werde ich wohl nie tun. Na ja, man kann nicht alles haben.

Foto: Fesus Robert/Shutterstock
































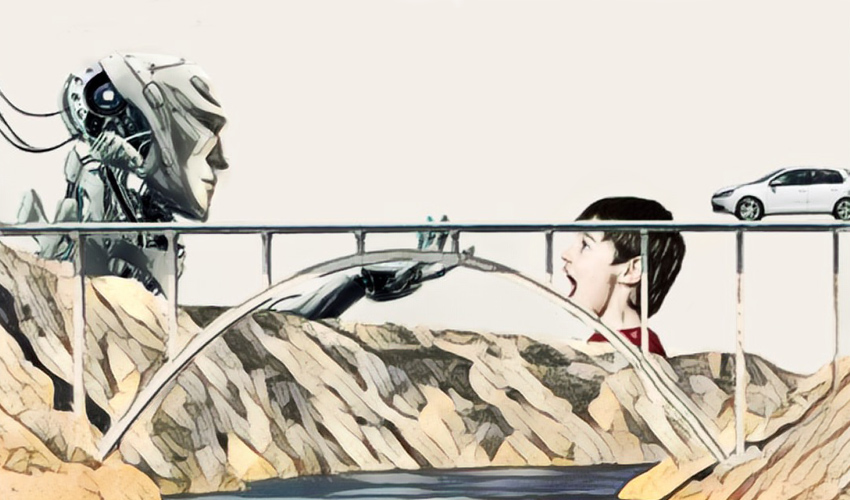


















































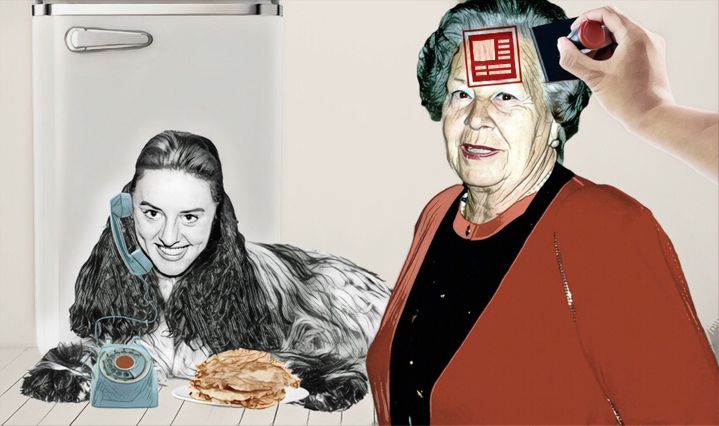
















a roar
and a roar
and a wave
waves you in
to the shore
of the shore
of fatherlands sin
a turn
and a turn
and a passing
in time
its the earth
its reverse
versing natural
rhyme.
u.a. eine schöne Liebeserklärung!
Wunderschöne Bilder von Roland! Das Trauma vom Anblick des leichenstarren Geliebten kann ich Dir so gut nachempfinden.
Hat sein Tod Dich wirklich dazu gebracht, einen „unbequemeren Weg“ als „leichtfertige Flucht“ zu finden? Dein Film? Dein Blog?
Ich bewundere Deinen Willen, das „Leben zu gestalten“- denn die meisten (mich eingeschlossen) leben doch wohl überwiegend so vor sich hin und sind froh, den Anforderungen des Körpers, des Berufs, des sozialen Umfelds zu genügen.)
Und was ich auch an Dir wirklich so schätze: Du nimmst Dich „weniger wichtig“ und gleichzeitig das Gegenteil, wahnsinnig „ernst“, allerdings wohl mehr den Geist als den Körper…
Naja, ich nehme mich wohl inzwischen so, wie ich bin: also träge …
„Liebe.“ ist stärker als alles andere auch leben / Tod kann nicht das verwischen was zwei Menschen tief verbindet .
R