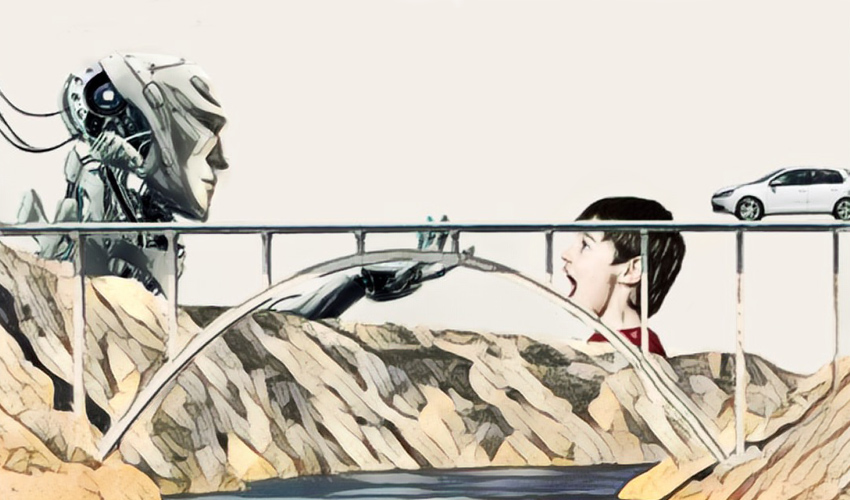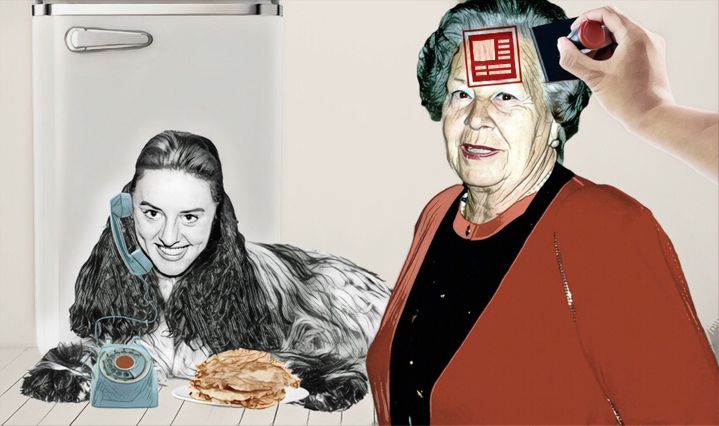Für die bosnischen Grenzbeamten war natürlich Rafałs polnischer Pass erregender als Silkes und mein langweiliger deutscher, aber viel Aufhebens machten sie trotzdem nicht. Das Ganze ist ohnehin lächerlich, auch wenn die bosnischen Zöllner nicht lächelten, um ihre Bedeutsamkeit nicht infrage zu stellen. Nämlich: Damit auch alle anderen Bosnier und Herzegowiner an die Adria kommen können, ohne fremdes Land betreten zu müssen, hat man den Kroaten eine kleine Bucht abgeknapst, den Neum-Korridor – auf der anderen Seite liegt dann Dubrovnik wieder in Kroatien, ähnlich Königsberg, das ab 1920 jenseits des polnischen Korridors die Hände rang, abgeschnitten vom deutschen Hauptvolkskörper. Gut, wenn es dann keinen Führer gibt, der verlorenes Terrain dringend ‚heim ins Reich‘ holen möchte! Die Herzegowina ist für Bosnien das, was Vorpommern für Mecklenburg ist. Sandalj Hranić Kosača hat sie gegründet, starb allerdings bereits 1435, vermutlich ohne Adriablick.
Mir ist völlig egal, zu welchem Land der eine und der andere Ort gehört, Hauptsache, sie spielen nicht Fußball gegeneinander. Wenn sie außerdem auch dieselbe Währung haben, ist es natürlich noch praktischer.
Von Bosnien bekamen wir viel mit: Es ging die wenigen paar Kilometer im Schritttempo vorwärts, so dass man von oben gut abschätzen konnte, wie ungern man in den Hotels dort unten Urlaub gemacht hätte. Grund für die Verzögerung war eine Ampel, die dafür sorgte, dass womöglich aus der Hauptstadt Sarajevo über die Berge anreisende Ehrengäste auch mal Grün hatten, obwohl sie gar nicht da waren. Bevor wir Bosnien mit sehr viel forscherer Kontrolle als von Italien nach Istrien wieder verließen, ohne im Ausland getrunken oder gepinkelt zu haben, überließ ich mich der Frage, ob diese bosnische Ampel, richtig platziert, den Ersten, also auch den Zweiten Weltkrieg hätte verhindert haben können.

Foto: Wikimedia Commons/gemeinfrei
Ob Krakau und Abbazia dann immer noch österreichisch wären? Das erschien mir ebenso unwahrscheinlich wie die Vorstellung, dass der Tilsiter Käse heute im nach wie vor deutschen Tilsit (heute Советск, Sowjetsk) von ostpreußischen Milchmädchen berechnet und verkauft würde.
Die weltgeschichtlich bedeutsame Frage, ob sich gewisse Abläufe zwangsläufig aus den Umständen ergeben oder einzelne Personen bestimmend auf das Geschehen einwirken, musste, wie ganz allgemein in der Geschichtsphilosophie, so auch hier, zwischen Neum und Dubrovnik, unbeantwortet bleiben. Stattdessen lenkte uns Frau Navi, nachdem wir die kyrillischen Buchstaben wieder los waren, wie von mir vorausgeahnt, Dubrovnik seitlich streifend zu unserem etwas außerhalb gelegenen Hotel mit Blick auf die Stadt schräg unter uns; jedenfalls vom Ende der Frühstücks-Terrasse aus konnten wir später mal kurz auf die Mauern herabblicken.


Fotos (2): Dreamer4787/Shutterstock
Das Hotel kam ziemlich plötzlich auf der linken Seite und ging gar nicht mehr viel weiter nach oben, vom Eingang aus. Aber nach unten! Da reichte es bis ans Meer. An der Rezeption gab es einige von Silke mit Recht ungnädig kommentierte Vermutungen darüber, wer denn nun mit wem schläft. Silke zog auch gleich – zornig, aber mit Genuss – die schriftliche Reservierungsbestätigung aus dem Portefeuille, um das Empfangspersonal zu beschämen, so dass wir alle drei, Klarheit schaffend, endlich über eine sechsstufige Treppe in unsere pompösen Zimmer geleitet wurden, in denen Silke und ich, so viel ist sicher, keine weiteren Gäste empfingen. Ich hatte sogar ein überflüssiges Wohnzimmer mit einem wunderschönen Balkon davor. Von dem aus sah man eine verlockende Terrasse, bevor einen die Hitze wieder zurück in das verschnörkelte Zimmer zwang.
Rafał kümmerte sich um die Verbringung des Autos ins Parkhaus, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht hübsch war, aber nicht störte. Besser, als wenn überall Wagen rumgestanden hätten, wofür allerdings sowieso am zugebauten Hang kein Platz war. Mein Hang zu leicht erreichbaren Stätten (erst seit dem Schlaganfall, vorher liebte ich die Unerreichbarkeit) wurde voll befriedigt. Silke und ich fuhren mit dem Fahrstuhl nach unten. Die Rezeption, die man von der Straße her durch die Halle ansteuert, hält man in Mannheim wie in Manhattan für Parterre. Hier irrt man: Es ist der siebte Stock, einige Etagen liegen noch darüber, aber vor allem geht es abwärts, ganz unten führt ein Gang durch den Felsen an die Bucht, an die Liegestühle, an die Sonnenschirme, ans Schwimmbecken und natürlich auch ans Meer.
Mein Entschluss stand sofort fest: Hier würde ich morgen liegen und lesen. Alles sah so richtig nach Urlaub reicher Leute aus. Einen Tag lang konnte man das mitmachen, ohne sich wie die Geissens vorzukommen. Auch Silke schien nicht abgeneigt, weil sie nicht nur Kathedralen vor den Augen liebt, sondern auch Körperbräune auf der Haut. Zufrieden fuhren wir fünf Stockwerke aufwärts und setzten uns auf die ausgedehnte Terrasse, von deren Seite aus, auf der wir nicht saßen, weil da nicht bedient wurde, man Dubrovnik unten liegen sehen konnte. Doch dorthin, ins wilde Treiben, machten Silke und Rafał nach einem Aperol Spritz und einem Mineralwasser schon mal den erforderlichen Erkundungsausflug über Treppen und Stufen, während ich mit Lektüre und Negroni vorliebnahm. Als ich so allein saß, wurde die leere Terrasse riesig und ich winzig.
Die ‚Grand Villa Argentina‘ war in der Tat eine sehr, sehr ‚große‘ Villa, und durch das moderne, noch größere Nebengebäude darüber hinaus eine etwas plumpe Anlage. Das sah man aber weder von unseren Balkonen noch von meinem Terrassenplatz aus. Ein imposanter, gnädiger Garten, der sich wuchernd und zypressenselig bis ans Meer erstreckte, entzog alles, was an Tito oder gar die Wirklichkeit erinnert hätte, den Blicken des Villen-Besuchers. Wie schön war es hier schon 1990 gewesen, und wie behände war ich damals? Und wie unglücklich! Vier Monate vor Rolands Tod. Jetzt hatte ich nichts mehr zu verlieren. Ist das tröstlich? Juli 2016. Glücklicher? Ein paar Edeltouristen setzten sich, tranken und redeten. Wenn ich allein bin, fühle ich mich einsam, sind Menschen da, fühle ich mich gestört. Manchmal finde ich mich unerträglich.

Fotos (2): Privatarchiv H. R.
Silke und Rafał kamen zurück, und es wurde auch Zeit, sich fein zu machen für das exquisiteste Lokal unserer Reise. Eine solche Vorausplanung wie dort kam selbst vorausschauenden Menschen wie Silke und mir ungewöhnlich vor: Wir hatten uns Wochen zuvor zu entscheiden, ob wir um halb sieben oder um halb zehn abends essen wollten. Sonst gäbe es keinen Tisch am Geländer. Ich plädierte für 20.00 Uhr, Tisch in der zweiten Reihe. Am Tag selbst sollten wir unser Erscheinen bis mittags bestätigen. Ich kam mir fast vor, als wollte ich im ‚Berghain‛ Minimal Techno konsumieren und nicht bloß ein nettes Abendbrot zu mir nehmen. Angesichts der autofeindlichen Altstadt wählten wir eine Taxe, die uns durch die Touristenmassen zum ‚Nautika‘ chauffierte. Das Restaurant lag an etwas, das ich für einen kleinen Platz hielt, obwohl es vor ameisenden Menschen kaum auszumachen war. Die Sonne tat, als hätte sie überhaupt noch keine Lust zu sinken; sie ahnte noch nicht, was ihr bevorstand.


Fotos (2): Privatarchiv H. R.
An der Pforte zum Aufgang in das Lokal herrschten zwei uniformierte Damen; eine von ihnen prüfte mit Liste in der Hand, wer rein wollte und wer rein durfte. Aha, dachte ich, doch ,Berghain‛! Nur eben Kellnerinnen-Outfit statt Rausschmeißerkluft. Die Listige fand meinen Namen nicht, was Silke umgehend dazu veranlasste, aus ihrer teuren Handtasche die Bestätigung zu zücken und ein paar harsche englische Worte anzustimmen. Ob die Türsteherin uns gefunden hatte oder nur eingeschüchtert war, blieb bis zum Schluss der Reise unklar, jedenfalls geleitete sie uns durch die leeren, erlesen ausstaffierten Räume auf die Terrasse und übergab uns dort an einen auch sehr offiziell gekleideten Herrn, der für uns einen Tisch von seinem vierten Gedeck befreite, damit er wie für uns gemacht aussah. Dann durften wir Platz nehmen. Ich sagte gleich, dass ich die zweite Reihe viel schöner fände, weil man von da aus nicht nur die Mauern der unumstößlichen Festung sah, sondern auch das flüchtige Publikum, das sich hier für viel Geld auf halb sieben oder halb zehn festlegen ließ. So saß zum Beispiel vor uns eine Inderin, deren Eltern mindestens das Taj Mahal تاج محل gehörte, mit ihrer Schwester und zwei Freundinnen. Sie feierten offenbar ihren Junggesellinnenabschied, bevor sie morgen an den Maharadscha von Eschnapur verheiratet werden sollte. Die anderen Mädels waren recht ausgelassen, sie dagegen blieb damenhaft und erregte Silkes Bewunderung dank ihres raffinierten Kleides. War sie schwermütig? Witwenverbrennungen finden doch, soweit ich weiß, nur noch auf Nachfrage statt.
Während unseres Aperitifs begann es zu grummeln, während der Vorspeise zu tröpfeln. Eilig wurde die Markise ausgefahren, die 18.30-Uhr-Reihe wurde trotzdem nass und floh. Ich unterdrückte von unseren hinteren Plätzen aus eine klammheimliche kleine Schadenfreude; dabei war meine Sorge unbegründet. Mitleid mit reichen Leuten gehört nicht zum guten Ton. Die letzten Bissen hatten auch wir schon unter Donner und Blitz, wenn auch angemessen unaufgeregt, die Kehlen hinabgeschluckt, dann wurden wir – schicklich, aber bestimmt – nach innen geleitet. Nun waren wir selber zu ‚flüchtigem Publikum‘ geworden. Die Kellner trugen uns Wein und Wasser nach; Gläser und Servietten gab es natürlich frisch. Ich war sehr zufrieden: Szenenwechsel liegen mir viel mehr als Speisefolgen. Allerdings stieß ich beim Kundtun meiner Freude mein volles Weinglas über der Tischdecke aus; es zerbrach auch noch am Boden. Die Diskretion, mit der der Schaden behoben wurde, tröstete mich nicht: Ich elendes Wrack! Waren das schöne Zeiten gewesen, als ich derartige Tollpatschigkeiten noch unter ‚jugendlicher Leichtsinn‘ abheften konnte …

Foto: Privatarchiv H. R.
Trotzdem ein gelungener Abend; ein bisschen Art-déco-Atmosphäre, gut angezogene Menschen in stilsicher gestalteten Räumen bei angeregten Gesprächen und erstklassigem Essen. Wie gut konnte ich mir die späten Italiener hier in ihrem eleganten ‚Ragusa‘ 1930 vorstellen, sorglos und nichtsahnend, Jahre vor dem Foibe-Massaker! Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Zur selben Zeit explodiert in Ansbach die Bombe eines Attentäters, die zwar fünfzehn Personen verletzt, aber ‚nur‘ ihn selbst tötet.
Als wir das Lokal verlassen, hat der Regen aufgehört; doch der Platz ist leer und dunkel.