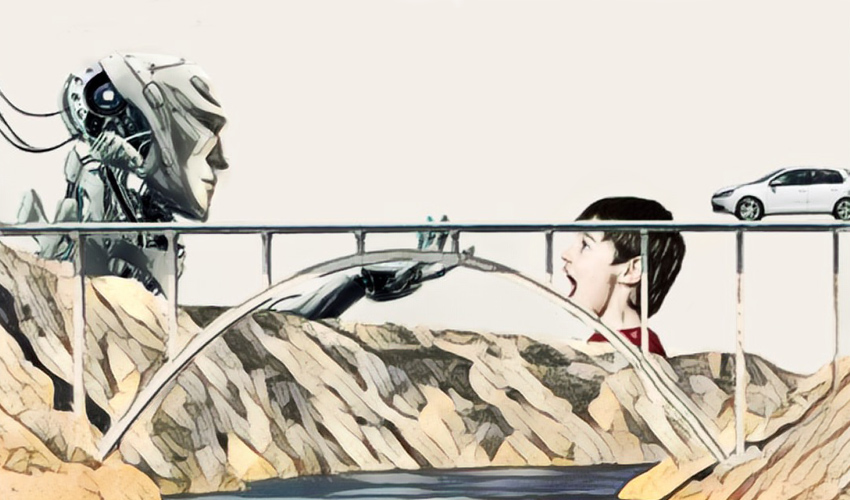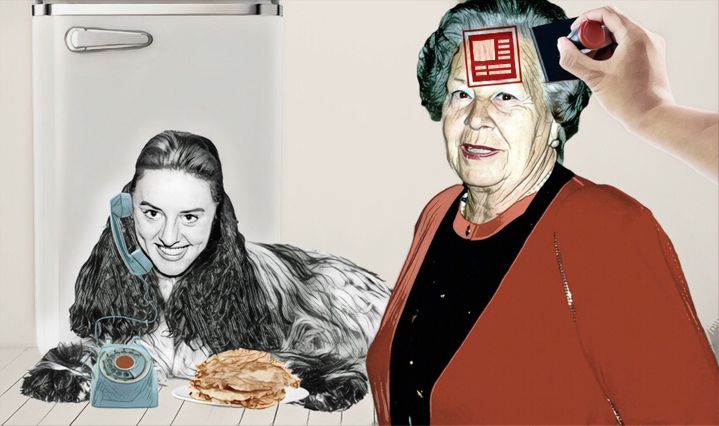Dienstag, 26. Juli
Gegen viertel nach neun klopft Rafał immer an meine Hotelzimmertür. So hat es sich eingebürgert. Um 9.16 Uhr werde ich unruhig, wenn er noch nicht geklopft hat. Um 9.17 Uhr wehre ich eine Panikattacke ab, und 9.19 Uhr ist es noch nie geworden. Er hat dann bereits mit Silke gefrühstückt, und ich habe mir bereits mindestens eine halbe Stunde lang im Autogenen Training eingebläut, dass ich mich auf den Tag freue. Trotzdem freue ich mich nicht, und Silkes Croissant – unbedingt ohne Füllung oder Beschmierung! – nennt auch nicht jeder ‚Frühstück‘. Rafał hatte einmal im ‚Alhambra‘ – von Silke, die selbst natürlich beim trockenen Hörnchen blieb, arglistig verführt – ‚Eggs Benedict‘ bestellt und sogar gegessen. Ich wusste gar nicht, mit wem von beiden ich nie wiederer in meinem Leben reden wollte. Einmal habe ich ‚Eggs Benedict‘ in der Morgenmaschine von Houston nach Miami gegessen. Meine Mutter saß neben mir, und ob es nun Salzgebäck oder Kaviar ist – sie hatte eine ärmliche Kindheit –, da greift man zu, wenn es umsonst ist, im Flugzeug sowieso. Es wäre unsolidarisch gewesen, sie mit den unter Holländischer Soße begrabenen pochierten Eiern allein zu lassen, zumal ich bei der Multiple-Choice-Frage: ‚Was ist das Must-eat auf einem Flug von Houston nach Miami?‘ bestimmt richtig getippt hätte:
a) Toast Hawaii
b) Smørrebrød Hawaii
c) Eggs Benedict
d) Borschtsch (борщ) Benedict
Na, Günther Jauch? RTL-Millionen verdient?

Foto: Ekaterina Zaytseva/Shutterstock
Damals, 1990, war meine Mutter 70, ich erst vierundvierzig, also noch nicht besonders feinfühlig, somit auch nicht besonders wählerisch; außerdem pickten wir ja bloß ein wenig im Airline-Geschirr rum. Meine Mutter aß zu jener Zeit nie mehr etwas auf, unterwegs schon gar nicht, das hatte sie von mir gelernt, und es hielt sie schlank. Doch um nicht abzuschweifen, erzähle ich nicht weiter von Florida, sondern nur davon, wie fabelhaft ich mich im Griff hatte, damit meine echte Entrüstung gegenüber Rafał wie gespieltes Interesse klang. In diesem Bericht gebe ich dagegen zu, dass ich für Menschen, die frühstücken, nicht mehr Verständnis habe als für Moslems, die ihre drei Frauen schlagen und ihre vier Ziegen begatten. Eigentlich bin ich gar nicht so calvinistisch, aber sich morgens gleich den Bauch vollzuschlagen, obwohl man nichts geleistet hat – das ist unmoralisch. Nachts hat man bloß geträumt oder zermürbend wach gelegen, sich also nichts verdient; bis mittags hat man sich zumindest durch Nichtstun an seinem Herrgott versündigt: Das berechtigt zu einer gewissen Stärkung. Meine Lauterkeit fällt mir dadurch ein wenig leichter, dass ich vor 13.00 Uhr sowieso keinen Appetit entwickle; wenn ich aber bis zum übernächsten Abend fasten möchte, dann brauche ich mich nur neben ein Frühstücksbuffet zu stellen und den Fressfickern bei ihrem obszönen Treiben zuzuschauen. In Einzelheiten zu gehen, verbietet mir der Anstand. Hans Christian Andersen droht in seinem herzergreifenden Märchen ‚Die Nachtigall‘ dem ganzen chinesischen Hofstaat an, auf den Leib getrampelt zu bekommen – direkt nach dem Essen. Schade, dass ich nicht in China sein durfte, damals. Und zu schade, dass ich Mohammed seinen Allah nicht glaube: Für mich könnte zwölf Monate im Jahr Ramadan sein, im schönen November würde ich beim Fastenbrechen sogar auf den Pinkel zum Grünkohl verzichten, gleich von welchem Schlachtvieh.
Seit diesem Benedict-Ausrutscher behauptet Rafał jeden Morgen, er habe nur ganz wenig gefrühstückt. Es ist mir egal, ob es stimmt, aber es freut mich, dass er es sagt, und dann lasse ich mir von ihm erzählen, wie sich die geifernden Massen ihre Teller hemmungslos zugeschüttet haben. Ich bitte Gott, sich an Gomorra oder zumindest an Sodom zu erinnern und dann auf dieses Buffet zu sehen bzw. zu kotzen. Nie würde ich mich wie Lots Weib neugierig nach Jehovahs Schwefelregen umsehen, wenn ich den Speisesaal verlasse, und ich denke: Eines Tages, irgendwann, irgendwann, eines Tages werde ich hingehen – Räucherlachs und Rührei nehmen, Toast und Orangenkonfitüre – und dann werde ich an einen der Tische treten und fragen: „Ist hier noch frei?“

Foto: Proshkin Aleksandr/Shutterstock
Rafał berät mich bei der Kleidung; eigentlich berate ich ihn dabei, was er mir raussucht: Ich weiß genauer, was ich habe; er weiß genauer, wo es liegt. Heute habe ich mir ja ‚beach-day‘ vorgenommen, da reicht ein Polohemd, das farblich sowohl zu den Shorts wie zur Badehose passt, textil-gestalterisch keine unlösbare Aufgabe. Dann fahre ich mit Silke schon mal nach unten. Der Felsengang vom Fahrstuhl nach draußen ist kühl und dunkel. Dahinter ist es hell und heiß. Sehr heiß. Sehr, sehr heiß. Um zehn. Ich begrabe meinen Plan, ein Sonnenbad zu nehmen, und den Plan, ein Bad im gleißenden Pool zu nehmen, lege ich gleich ins Grab daneben. Zypressen für meinen Friedhof gibt es hier unten nicht, aber Gott sei Dank einen ‚spasitelj na bazenu‘, der Sonnenschirme austeilt. Stimmt schon, den Ausdruck habe ich gegoogelt: Anders als Politiker gebe ich etwas völlig Offensichtliches gern schon zu, knapp bevor ich überführt werde, weil zwar auch ich die Menschen für blöd halte, aber trotzdem lieber ehrlich als ertappt bin. Dennoch gebe ich darüber hinaus zu, nicht zu wissen, was Bademeister auf Kroatisch heißt, etwas, das wohl leichter zu gestehen ist als einzuräumen, Schmiergelder angenommen oder seinen Enkel gevögelt zu haben.


Fotos (2): Privatarchiv H. R.
Ich entschied mich für einen Winkel etwas abseits des Pool-Gewimmels am inneren Rand eines Felsvorsprungs, und Silke trug meine Entscheidung mit. Dass der Spasitelj rasch mit den Schirmen kam, beruhigte mich, denn mir fing es schon an, blümerant zu werden. Immer noch gelte ich in meinem Umfeld als der Hitzebeständigste, aber ich weiß nicht, ob ich mir da – wie bei so vielem – nicht einen Ruf erarbeitet habe, den ich jetzt nur noch verteidige, ohne ihm zu genügen. Jedenfalls war der hohe Schirm ein Labsal. Neidlos sah ich auf die, die sich der Sonne aussetzten und ihren Hautkrebs vielleicht erst bekommen würden, wenn man ihn so behandeln kann wie heute Salmonellen. Wenn man die Haut so wird austauschen können wie heute die Nieren, dann brauchen alternde Filmstars kein Botox mehr.
Statt solche Zukunftsvisionen weiterzuspinnen, vertiefte ich mich lieber wieder in ‚Vienna‘, das unter überwiegend jüdischen Bürgern zu einer Zeit spielt, in der Dubrovnik schon nicht mehr österreichisch war. Es war hier zugegangen wie überall an der Adria: Illyrer, Slaven, Osmanen, Venezianer. Aber dann konnte die ‚Republik Ragusa‘ lange Zeit ihre Selbstständigkeit behaupten – mit gewissen Zugeständnissen wie bei jeder Selbstständigkeit. Nach dem ‚venezianisch-österreichischen Türkenkrieg‘ wurde dem Sultan Ahmed III. zwischen Neum und Klek der Zugang zur Adria gewährt. Das war 1718. Ging wohl nicht anders, aber deshalb ist Dubrovnik jetzt eine Exklave, und man muss an dieser lähmenden Ampel nach Sarajevo vorbei. Wie zu erwarten machte Napoleon auch diese Gegend französisch und Metternich dann beim Wiener Kongress auch diese Gegend österreichisch, aber nach dem Ersten Weltkrieg wurde, jaja, aus der Hauptstadt eines Weltreiches die Hauptstadt eines Ferienländchens, bis heute: Vienna. Zwischendurch hatte Österreichs Sohn Adolf seine Landsleute heim ins Reich geholt, was ihnen die Möglichkeit bot, sich als erste Opfer von Hitlers Kriegspolitik zu stilisieren. Heuchelei gehört halt immer dazu: wie Heuriger, Opernball und Tafelspitz – Vienna.
Eigentlich haben die Österreicher vor dem Ersten Weltkrieg überwiegend Glück gehabt, abgesehen von Austerlitz und Königgrätz. Schon im 17. Jahrhundert hieß es über die raffinierte Heiratspolitik der Habsburger: ‚Bélla geránt aliī, tú felix Áustria nūbe.‘ Und dieses ‚Mögen andere Kriege führen, du glückliches Österreich, heirate!‘ hat ja oft geklappt, wenn auch nicht für Maria Theresias Tochter Marie Antoinette. Aber als deren Kopf unterm Fallbeil landete, war Mama schon dreizehn Jahre tot. Rechtzeitig zu sterben, ist eine Kunst. Man erspart sich manches: Hinrichtungen, Krebs, Falten. Aber man muss natürlich auch auf vieles verzichten, wovon man nie erfahren wird, was es war. Dieser banale Gedanke transportierte mich zurück ins Jetzt und in den Zustand, von dem ich nicht recht abschätzen konnte, ob ich ihn genießen oder überwinden sollte. Bei zehn Grad weniger wäre mir die Entscheidung leichter gefallen.


Fotos (2): Wikimedia Commons/gemeinfrei
Rafał kam. Er ‚plumpste‘. In den Pool und vorher so richtig ins Meer. Still zu sitzen ist ihm wesensfremd. Zwei Stunden, so lange muss ich hier schaffen, redete ich mir lesend zu. Silke und Rafał erforschten die Umgebung, besonders das Terrain, das über unzählige Treppen zu erreichen war und den Teil des Hotels bildete, den wir im Fahrstuhl unterlaufen hatten. Sie kamen mit Mineralwasser zurück. Durst habe ich ja nie, aber ich hoffte, der Sprudel könne vielleicht einen Kreislaufzusammenbruch verhindern. Dabei lagen tatsächlich Menschen in der prallen Sonne. Selbst wenn ich fest an diese Hauttransplantationen im Jahr 2040 glaubte, wäre mir das zu mühselig. Bei solcher Hitze kann man doch gar nicht denken. Na ja, können die vielleicht im Schatten auch nicht. Um zwölf dachte auch ich nicht viel Intellektuelleres als ‚Ich muss mal‘. Rafał begleitete mich auf dem stufenreichen Weg, doch ich wurde wider Erwarten nicht ohnmächtig. Als ich aber aus der Toilette heraustrat, stand ich vor einem breiten Grill mit einer gerade noch überschaubaren Anzahl von Tischen: karierte Decken, Schirme und jenseits der Terrasse der Blick herab auf Pool und Meer und Bucht. Nein, dachte ich, hier gehe ich nicht mehr weg. Mögen andere in der Sonne schmoren, du, glücklicher Hanno, setzt dich! Rafał brachte mir mein Buch, eine schwarz-weiß livrierte Kroatin einen Campari, und ich ordnete meine Vorstellung von dem, wozu man sich zwingen muss und wozu nicht, neu.



Fotos (3): Privatarchiv H. R.
Um eins gesellten sich Silke und Rafał zu mir, und wir aßen etwas. Nach oben erstreckte sich der dschungelige Garten, dahinter die langgezogene, weiße Fassade der ‚Grand Villa‘, nach unten ging es in Serpentinen zu den Hautkrebslern, die man wegen Selbstverschuldens und Reichtums wieder mal nicht bemitleiden musste, dem Schrillblau-Wasser im Pool (darf man in diesem Ambiente hier immer noch ‚Schwimm-Bassin‘ sagen?), dem eher naturfarbenen Meer und der Dubrovnik vorgelagerten Insel Lorkum, der die Franzosen unter Napoleon in ihrer kurzen Zeit das ‚Fort Royal‘ inmitten von Agaven, Kakteen und Magnolien hingepflanzt hatten. Richard Löwenherz war auch schon auf Lorkum; das allerdings bereits 1191. So entging er damals einem Schiffbruch. Tut es gut, kein Mitleid zu haben? Eigentlich ist Mitleid doch ein sehr befriedigendes Gefühl: Man kann Gutes tun, muss es aber nicht.




Fotos (4): Privatarchiv H. R.
Die Vermeidung beider Weltkriege | #34Wunderschön und völlig anders | #36