
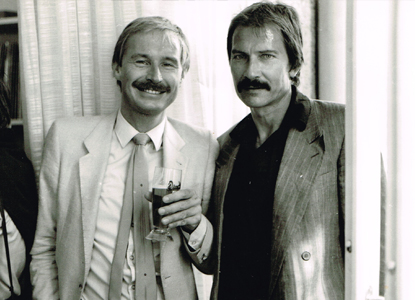


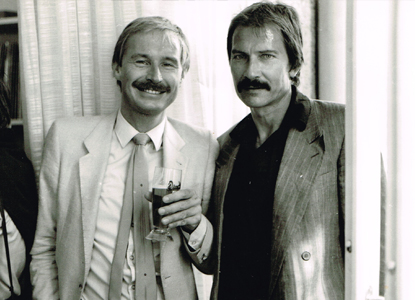
Foto links: Smit/Shutterstock | Foto rechts: Privatarchiv H. R.
Samstag, 28. Mai bis Dienstag, 31. Mai
Nun beginnt also die erste Ruhephase. Ist das erholsam oder anstrengend? Früher wollte ich an jedem Morgen wissen: Ich bin verantwortlich für etwas, ich muss nach London fliegen, ich muss ein Meeting vorbereiten oder ich muss einen Vortrag halten. Wofür steht man denn sonst überhaupt auf? Heute schlafe ich schon schlecht, wenn ich um elf einen Friseurtermin habe. Aufstehen ist jetzt eine unangenehme Unterbrechung meiner meist unangenehmen Träume, deren Charme ausschließlich in ihrer Konsequenzlosigkeit besteht. Und weil ich bei etwaigen Mittagsschläfen nicht erinnerlich vor mich hin träume, muss ich bis nach dem abendlichen Zähneputzen warten, bis ich diese Welt, in der ich es so gut habe wie nur wenige, verlassen kann – zurück in mein Traumreich.
Warten ist eine ausfüllende Beschäftigung, wenn sie von Sorge unterstützt wird: Hab ich die Prüfung bestanden? Kommt er noch? Ist sie tot? Wenn man aber auf nichts Bestimmtes wartet, muss man Pokémon Go spielen, lesen oder, wie ich, schreiben, was besser klappt, wenn man vorher gedacht hat. Wie in jedem Leben ist auch in meinem vieles so gelaufen, dass man es ‚schief‘ nennen könnte. Dazu gehört mein Mangel an Vorbildern.


Foto links: Pakhnyushchy/Shutterstock | Foto rechts: Gemeinfrei/Wikimedia Commons
Ein kleiner Exkurs über: Ideale und Idole
Da ich ja sowieso keines meiner Ziele mehr erreichen werde, ist das Einzige, was mir noch bleibt, über die Unerreichbarkeit von Zielen zu schreiben. In diesem Thema fühle ich mich zuhause. Sein Ideal zu finden, ist ja selbst dann, wenn die Eltern das entgegengesetzte Ideal haben, nicht so schwer, manchmal sogar leichter. Sein Ideal aufzugeben, ist schon schwieriger, und sich seinem Ideal – bei modifizierter Beibehaltung – schrittweise anzunähern, das ist am schwierigsten. Ich habe sie alle eingebüßt, wie der Griff in ein Gebilde aus Rauch – Weihrauch. Ideale sind nur aus der Ferne schön, wie Wolken. Noch schlimmer steht es um die Idole. Ich hatte nie welche. Nicht Albert Schweitzer, nicht Elvis Presley, nicht Uwe Seeler. Und ich weiß nicht, ob das ein Mangel ist oder ein Privileg. Geschwärmt habe ich nur für Tote wie Beethoven oder Watteau, was man, glaube ich, nicht zählen muss. Mein Vater hatte Idole: Sportler, Hitler; meine Mutter fand Rita Hayworth als ‚Gilda‘ bewundernswert, und in dieser Rolle entsprach Rita ‚Heuwurz‘, wie ich sie nannte, zweifellos dem, was meiner Mutter um 1949 vorschwebte. Es wäre sinnvoll, sich vor dem Weiterlesen meines Textes den entsprechenden Filmausschnitt anzusehen:



Fotos (3): Privatarchiv H. R.
Meine Mutter war als Irena Wydoff in Zoppot aufgewachsen. Herr Wydoff spielte keine wesentliche Rolle im Leben ihrer Mutter, verstarb oder verschwand praktischerweise auch gleich nach der Trauung, die nur dem Zweck gedient hatte, die jüdische Frucht im Bauch meiner Großmutter legitim und irgendwie arisch zu machen, wobei das Arische erst später interessant wurde. 1920 fühlte sich Maria, verheiratete Wydoff, trotz ihres russischen Gatten als Polin, was damals in Zoppot nichts besonders Schlimmes war. Zoppot war, wie Irena mich lehrte, nach Biarritz das prominenteste Seebad Europas, und ein Vorort von Danzig. Wie Hochgebildete wissen, hatte das Deutsche Reich 1918 den damals einzigen Weltkrieg verloren und dadurch nicht nur ersetzbare Soldaten, sondern auch unersetzliches Land eingebüßt: Westpreußen zum Beispiel. Danzig wurde ‚Freistaat‘, was im Allgemeinen schiefgeht, so auch hier, aber Irena konnte sich bis 1939 in einer Art Ostsee-Monaco vorkommen, Kleider auf Anzahlung kaufen und zum Tanztee ins Casino schlendern. Diese schöne Welt ging zwar unter, aber wenn Rita Hayworth ‚Amado Mio‘ sang, lebte der Glamour im ‚Astor‘ am Ku’damm 1949 leinwandbreit wieder auf. Weil die Original-Aufnahme damals in Berlin nicht aufzutreiben war, musste sich Irena mit der deutschen Version begnügen, und so bin ich mit ‚In deinen Armen‘ statt mit ‚Amado Mio‘ auf Schellack aufgewachsen. Rita Hayworth sang zwar nicht mal im Original selber, aber das störte nicht weiter, zumal ja ihre Stimme für den deutschen Markt sowieso synchronisiert worden war. Entscheidender: Sie war elegant, undurchsichtig und traurig, also genauso, wie mein Vater meine Mutter im Mai 1943 im Zug von Posen nach Berlin kennengelernt hatte.
Als Idol hatte Rita Hayworth Mitte der Sechzigerjahre, als auch ich ‚Gilda‘ sehen durfte, ausgedient. Es hieß, die alte Diva liefe besoffen durch Hollywood. Erst später stellte sich heraus, dass ihr seltsames Verhalten nicht vom Alkohol kam: Sie hatte Alzheimer, eine damals weitgehend unbekannte Krankheit. Irene (ihr A war einem deutschen E gewichen) sah ihren Star rehabilitiert. Ahnungen sind nur nützlich, wenn man etwas ändern kann, wie etwa Irenas beherzte Flucht aus Danzig am ersten Kriegstag 1939. Das Kassandra-Schicksal, die Zukunft zu kennen, ohne sie ändern zu können, ist nicht wünschenswert. Und so war es auch gut, nicht zu wissen, dass Irene im neuen Jahrtausend ein ähnliches Schicksal von Kontrollverlust wie Rita Hayworth bevorstand.
Wer noch neugieriger ist, kann sich die Grace-Jones-Version von ‚Amado Mio‘ anschauen. Der Kontrast belegt recht gut den Unterschied zwischen meiner Nachtwelt und der meiner Eltern, selbst wenn der erste Anfang des Clips verrauscht ist. Das wird nach zehn Sekunden besser.


Foto links: Everett Historical/Shutterstock | Foto rechts: Privatarchiv H. R.
Zu den Idolen meines Vaters fällt mir weniger ein. Meine Mutter korrigierte ihn immer leicht gereizt, wenn Guntram von „der Adolf“ sprach. „Schatz, du kanntest ihn doch gar nicht!“, sagte sie. Die Sportler seines Lebens waren für mich alle Vergangenheit, aber bei Fußballspielen nahm mein Vater seit den Neunzigerjahren die Fernsehübertragungen auf VHS-Kassette auf. Wenn das Spiel gelaufen war, konnte er sich mit dem Ergebnis abfinden. Sähe er es live, fürchtete er, einen Herzschlag zu bekommen.


Foto links: Bjoern Deutschmann/Shutterstock | Foto rechts: Natursports/Shutterstock
Jeder Mensch ist ja irgendwie irgendwann mal einsam, besonders beim Wegsterben. Deshalb war auch ‚Jeder stirbt für sich allein‘ ein so guter Roman-Titel. Sport-Ereignisse sind das, was mich einsam macht – weil sie mir völlig egal sind. Wer wie schnell läuft, den Matchball übers Netz fegt oder ein Eigentor schießt, ist mir ausnahmslos schnuppe. Meine diesbezüglichen Selbstzweifel sind von Verwünschungen der übrigen Menschheit durchsetzt, ganz schlimm bei Fußball-Meisterschaften: „Wissen nicht, wer Kant war, können keine Guacamole hinkriegen, sind trotzdem wahlberechtigt und schreien schrill bemalt beim Public Viewing, als ob es um etwas Bedeutendes ginge.“ Natürlich habe ich das Problem des Geisterfahrers: Wenn alle Wagen mir auf der Autobahn entgegenkommen, fahre vielleicht doch ich verkehrt. Meine Wut über meine Begeisterungslosigkeit schlägt um ins Grundsätzliche: Wenn die Religionen nichts taugen und nicht mal die Ideologien, dann bleibt ja bloß noch der Humanismus. Der ans Kreuz genagelte Jesus und die ihre Kinder ins Licht geleitenden faschistischen oder sozialistischen Werktätigen sind mir alle genauso fremd wie Leute, die anderen Leuten beim Stabhochsprung oder Formel-Eins-Rasen zugucken. Ich finde das indiskret. Dass jemand hoch springen kann, ist toll. War vor 20000 Jahren sicher hilfreich zum Überleben, geht mich aber heute eigentlich nichts an. Die Luftverschmutzung durch Rennfahrer und die Champagner-Verschwendung nach dem Sieg überstrapazieren meinen Sinn für Ausgelassenheit erheblich. Rechts-konservativ komme ich mir nicht vor, links-zukunftsgläubig auch nicht. Ohne Idole, ohne Ideale und doch mit Ressentiments gegenüber denen, die ihre Tage durchleben, ohne nach dem Woher und Wohin zu fragen, so bin ich. Vermutlich haben sich schon um 300 vor Christus mehr Menschen für Olympia interessiert als für Platon. Und dabei ist es geblieben. Weil mich das zwackt, bin ich selbst den optimistischen Bildungsidealen des Humanismus’ gegenüber skeptisch. Dass Gott die Welt in seinen sechs Tagen nicht so ideal erschaffen hat, wie es seinem Ruf entspräche, wird einem schon vom Mückenstich bis zum Krebstod klar. Die blöde Behauptung, alles Miese läge nur daran, dass Gott den Menschen den freien Willen gelassen habe, den sie sträflich missbrauchen, diese Behauptung ist ja genauso plausibel wie die, Katastrophen seien dazu da, die Menschen im Glauben zu festigen bzw. Sünder zu bestrafen. Ich weiß schon, so banal darf man Mysterien nicht aufdröseln. Warum eigentlich nicht? Weil sie sich sonst als Scharlatanerie erwiesen?

Foto: Halfpoint/Shutterstock
Schiebt man die Religionen als Volksverdummung weg, was bleibt dann noch? Ich mag mich wirklich nicht als ,Nihilisten‘ bezeichnen, das Wort mag ich einfach nicht. Aber ,Atheist‘ nenne ich mich auch nicht gern, obwohl ich nicht an einen lenkenden Gott glaube (die unüberwindlichen Barrieren meiner Kindheit). So habe ich es gelernt: Man trägt keine braunen Schuhe zum dunkelblauen Anzug; man schneidet Kartoffeln nicht mit dem Messer; man ist nicht Kommunist, homosexuell oder gottlos. Seit meine Mutter tot ist, brauche ich ihre Gebote nicht mehr zu befolgen, aber diese Gebote zu übertreten, löst immer noch wohlige Schauer oder Betretenheit in mir aus.
Klasse Hanno, auch die youtube Clips,
sehr kurzweilig, weiter so, Mariöle
Hanno, hier kommt ja zu Deinem furor gegen die Relgionen auch noch ein in dieser Intensität neuer gegen Sport!
Ansonsten finde ich tatsächlich Rita Heuwurz noch immer besser als Grace Jones- so altmodisch wie ich bin…
Wir finden Grace Jones ganz klasse und die Gegenüberstellung genial ! A+S