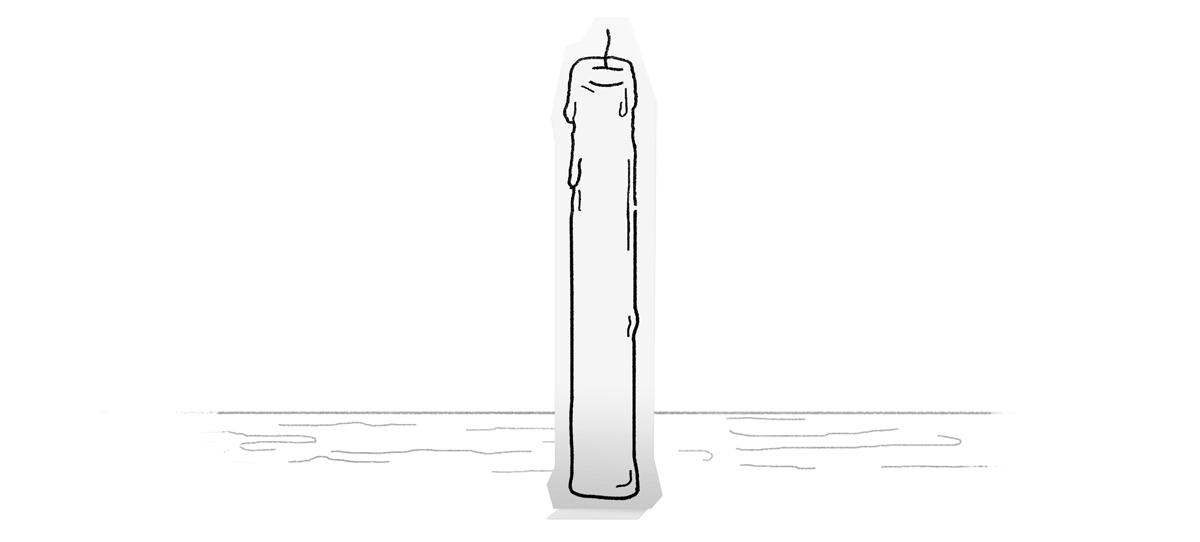

Sacrow gehört auch in die weitläufige Familiengeschichte. Der älteste Bruder meines Vaters, Achim, war nach seiner durch den Kriegsverlauf erzwungenen Rückkehr aus Paris, wo er sich als Verwalter des ‚Feindvermögens‘ Ehre erworben hatte, vom militärischen Dienst freigestellt worden, aber weil seine Frau, von der er sich zuvor hatte scheiden lassen – sie war angeblich ‚umtriebig‘ gewesen, aber vor allem Halbjüdin, was zu Achims Reiter-SS-Ambitionen nicht recht passte –, weil diese Frau, von der er dennoch nicht lassen konnte, sich weigerte, mit ihm im Zug zu ihrer Familie in den Westen nach Bückeburg zu fahren, zerriss er – angeblich – noch auf dem Bahnhof die Fahrkarten und meldete sich aus verschmähter oder Vaterlands-Liebe ohne Zwang zurück an die Front, die damals so nahe lag, dass sie ohne Zugreise zu erreichen war, weil nämlich die Sowjetsoldaten Berlin bereits umzingelt hatten und Achim, als er während der letzten Kriegstage noch fiel, fast schon wieder zu Hause war, aber stattdessen laut einer Benachrichtigung an meine Großeltern zusammen mit anderen Gefallenen seine letzte Ruhestätte auf dem dafür abgegrenzten Teil eines Dorffriedhofes gefunden hatte: Sacrow. – Knapp erzählt, doch der Weg nach Sacrow ist genauso umständlich wie der vorige Satz. Luftlinie sind es von Potsdam nach Sacrow drei Kilometer, aber die Havel leistet sich oberhalb von Potsdam die Ausbuchtung Jungfernsee, der dann noch in den Krampnitzsee mündet. Das ist gewiss abwechslungsreicher als ein Highway, der schnurgerade durch Dakota nagelt, aber es will umfahren sein; ja, man muss als eiliger Fahrer noch dankbar sein, dass es die Nedlitzer Brücke gibt, denn sonst hätte man auch den Weißen See und den an ihn anschließenden Fahrlander See zusätzlich zu umkreisen. Die Havel lieferte dem Segelboot der vier Rinke-Brüder ideale Bedingungen; die Zurückgewinnung des Naherholungsgebietes ist für Westberlin mindestens so attraktiv, wie den Alexanderplatz neu gestalten zu dürfen. Erst die Einbindung einer Stadt in ihre Umgebung verleiht ihr Wurzeln und Profil. Insofern war Westberlin ein Abstraktum: die westlichen Ideale als Insel-Modell im Herzen des Gegners.
Nun, der Gegner hatte Achims Herz im April 1945 tödlich verwundet, bevor er das Schicksal Berlins für fast ein halbes Jahrhundert bestimmte; für meinen Großvater brach damit die Welt zusammen, denn er soll angeblich nur seinen ältesten Sohn geliebt haben. Für mich waren das alles bloß Geschichten und Geschichte, und es bestand wenig Anlass, Giuseppe auf krumme Wege zu lenken, bloß um dann vor ein paar Kreuzen zu stehen, von denen eines einem Verwandten galt, den ich nie kennengelernt hatte. Eigentlich.
Und doch: Die Familienbande waren ja eher Vorwand für eine Fahrt durch Waldungen und Rodungen auf immer kleiner werdenden Straßen. Kein Fahrzeug, kaum ein Haus. Der Friedhof unter hohen Bäumen. Abgeschiedenheit der Landzunge, Wärme des Sommerabends. Schwer vorstellbar, dass hier erbitterte Kämpfe getobt hatten, leicht vorstellbar, hier zur ewigen Ruhe gebettet zu sein. Altertümliche Ausdrücke für altertümliche Empfindungen. Und da erwischte mich an diesem Ort der Einkehr das explosive Gemisch aus Sensationslust und Sentimentalität. Zum ersten Mal, seit ich in Berlin war, machte ich mir mein Handy zunutze. „Ich stehe hier vor Achims Grab“, sagte ich mit tränenerstickter Stimme zu meinem Vater. Die moderne Kommunikation erlaubt den weltumspannenden Zugriff. So kann man alles festhalten, teilen und entweihen. Wir gingen den Weg zum Wasser und am ‚Jungfernsee‘ getauften Havel-Teil entlang zur Heilandskirche. Sie erinnert von Ferne an eine norditalienische Basilika; so konnte auch mal Giuseppe alten Erinnerungen nachhängen.
Die Kirche steht ganz allein, umgeben von Schilf auf der äußersten Spitze der Landzunge; am gegenüberliegenden Havel-Ufer erstreckt sich, knapp dreihundert Meter entfernt, der Park von Schloss Glienicke. Deshalb war die Kirche auch von den DDR-Behörden in Schutzhaft genommen und ummauert worden. Weil sie so keinen Sinn mehr ergab, sollte sie abgerissen werden. Das hat Logik, aber die Geschichte entschied anders: Die Mauer fiel – und nicht die Kirche, und nun kann man, wenn man mit dem Boot die Havel entlangfährt, auf beiden Seiten wieder unvermauerte Natur sehen. Ich wünschte mir, wir hätten ein Boot, denn meine Knöchel taten weh und der Weg war länger, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Da standen wir also: am Ende des Tages und der Landzunge. Kein Mensch außer uns weit und breit, kein Boot auf dem Wasser, kein Lüftchen, das sich regte. Die Kirche still und geschlossen, unsere Seelen still und geöffnet. Verrichteter Dinge liefen wir querfeldein über Wiesen zum Wagen zurück.
Dass Sacrow zu Potsdam gehört und Kladow, zwei Kilometer weiter die Havel entlang, zu Berlin, interessiert höchstens Kreisverwaltungsbeamte – es sei denn, dazwischen verläuft die Grenze zwischen Arbeiter- und Bauernmacht und Kapitalistenherrschaft. Im Herbst ’92 war ich schon mal mit meinem Vater und seinem Bruder Hasso, der inzwischen tot ist, in Sacrow. Damals, drei Jahre nach dem Abtragen der Mauer, war die Landstraße am Ortsrand von Berlin-Kladow mit einem Pfosten gesperrt. Die Kladower hatten durchgesetzt, dass die Brüder und Schwestern drüben nicht geradewegs in ihren Villenvorort einfallen konnten: Der Kladower Weg führte bloß bis zur ehemaligen Grenze. Jenseits des Pfostens ging’s dann die Sacrower Landstraße weiter in Richtung Stadtmitte/West.
Da ich das Handy nun schon eingeweiht hatte, rief ich meine Cousine Marina in Zehlendorf an, um mich zu erkundigen, ob sich an der Situation etwas geändert hätte; sie behauptete: „Nein“, und weil es zu spät war, um Wege umsonst zu machen, fuhren wir den Riesenumweg zur Potsdamer Chaussee zurück, um in weitem Bogen um Kladow und Gatow herum die Heerstraße zu erreichen und die Havel wieder – in entgegengesetzter Richtung zur Glienicker Brücke – zu überqueren.
Letzter Punkt auf meiner Liste: Schildhorn. Um dorthin zu kommen, machte ich alles falsch, was man als Stadtführer verkehrt machen kann. Erst versuchte ich, Giuseppe auf die Havelchaussee zu lenken; die war aber nur über eine Treppe zu erreichen, die für Fahrzeuge ohne entsprechende Ausrüstung unpassierbar war. Mit einem Spielzeug-Panzer hätten wir es geschafft. Dann wies ich Giuseppe an, die nächste Abfahrt zu nehmen, sie endete an einer sozialpädagogischen Fortbildungsstätte. Wir versuchten es noch einmal und landeten an einem, immerhin jüdischen, Friedhof. Ähnlich dem Ewigen Juden fuhren wir weiter. Das, was ich für die nächste Abbiegung hielt, war bloß ein geräumiger Parkplatz, und als ich mich fast schon nichts mehr traute, waren wir plötzlich richtig und erreichten in einem mächtigen Bogen doch noch die Havelchaussee. Glücklicherweise, denn die nächsten elf (!) Straßen, die rechts von der Heerstraße abzweigten, wären wieder Sackgassen gewesen.
Als wir im tiefen Dämmer den Gasthof am Schildhorn erreichten, hatte entgegen meiner Planung heftiger Regen eingesetzt. Das schmerzte mich und meine Füße erst recht, als wir den abschüssigen Weg vom Parkplatz zum Ufer hinuntergingen. Auch meine Beschreibung, wie schön es immer sei, bei gutem Wetter hier draußen zu sitzen, tröstete allenfalls Giuseppe, nicht aber mich. Die Anlage ist eine Mischung aus wilhelminischem Schlösschen und Anlegestelle, aber das half ja nun alles nichts. Wir mussten rein und – was noch schlimmer war: Essen bestellen!
Das erste Mal war ich am 3. September 1987 hier gewesen. Ich war aus Wien eingetroffen, hatte unsere Berliner Dienststellenleiterin Hildegard Heyse1 in der ‚Kempinski‘-Halle zurückgelassen und war mit Michael2 und Jürgen3 herausgefahren aus der Stadt. Es war ein Abend wie Anfang August. Kähne in der Abendsonne, Lachen in der Luft. Junge Menschen, volle Tische, gutes Essen. Meine erste Reise seit Rolands Lungenoperation, der Anfang vom Ende. Vor zehn Wochen hatten wir an meinem Geburtstag mit Roland und meinen Eltern auf der Havel Würstchen gegessen. Ausflugsdampfer. Inzwischen war die Welt eingestürzt. Die Grenze zwischen Juli und August, zwischen Himmel und Hölle, zwischen friedliebendem Sacrow und ausbeuterischem Kladow. Inzwischen ist Roland tot, Michael und Jürgen sind nach zwanzig Jahren getrennt. Ist es da nicht schöner, mit Giuseppe am Tisch zu sitzen, als draußen im Regen zu stehen? Nichts mehr zu wollen, vor allem nicht die Speisekarte. Enttäuschung statt Verbitterung. Wehmut statt Schmerz. Reicht das? Ich trank mein Glas aus und Giuseppe aß meinen Teller leer. Dann fuhren wir fort. Heerstraße, Kaiserdamm, Bismarckstraße, Straße des 17. Juni bis zum Brandenburger Tor, immer geradeaus, immer geradeaus – nach all den Biegungen und Wendungen. Wenn man von den Einfahrten, Irrfahrten und Sackgassen absieht, so waren wir aus der Garage rechts nach Schöneberg abgefahren und wollten links aus Tiergarten wieder in die Garage zurück. So lob’ ich mir einen Ausflug! Bloß, dass das nicht klappte. Das Ticket funktionierte nicht. Wir stellten den Wagen an einem Platz ab, für den das Halteverbot erst ab 6 Uhr morgens galt und nicht für Italiener. Als ich sah, dass auch Giuseppes Feldbett aus dem Schlafzimmer entfernt worden war, dämmerte mir, dass ich wohl Ross und Reiter nur bis zum Wochenende gebucht hatte.
Ich räumte Giuseppe eine Hälfte meiner Breitwandliege ein und gab ihm großmütig meine Bettdecke. Ich bin ja nicht aus Kladow, außerdem lag er westlich von mir. Mich selbst bedeckte und begnügte ich mit dem mäßig dekorativen brokatartigen Überwurf.
Giuseppes Schönstes ist es, den Tag mit Telefon-Sex-Werbung aus dem Fernsehen zu beschließen. Nach zehn bis fünfzehn Minuten Standfotos und einer immer wiederkehrenden lechzenden Weiberstimme, die sich zunächst an einer Telefonnummer aufgeilt und dann informiert: ‚Ich bin so feucht‘, kommt der Zapfenstreich. Mit dem letzten ‚Ruf an, ruf an!‘ betätigt Giuseppe die Fernbedienung und löscht das Licht.
Albträume sind vorprogrammiert.
Who is who (Akkordeon)
1 – Hildegard Heyse
[ˈhɪldəgaʁd] [ˈhaɪ̯zə]
Hildegard Heyse war die Repräsentantin der ‚Deutschen Grammophon‘ in Berlin gewesen. Sie fürchtete sich vor niemandem und behandelte gefeierte Dirigenten und gefeuerte Aushilfskellner gleich schlecht. Ansonsten war sie allerdings nicht besonders sozial eingestellt, stattdessen gut befreundet mit mir und streng verfeindet mit Dorothee. Beides selbstverständlich.
2 – Michael Zachow
[ˈmɪçaːʔeːl] [ˈt͡saxo]
Etwas jünger als ich. Studienrat und Kunsterzieher, Freund von schwarzem Leder und von ↓
3 – Jürgen Haug
[ˈjʏʁɡn̩] [haʊ̯k]
Etwas älter als ich. Architekt und Schwabe. Trägt ab und zu auch Stoffkleidung.
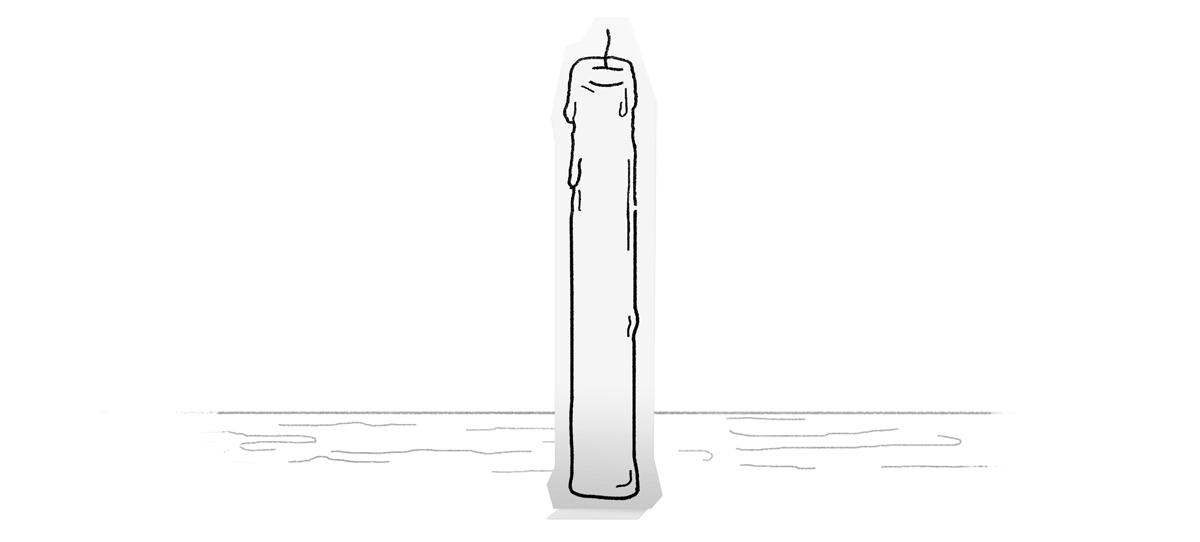
Titelgrafik mit Material von: Artiste2d3d/Shutterstock (Felsen- und Tannenkombination), OTFW, Berlin/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Venezianischer Löwenbrunnen, Kladow), Membeth/Wikimedia Commons, CC0 1.0/public domain (Heilandskirche Sacrow), Zeno.org/Wikimedia Commons, gemeinfrei/public domain (Postkarte ‚Gruß aus Schildhorn‘)









































































„Ich bin so feucht“ habe ich ewig nicht mehr gehört. Also ich meine damit speziell diese Fernseh-Spots. Die liefen früher auf den Privaten nachts doch ununterbrochen.
Ob sich das jemals finanziell gelohnt hat?
Oft sind oder waren das doch solche Abzockegeschichten, oder?
Mehr als im Blog-Text kann ich leider zu dem Thema nichts beisteuern.
Was für Geschichten das Leben (under der Krieg – Achim!) schreibt…
Wo man hinfasst, findet man was. Man muss es nur formulieren können.
„Festhalten, teilen und entweihen“ trifft es ganz gut. Die vielen Vorteile der modernen Kommunikation bringen eben auch ebenso viele Nachteile mit sich.
Naja, vielleicht überwiegen die Vorteile doch ein bisschen.
Die sozialen Medien kann man, wenn es nach mir geht, gerne wieder abschaffen. Mein Smartphone möchte ich im täglichen Leben aber trotzdem nicht mehr missen.
Abschaffen ist immer so eine Sache. Das, was dann an die Stelle tritt, ist nicht immer so gut wie Öko-Strom.
Genau mit dieser Problematik wird sich Herr Musk nun auch beschäftigen müssen. Dass er mit Twitter unzufrieden ist, nun gut, aber ob er etwas Besseres daraus machen wird, bleibt abzuwarten.
Er will Twitter ja nicht abschaffen, sondern die Meinungsfreiheit wieder herstellen. Nicht, dass das einfacher oder zwangsläufig eine richtige Entscheidung wäre. Hier in Europa wird er sich eh mit den bestehenden Gesetzen auseinandersetzen müssen. In Amerika ist das vielleicht etwas anderes.
Bei all den Falschinformationen, die über Twitter und Facebook verbreitet werden, hat er sich da eine schöne Aufgabe rausgesucht. Viel Spaß.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Musk da wirklich ins Detail gegen wird. Ein paar Richtlinien und eigene Tweeds im eigenen Kanal – das war’s.
Wirklich interessant. Ich bin, wenn ich in Berlin war, immer nur in der Stadt geblieben. Beim nächsten Mal sollte ich doch etwas mehr herumfahren und das Umland kennenlernen.
Wer wie Herr Rinke in Berlin aufgewachsen ist oder sonst eine persönliche Verbindung hat, für den lohnt sich bestimmt eher. Einfach drauf los ins Berliner Umland zu fahren klingt mir erstmal nicht besonders spannend.
Ach was, da muss man sich doch nur ein paar Anlaufstellen suchen und dann schauen wohin die Reise weiter geht. Man findet doch immer interessante Orte wenn man einmal unterwegs ist.
Finde ich auch. Ich habe ja nach dem Mauerfall nicht Erinnerungen aufgefrischt, sondern Neues entdeckt.
Wer am Ende ans Ziel kommt, der nimmt ja auch gerne die Irrwege in Kauf 🙂
Da sind dann allerdings die größeren, auf denen einem wirklich Unerwartetes widerfährt spannender. Solche, wo man sich einfach verfährt und nicht ans Ziel kommt, die nerven.
Seit wir gelernt haben, dass der Weg das Ziel sei, kann uns ja nichts mehr passieren.
Ja, ich erinnere mich an die Theorie 🙂
So einen entspannten Sommertag – wo ein Lachen in der Luft liegt – das gab es in den letzten zwei Jahren viel zu selten! Hoffentlich erleben wir dieses Jahr ein paar davon.
Stimmt schon, die Umstände müssen stimmen, aber vor allem liegt es an uns selbst.
Ich hatte auch während COVID schöne Tage mit Freunden. Dass das Angebot eingeschränkt ist, oder dass man sich in kleinerem Kreis treffen musste, heisst ja nicht gleich, dass man keinen Spaß mehr haben kann. Man muss ihn sich nur suchen.
Man muss sich das Leben schon schön machen. Von alleine passiert das nicht. Das gilt ja sogar mit und ohne Corona.
Möglichst eigene Ideen verwirklichen und nicht auf Glücksanbieter für Freizeit und Finanzen hereinfallen.
Das ist ja eine absurde Idee, dass dort zwei kleine Örtchen durch einen Pfosten auf der Straße abgetrennt werden. Welche Idee da wohl dahinter steckt?
Na solche Grenzen gibt es aber doch immer wieder…
Inzwischen ist das natürlich vorbei. Die Sacrower dürfen nach Kladow, die Marzahner nach Dahlem und nur Privatgrundstücke können den Zugang verwehren.