Dann kam Werder. Schon aus der Ferne hatte das Riesenrad mich ein wenig argwöhnisch gemacht, aber ich war in keiner Weise vorbereitet auf das, was uns erwartete. Man muss vergessen, dass man das Wort ‚Rummel‘ kennt, man muss es einfach mal als Lautmalerei auf sich wirken lassen: mit hartem, brutalem ‚R‘, kurz geblöktem ‚U‘ und einer nicht enden wollenden Kette fest gepresster ‚M‘, die in dieses fiese Rattenschwänzchen ‚el‘ münden.
Was für Las Vegas die Spielautomaten sind, sind für Werder die Jahrmarktsbuden. Von der Anlegestelle über die ganze Insel, das Kopfsteinpflaster entlang, wälzte sich eine undurchdringliche Menschenmasse zwischen den Ständen hindurch, die alles führten, was schlecht und billig ist. Dahinter nahm man schemenhaft die verfallenen Häuser an der Hauptstraße wahr.
Diesmal konnte ich auch nicht wegrennen: Bo und Ingrid hätten mich niemals wiedergefunden und auch überhaupt nichts anderes. Man hätte sie mit Blaulicht direkt nach Stockholm transportieren müssen.
An jedem zweiten Stand wurde der berühmte Obstwein ausgeschenkt, und die Menschen schienen auch schon reichlich davon genossen zu haben.
Als ich jenseits der Buden nicht mehr abgeblätterten Putz, sondern trübes Wasser sah, wusste ich: Jetzt verlassen wir endlich die Insel, nun kommen wir aufs Festland. Ansonsten änderte sich schier gar nichts. Die Straße war wohl etwas breiter angelegt, was noch mehr Ständen Platz bot. Ich fand auch den Weg den Hügel rauf, der übrigens überraschend steil war, doch meine Hoffnung, dass diese Unebenheit den Bingo-Buden und Bratwurst-Verschlägen Einhalt gebieten würde, erfüllte sich nicht. Es war heiß, staubig und stank nach zu Tode gebratenem Schmalz. Dass wir nicht mehr im Ort waren, erkannte man daran, dass in mancher Lücke zwischen zwei Bretterbuden ein blühender Obstbaum aufleuchtete: Baumblütenfest in Werder.
Die Masse wälzte sich des Hanges wegen immer träger. Der beißende Qualm und der kreischende Lärm bildeten eine undurchdringliche Einheit. Ich bin absolut sicher, dass diese Mischung jeden feinsinnigen Menschen zu Tode gefoltert hätte, aber nicht nur ich, sondern auch Bo und Ingrid schienen noch am Leben, also stumpfsinnig, zu sein, als sich plötzlich eine Lücke in der Budenmauer auftat: Ein Obstgarten, Menschen saßen an langen Tischen und standen Schlange vor zwei Ständen, die Obstwein ausschenkten. Ich schöpfte neue Hoffnung, ohne direkt zum Bleiben animiert zu sein. Dann schloss sich die Budenmauer wieder. Der Volksborn begann aber, etwas verhaltener zu rieseln. Ich sprach zwei Mädchen an: „Kommen hier noch Lokale?“ – „Ja, da oben, die Friedrichshöhe.“ Genau, das war der Name gewesen, den die drei ohne Augen im Hinterkopf erwähnt hatten!
Endlich konnte ich wieder rennen, ohne befürchten zu müssen, dass mich Ingrid und Bo verlieren würden. Die Jahrmarktskette bröckelte ab. Rechter Hand lag ein Areal, halb Park, halb Parkplatz, ein Eingangstor, ein wilhelminischer Bau, dahinter eine weit gestreckte Terrasse unter mächtigen Kastanien. Von der Balustrade schweifte der Blick hangabwärts auf die Havel, die – mal See, mal Fluss – durch das strahlend grüne Land zog.
Zu meiner Begrüßung beendete die Band, die, elektronisch hundertfach verstärkt, dieselben Beatles-Songs geplärrt hatte, die mich schon in ihrer gesäuselten Synthesizerform am Kempi-Eck so genervt hatten. Menschenstimmen, Vogelzwitschern, Geschirrgeklapper – welche Erholung!
Ich misstraute der Küche wie den Küchen aller Ausflugslokale und hoffte, wir kämen vielleicht mit einem Obstwein davon. Aber natürlich sagte Bo: „Vielleicht kann man etwas essen, eine Kleinigkeit.“
Wir saßen also am weißen Tischtuch unter zahlreichen anderen Gästen, nichts Großartiges, im Gegenteil: klein und artig, eine klebrige, gemütliche Eingebundenheit, aber ganz unbedrohlich, sicherlich auch schon zu Mauerzeiten. Ich versuchte mir Guntram mit seinen Brüdern zu erblinzeln, aber ich sah nur DDR. Trotzdem: Es war das Paradies, denn das Paradies ist da, wo die Hölle aufgehört hat. Der Kellner, eine freundliche Ost-Tunte mit Ring im Ohr, brachte Teller mit Schrecklichem, und unten floss die Havel. Das waren wir alles zu Fuß raufgetapert, bei der Hitze, durch das Budengestrüpp.
Doch nun zum Obstwein! Ich hatte für uns ‚Kirsch‘ bestellt, nicht nur weil der Kellner gestand, das sei seine Lieblingssorte, sondern weil ich mir gegenüber ‚Erdbeere‘ davon eine gewisse aparte Frische versprach. Alles ist relativ. Also, ich jedenfalls fand, das Getränk hatte die süße Frische von Irenes österlichem Weihnachtsgebäck. (Man isst ja nicht alles auf bis Silvester.) Zugutehalten musste ich der Flüssigkeit, dass ich schon ziemlich angeheitert war, als ich mir ein zweites Glas bestellte, allerdings wählte ich diesmal Schlehe, und in der Tat, so ein ganz klein wenig herber war die Anmutung. „What is ‚Schlehe‘?“, fragte Ingrid. Nun erklär mal jemandem, was eine Schlehe ist, der den Hasen nicht vom Jäger unterscheiden kann. Nachdem ich mich fünf Minuten lang abgeplagt hatte, hatte sie endlich begriffen. „Aah!“, nickte sie, „björnbär in Swedish“. Ich trank mein Glas leer. Jetzt auch noch den botanischen Unterschied zwischen Brombeere und Schlehe abzuklären, schien mir einfach zu geschmäcklerisch. Den Vierzehn-Uhr-siebenundvierzig-Zug hatten wir sowieso verpasst, aber gleichzeitig mit der Nennung dieser Uhrzeit hatte uns der Kellner versichert, zum Baumblütenfest gäbe es jede Menge Extra-Züge. Pro Person hatte ich fünfzehn Mark für die Rückfahrt per Dampfer verschwendet, aber dafür bekäme ab Potsdam unsere Vierzig-Mark-Wochenkarte wieder Gültigkeit. Das galt es, gegeneinander aufzurechnen.
Gelassen blickte ich ins Tal hinab, wäre da nicht die Havel, dann könnte es auch Hessen sein, aber mir war so heimatlich ums Herz. Für Guntram kaufte ich eine Flasche Obstwein, Sorte Schlehe, dann traten wir den Fußmarsch – die Treppe hinab, dem Bahnhof entgegen – an. Neben der Treppe verlief eine Art Ausbuchtung. „Ja sicher“, sagte Guntram abends am Telefon, „das hätt’ ich dir sagen können. Wir waren auch immer auf der Friedrichshöhe. Gibt es da noch die Rinne neben der Treppe, in der die Schnapsleichen den Berg runtergekullert werden?“ – Dafür war es noch zu früh.
Vom Fuß der langen, langen Treppe gingen wir nicht mehr als zwanzig Minuten durch Straßen mit biederen Häuschen in pütscherigen, blühenden Gärten zum Bahnhof. Und wirklich, der nächste Sonderzug verließ Werder in einer Viertelstunde. Acht Minuten später waren wir wieder in Potsdam. Dort stiegen wir in die S-Bahn und erreichten nach weiteren fünfundzwanzig Minuten den Savignyplatz.
Bevor ich mich für ‚Let’s pop‘ umziehen musste, war noch genügend Zeit, um Dorothee anzurufen. Sie wolle Bo und Ingrid natürlich unbedingt kennenlernen und schlug auch gleich ein Lokal vor: „Das ‚Schell‘ ist sehr nett, ‚Schell‘ wie: ‚Schell‘“, sagte Dorothee, und ich wusste nicht, meinte sie wie Maria und Maximilian aus der Schauspieler-Dynastie oder wie Muschel. „Ich kann dir die Nummer geben.“ Ich schrieb sie zwar auf, bestellte aber stattdessen für heute einen Tisch im ‚Abendmahl‘ und machte mich musicalfein. Herausgeputzt rannte ich zur Abendkasse, holte unsere Karten ab, zweite Reihe, gut, und lief zurück zum Hotel, um Bo und Ingrid abzuholen. Dann wieder zum Theater, in die Lücke in der zweiten Reihe. Vorhang auf: ‚Let’s pop!‘
Na schön, Hamlet, Maria Stuart und Don Carlos werden auch nicht ganz so gewesen sein wie in den gleichnamigen Theaterstücken, aber sie saßen auch nicht vorne im Publikum bei ihren Uraufführungen, sondern waren bereits mehrere hundert Jahre tot. Außerdem wollten ihre Autoren an diesen Figuren exemplarisch etwas aufzeigen. Das darf man von einer Schlager-Revue nicht verlangen, aber man kann von der renommiertesten Musicalbühne Deutschlands, wenn sie mit dem Anspruch auftritt, die Sechzigerjahre auferstehen lassen oder auch nur persiflieren zu wollen, erwarten, dass die Unterhaltung sich nicht darauf beschränkt, die Flower-Power-Generation in San Francisco als schwachsinnige Haschkonsumenten darzustellen und die Berliner Studentenbewegung auf ‚Orgien‘ (dieses Wort wurde auf der Bühne ständig benutzt) und den Satz: ‚Das müssen wir erst mal ausdiskutieren‘ zu reduzieren. Es kommt mir etwas billig vor, heute Dinge in Kalauern abzutun, die vielleicht vor dreißig Jahren wütende Proteste der Revoltierenden nach sich gezogen hätten, aber heute keine Oma mehr aus dem Altersheim locken.
Ich konnte die Sechzigerjahre nicht leiden, finsterste Hetenzeit, politisch und sexuell fühlte ich mich im Abseits, aber das haben sie nicht verdient, als orange-grüner Blödkram humorloser Sektierer abgetan zu werden.
Immerhin, flott inszeniert war es. Der ganze Unterschied zwischen Ost und West hätte nicht augenfälliger sein können: Gestern im Friedrichstadtpalast bierernste Bombastik, heute im Theater des Westens: Hauptsache, schräg. Nichts, was zynisch ist und früher mal als schweinisch gegolten haben könnte, darf ausgelassen werden. Dazu wieder die unvermeidlichen Beatles-Songs, aber auch die Supremes- und Heino-Veräppelungen. Ich war gekommen, um mich zu amüsieren, genau wie Bo und Ingrid, und das gelang uns auch. Nach dem dicken süßen Pudding gestern tat so ein kross gebratenes Würstchen ganz gut, auch wenn man schon beim Runterschlucken merkte, dass es eigentlich nichts als scharf war.
Der Anspruch des Stückes und seiner Handlung erlaubte es durchaus, die Gedanken schweifen zu lassen: Der Sozialismus war ungeschickt und unschick. Aber wird eine andere Form von Sozialismus doch siegen? Er wäre doch das, was die ‚Massen‘ wählen müssten. Das Einzige, was sie davon abhält, ist, dass sie so begeistert sind von starken Führern, da wählen sie dann auch gerne eine Partei, die ihnen wirtschaftlich und rechtlich eher schadet, bewundern ihre Sportidole und glotzen im Kino auf die Stars. Rein finanziell betrachtet kann mir das eher recht sein.
Rudi Dutschke ist kein Mythos wie Che Guevara geworden, obwohl er der bessere Mensch war, wie ich finde. Vielleicht hätte er nach dem Attentat gleich tot sein müssen. Oder gar nicht erst getroffen werden dürfen. Aber wie wäre es weitergegangen? – Wenn er Klavier gespielt hätte, hätte ich ihn zum Star gemacht, selber schuld.
Das ‚Abendmahl‘ ist auch ganz schön schräg. Es liegt mitten in Kreuzberg, hat die Schlichtheit einer Obdachlosen-Beköstigungsstelle, allerdings überall Christusbilder an den Wänden, auf der Theke diverse, sehr bunte Christus-Figuren und ein ausgesprochen pietätloses Publikum. Es muss ja noch jemand in der Küche sein, sehen tut man nur zwei dürre Homosexuelle in T-Shirts und Jeans, die bemüht sind, mit dem Vorteil aufzuräumen, Tunten seien immer überfreundlich. Ja, so was sollten Bo und Ingrid auch mal sehen, hier waren sie endlich zum ersten Mal overdressed. Ich wundere mich selbst, dass ich es neidlos tue, jedenfalls muss ich anerkennen: Keinen der drei Gänge hätte ich so hinbekommen.
Es war das einfallsreichste und bestschmeckende Essen, das ich seit vielen Jahren über die Lippen gebracht habe. Auf der Speisekarte kein Fleisch, nur Fisch und Gemüse, aber Selbstironie: Zu Ingrids Blutorangen-Soufflé (‚Bloody Hospital‘) gab es ein Pflaster aus Marzipan. Zu Bos Pasta (‚Directly from Rome‘) eine Luftpostmarke auf den Tellerrand geklebt. Das ist nur dann komisch, wenn das Essen selbst so vorzüglich ist, wie es nun mal war. Bo, den ich in kulinarischen Dingen nicht unbedingt für einen Experten hielt, sagte dann doch, wenn er wieder nach Berlin käme, wollte er da noch mal hin. Das hat er von keinem anderen Lokal gesagt.
Ein Taxi beförderte uns aus der Arbeitergegend zum ‚Interconti‘. Ich wollte den Abend auf dem Dach mit Blick auf Berlin und raffiniert gemixten Drinks beschließen. Wir konnten die endlos lange Halle des ‚Interconti‘ bewundern, mehr auch nicht. Die Bar unterm Dach gäbe es schon seit Jahren nicht mehr, wurde ich aufgeklärt. Dafür machten wir einen schönen Spaziergang zu unserem Hotel und ließen den Abend geschwinden Schritts ausklingen.
Sonntag Abend, das war meine Zeit, komischerweise hab‘ ich sonntags unterwegs immer mehr erlebt als freitags oder samstags. Die letzte Chance macht die Suchenden vielleicht fiebriger. Das Wochenende soll doch nicht umsonst gewesen sein. Knaben-Knutschen, Knistern, Kneipen, ‚Knolle‘, ‚Knast‘. Jaja, gute Nacht!

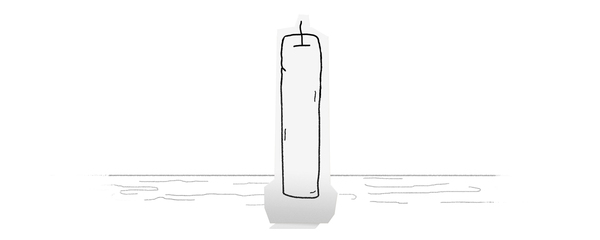
Titelgrafik mit Material von: Paris Orlando/Wikimedia Commons/gemeinfrei (Leonardo Da Vinci – ‚Das letzte Abendmahl‘), Christoph Hoffmann/Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 DE (Luftpostmarke), H. Zell/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Schlehenbusch), AnRo0002/Wikimedia Commons/gemeinfrei/CC0 1.0 (Schlehenfrucht) sowie von Shutterstock: Danilova Janna (Pasta), MarcoFood (Kirsche), FotoIdee (Pflaster), by-studio (Umleitungsschild)
#2.05 (E) | Sonntagsausflug#2.05 (G) | Muschel oder Filmschauspieler?









































































Ob Maria Stuart ein Theaterstück über ihr Leben spannend gefunden hätte?
Sie hätte sicher lieber die Rolle von Elisabeth gehabt.
Verständlich
„…sehen tut man nur zwei dürre Homosexuelle in T-Shirts und Jeans, die bemüht sind, mit dem Vorteil aufzuräumen, Tunten seien immer überfreundlich.“ 😂
Inzwischen agieren so bemüht ja nur noch Heten-Schauspieler in Schwulen-Rollen.
Da interessiert mich dann wie das Method-Acting abläuft…
So, wie wenn ein Weißer Othello oder Winnetou spielen muss.
Jared Leto schleppt sich aber doch sicherlich durch jeden Lederclub bevor er zum Set geht und dreht.
Tut er nicht nur so? Er nimmt sich ja gerne selbst sehr wichtig.
Bei sich selbst fängt es an. Da merkt man dann, wie vielschichtig eine Persönlichkeit sein kann und forscht weiter. Es sei denn, die Befriedigung ist nicht mehr zu überbieten. (Wie etwa bei Trump.)
Method-Acting scheint mir in den letzten Jahren eh ein wenig dazu missbraucht zu werden sich selbst wichtig zu machen. Viele Berichte aus Hollywood lasse mich jedenfalls den Kopf schütteln. Dass Mrs. Gaga z.B. monatelang mit diesem albernen Akzent durchs Leben gelaufen ist, macht ihre Leistung in House of Gucci noch lange nicht besser.
Schlecht und billig trifft es bei Jahrmärkten ja ganz gut. Ich mag es aber trotzdem manchmal gerne.
Ich finde Jahrmärkte eigentlich ganz charmant. Es muss ja nicht immer hochklassig und -preisig sein.
Menschen mit Rudi Dutschke T-Shirts wären recht bizarr.
Bizarre T-Shirts sind doch die Regel. Putin als Dragqueen kommt zurzeit besonders gut.
Gutes Argument. Wobei, bei Che meinen es die Leute ja eher ernst.
Die Zeit ist glaube ich mittlerweile auch vorbei.
Bei dem, was man auf der Brust trägt, vermischen sich Ernst und Ironie, jedenfalls im Westen.
Die ‚Hier-bin-ich-Mensch, hier-darf-ich’s-sein‘-Attitüde zeigt ja bereits, dass es sich eher um einen Ausflug als um Zugehörigkeit handelt.
Sonntag steht bei mir immer schon die Sorge um den kommenden Montag auf dem Programm. Da war ich noch nie wirklich abenteuerfreudig.
Na sorgen muss man sich ja nicht gleich. Ein bisschen Ausruhen reicht doch auch.
Es reicht doch, wenn das Unbehagen vor der neuen Woche beim Zähneputzen einsetzt.
Ach so schlimm ist das meistens doch gar nicht. Spätestens Dienstag hat man sich wieder eingewöhnt.
Hauptsache Freitag Abend gelingt die Ausgewöhnung. (Ich hatte Geschäftsreisen meistens am Wochenende: Konzerte, Premieren in London, München, Wien.)
Das klingt immerhin aufregend genug um das Wochenende zwischendurch mal zu opfern. Also natürlich nur wenn es trotzdem den einen oder anderen freien Tag gibt.
Die freien Tage habe ich mir dann unter der Woche genommen, wenn die Geschäfte offen waren, oder an den Urlaub drangehängt. Meine work-life-balance war schon damals schwer in Ordnung.
Ich habe mal von einem Tontechniker gehört, dass die ersten Reihen gar nicht besonders gut sind, sondern dass man in der Mitte des Theaters einen viel besseren Klang hat. Stimmt das?
Ja! Der Zusammenklang von Blech und Streichern ist organischer.
Oh, das ist ja wirklich mal ein guter Tip. Meine erste Idee wäre ja immer so nah wie möglich am Geschehen zu sein. Interessant, dass das gar nicht unbedingt die beste Wahl sein muss.
Haha, Bo gefällt mir ja ganz gut. Ich kann auch immer eine Kleinigkeit essen 😆
Wer kann das nicht… Gerade Ausflüge machen ja auch hungrig.
Und durstig.
Wenn ich mich und andere vorher nicht ein bisschen gequält hatte, fand ich, wir hatten uns Brezel und Bier oder Schalentiere und Champager nicht genügend verdient. Auch in diesem Jahr hungere ich mich wieder auf das Osterlamm hin.
Das Bier oder der Rosé (je nach Geschmack) schmecken ja auch selten besser als nach einem ausgedehnten Entdeckungs-Spaziergang in einer fremden Stadt. Mir sind das jedenfalls die liebsten Momente im Urlaub.
Schön, wenn dann da auf geratewohl irgendwo einkehren kann, aber das trau ich fußlahmer Greis mich nicht mehr.
Dieses Essen klingt großartig. Gibt es das Lokal denn noch?
Angaben widersprüchlich. Zumindest anscheinend nicht in der damaligen Form
Ich hatte im Netz (es gibt ein kurzes Youtube-Video) auch den Eindruck, dass es das Abendmahl nicht mehr gibt. Mich hätte das auch interessiert. Schade.