

Mittwoch, 26. Juli
Gegen zwölf wachte ich auf, zu einer Zeit also, von der ich vermute, dass rechtschaffenere Menschen als ich bereits an den Feierabend denken (Huren, Einbrecher und Souffleusen ausgenommen). Umso eifriger fing ich an zu organisieren, nicht den Tag, dafür war es zu spät, aber die Zukunft. Am 1. August würde Volker mich nach Hamburg zurückbringen, am 2. August sollte Guntram mit Krankenwagen ins ‚Hilton‘ Altona eingeliefert werden, in die Urologie, am 3. August war für Irene ein Zimmer in St. Georg in der Herzklinik reserviert. Eigentlich hatte Guntram nur für die Dauer von Irenes Untersuchungen (und vielleicht anschließendem Meran-Aufenthalt von sechs Wochen) ins Pflegeheim gebracht werden sollen, aber weil Irene das Krankenhaus weniger trostlos fand als das Pflegeheim, disponierte ich entsprechend um. In der Neurologie war der Abteilungsleiter auf Urlaub, aber Urologie passte ja auch ganz gut. Verschaukeln wir ihn? Ich bin schon dankbar, wenn er überhaupt einen Wunsch äußert: ein Buch, einen Film, ein Musikstück, eine Speise – aber da kommt nichts. Wieder laufen können – alles andere ist wurscht.
Nur eines Abends sagte er plötzlich: „Quark würde ich gerne wieder mal essen.“
Ich rannte sofort in die Küche und kam mit einem Teller und zwei Scheiben Brot zurück. „Hier“, sagte ich, „also, es ist nicht direkt Quark, aber Fleischsalat.“
Später stellte sich heraus, dass er gar nicht Quark meinte, sondern Schichtkäse, und als ich den dann besorgte, war ihm nur noch nach Hafersuppe. Die Sterbenden klammern sich an die Lebenden und sind neidisch auf sie, und die Lebenden versuchen zu helfen und sich zu wehren.
Das Wetter war nicht schlecht genug, um wieder ins Bett zu gehen, und so beschloss ich, ein einziges Mal während meines Berlin-Aufenthalts das zu tun, was ich mir vorher in Hamburg als tägliche Beschäftigung ausgemalt hatte: Ich packte Bernstein-Manuskript, Schreibblock und Filzstifte in eine halbwegs ansehnliche Plastiktüte und zog mir ein frisches Hemd an. Frisch deshalb, weil ich es neben anderen Dingen in die Wäscherei gegeben hatte, von der es schon wieder mit der besserwisserischen Belehrung zurückkam: ‚Kragen stark verschmutzt‘. Lässt die Waschfrau, wenn sie ägyptische Erde aufträgt, etwa den Hals weg? Hört sie beim Kinn auf, sodass jeder gleich sieht, dass sie (zu wenig) Make-up aufgelegt hat? Von so einer Gans lasse ich mir doch meine Schminktechniken nicht vorschreiben!
Meine eigenen Manuskripte ließ ich unangerührt auf dem Schreibtisch liegen, und mir war klar, dass sie von dort aus nur noch zurück in die Reisetasche wandern würden, ohne das Licht der Berliner Kaffeehausszene gesehen zu haben – ein Los, das sie mit ihrem Erdichter teilten. Unser einziger Trost ist, dass es die Szene meines Wissens nicht gibt, und an dem Bemühen, ungeeignete Stellen mit aller Gewalt zu schillernden Treffpunkten machen zu wollen, sind schon Sexbesessene, Hoteliers und Freiluft-Veranstalter kläglich gescheitert; Weltverbesserer und Weltverschlechterer, die das Pech hatten, nicht aus Silicon Valley, New York oder Bethlehem zu kommen. Warum also sollte ich ein überflüssiges Buch über einen von Sehnsüchten und Hass gequälten Durchschnittsmenschen in einem Literatur-Café, das es nicht gibt, wo man allenfalls Feuilleton schreibt, was man nicht mehr tut, überarbeiten wollen und dabei Wein zu mir nehmen, den ich nicht mehr trinke? Stattdessen zwinge ich mich, so langsam, dass es ziellos erscheinen mag, zum Speiselokal ‚Dressler‘ zu gehen, Unter den Linden, unter den Leuten. – Ein Kompromiss. Ich bestelle einen Liter Mineralwasser – kein Kompromiss – und warte noch mit der Essensbestellung.
Es ist Zwischenzeit. Die Berlinerinnen essen noch Kuchen und die Touristen noch Eis. Die Geschäftsleute legen schon ihre Handys neben die unangetastete Speisekarte und bestellen Bier oder Gin Tonic. Die Musiker bleiben wieder stehen, holen ihr Instrument heraus und rechnen sich für ihre Mütze oder Büchse bei den Achtzehn-Uhr-Müßiggängern bessere Chancen aus als bei den Eltern zuvor, die mit ihren quengelnden Cola-Kindern beschäftigt waren. Die Zeit bekommt wieder Gewissen, aber nicht jeder merkt es: nicht die Skrupellosen beim Aushecken von Mordsspaß. Nicht die Kranken bei der eigensinnigen Pflege ihrer Leiden; die Angehörigen der Kranken, über deren Leben die trennende Klagemauer Schatten wirft; Parasiten überschleimen ihr Gemüt, ihren Tag. Die Schatten dehnen sich, allmählich werden aus Betroffenen Getroffene. Die Sonne sinkt weiter, das Aushecken überwuchert die Mauer des Anstands, die Kranken fürchten die Dämmerung als Todesmauer, die sie einschließt, während auf der anderen Seite des antisozialistischen Schutzwalls Flucht möglich ist, und da setzen die Skrupellosen ihre Fluchtpläne in die Tat um: nicht Opfer sein, sondern Sieger – lieber Täter sein als Toter. Rückwärts: Friedhofsbank, Schlachtbank, Samenbank. Vorwärts: Reichsbank, Bundesbank, Vabanque. In jeder Deutschen Bank hat jede Devise ihren Kurswert, denn Grenzenlosigkeit bietet – von Tourismus bis Esoterik – die letzte allgemeingültige Be-Währung.
Ich beschließe, etwas zu essen, etwas Richtiges. Drei Gänge lang. Ich bestelle leichte Kost und einen Tisch für Dienstagmittag, meinen Tisch: den, an dem ich sitze; und ich beschließe endgültig, keinen Reisebericht von diesem Berlin-Aufenthalt zu erbasteln: Ich habe nichts erlebt, was das Beschreiben lohnt, von Lesen ganz zu schweigen. Die paar Seiten, die ich im Zug vollgeschrieben habe – weg! Oder wenn ich zu geizig bin, wegwursten in einem anderen Zusammenhang: der eine Satz in einer E-Mail, der andere in einem nicht zur Veröffentlichung vorgesehenen Absatz in einem nicht zur Veröffentlichung vorgesehenen Aufsatz; besser wäre, wirklich weg! Wie bloß hat Herostrat den Artemis-Tempel weggekriegt? Für die Bibliothek von Alexandria brauchte Cäsar noch Feuer. Ich kann per Mausklick ein Jahr Formulierungswut beseitigen: das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reduzierbarkeit – auf die Schlagzeile, auf die Diskette, auf den Müll.

Titelbild mit Material von mmphotographie.de/Shutterstock (Tonne), Wladyslaw Golinski/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Hintergrund, Bildausschnitt)

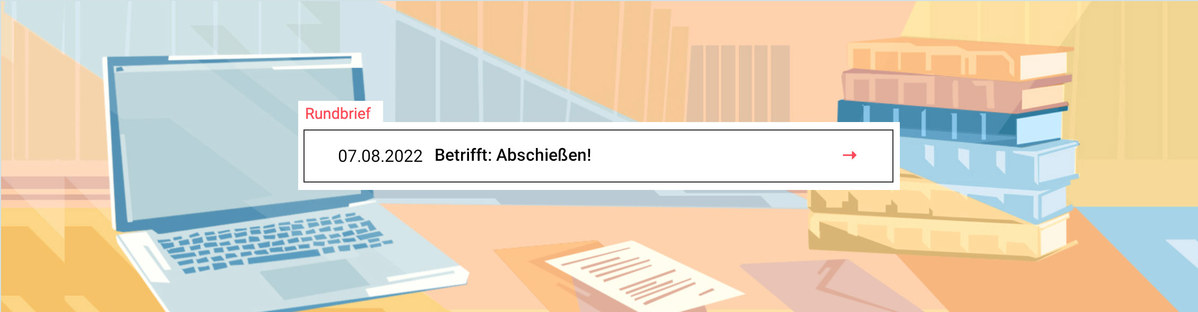







































































Wo diese Musiker wirklich die besten Chance haben, würde mich auch mal interessieren…
Wahrscheinlich ist das einfach immer dort, wo viel getrunken wird und die Leute in guter, lockerer Laune sind.
Ja, dort, wo sie am meisten für gute Stimmung oder bedrückendes Mitleid sorgen.
„die Lebenden versuchen (…) sich zu wehren“
Starker Tobak, aber ja, Sie sprechen da einen guten Punkt an.
Wogegen genau wehren sie sich denn? Gegen den Tod? Oder das Verlassenwerden?
Die Lebenden wehren sich gegen den Rund-um-die-Uhr-Anspruch der Sterbenden.
Eine schwere Aufgabe
Das ist für beide Seiten wohl mit das Schwerste, was im Leben passiert. Da prallen ja einfach mal zwei Realitäten aufeinander. Die einen müssen loslassen um sterben zu können, die anderen müssen versuchen loszulassen um weiterleben zu können.
Viermal war ich schon der Weiterlebende. Der andere ist man nur einmal.
Dabei würde ich mich auch schon über eine kleine Berliner Kaffeehausszene wirklich freuen!
Gibt’s aber nicht!
Formulierungswut oder Formulierungsfreude – man fragt sich ja gleich welches dieser Beiden wohl mehr Leser in den Bann zieht. Braucht ein guter Text Lust oder Zwang? Am Ende ist es, wie so oft, bestimmt wieder eine gute Mischung.
Die Art der Motivation spielt glaube ich keine so große Rolle, solange sie da ist. Wenn das Resultat ein spannender oder unterhaltsamer Text ist, dann findet er bestimmt auch seine Leserschaft.
Die Mischung aus Engagement und Abstand ist wichtig: Dramatik und Humor.
Dass Literatur mittlerweile digital erscheint oder zumindest so konsumiert wird, daran habe ich mich ja gewöhnt. Ich lese ja selbst online. Aber dass heutzutage nun auch Kunstwerke als NFTs vermarktet werden, also dass ein Damien Hirst z.B. seine Originale zerstört, dass geht mir doch zu weit.
Für ein wenig PR tut man ja vieles. Aber mir scheint so etwas immer noch eine ziemliche Ausnahme zu sein.
Kreativität und Zerstörungswut sind zänkische Geschwister. Künster, die ihre als misslungen empfundenden Werke vernichten, sind keine Seltenheit.
Bei Hirst konnte man sich wohl aussuchen ob das NFT oder das reale Kunstwerk weiter existieren soll. Ich finde seine Arbeiten eh nicht besonders interessant. Egal ob digital oder im Museum.
Soll er sich über seinen Ruhm und seine 700 Millionen € zu Lebzeiten freuen, bevor er in Formaldehyd eingelegt wird.