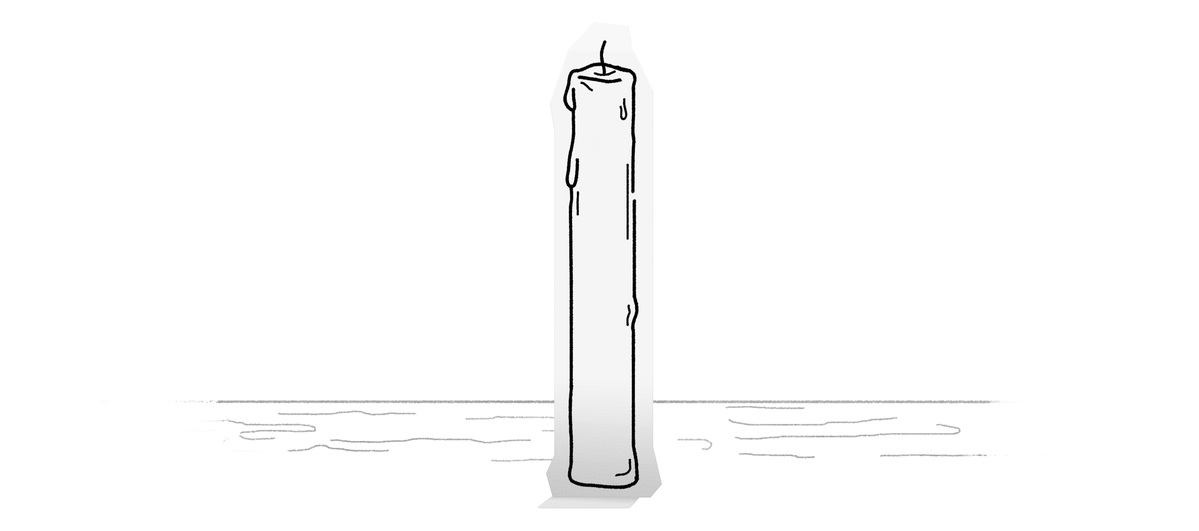

Sonntag, 2. Juli
Heute setzt das Ausflugsprogramm ein. Wie immer zuerst in östlicher Richtung, und das bedeutet bei mir Köpenick. Zu irgendeinem Zeitpunkt hebe ich den Kopf. Wenn Giuseppes Feldbett leer ist, weiß ich, dass ich demnächst aufstehen sollte. Ich stakse ins Wohnzimmer, er sieht auf von dem, was er tut, und sagt ohne jeden Enthusiasmus: „Buongiorno.“ Ich antworte dynamisch: „Buongiorno!!!“, und fühle mich, als ob ein langer Arbeitstag zu Ende ginge. Sobald ich im Bad verschwinde, fängt Giuseppe an, das Frühstück zu machen. Nach wie vor sehe ich nicht so schlimm aus, wie ich mich fühle. Ich hasse die vom Teebeutel braun gefärbte Flüssigkeit und den bröseligen Zwieback, nur das Pflaumenmus mag ich. Wie ist Giuseppe bloß darauf gekommen, Pflaumenmus zu kaufen? Es schmeckt so böhmisch.
Die Fahrt nach Köpenick ist kompliziert und lohnt die Mühe nicht. Aber Giuseppe hat Geduld und einen guten Orientierungssinn. Ich habe Eigensinn und Erinnerungen.
Die Sonntagmittagsstimmung ist schön, wenn immer mal wieder die Sonne scheint, besonders am Wasser. Ein kleines Fest liegt in der Luft, Frühschoppen und Schmorbraten. Ringsum ist die Spree zugebaut, städtischer als die Havel im Westen, keine Villen, sondern Vierstöckiges. Überall ist Ufer, die Flussbiegungen täuschen einen See vor, wie im Westen die Havel.
Das Köpenicker Schloss ist immer noch versperrt, der winzige Park Baustelle. Nur einmal, 1977, konnte ich die Anlage vom Schilf bis zur Straße ungestört durchstreifen, mit Roland. Damals hielt ich das für nichts Besonderes, zumal ich nur des Hauptmanns wegen hierher gewollt hatte, das Schloss war eine unspektakuläre Zufallsbekanntschaft gewesen, aber im Gegensatz zum Hauptmann vorhanden. Doch dann bekam es dadurch Reiz, dass es geschlossen wurde: bis 1990 wegen Baufälligkeit, von da an wegen Renovierung. Zu ist zu.
Ein Gang über die Brücke, am Rathaus vorbei zum Marktplatz. Gründerzeit-Gestik, Klinker und Stuck. Märkische Kleinstadt, mehr Fontane als Zuckmayer. Am Ufer entlang, Familien im Sonntagsstaat, rührend. Für Giuseppe ist alles neu und alles willkommen, Disco oder Dorf. Für diese Fahrt in die Vorstadt hat er auf seinen sonntäglichen Kirchgang verzichtet. Was Gott wohl denkt?
Kopfstein gepflasterte Stichstraßen zum Fluss hin: menschenleere, stille Gassen; unter Kastanienkronen geduckte Häuser, dicht beieinander, ohne Vorgärten. Bescheidenheit am Rande der Ärmlichkeit. Hier wohnten früher die Fischer. Schwer vorstellbar, wer jetzt hier lebt. Zivilisationsfeinde, Studenten? Romantiker oder Rentner? Verwaltungsangestellte?
Vor neun Stunden waren wir im ‚New Dimension‘ die ältesten Gäste, fast. In einer Dreiviertelstunde könnten wir wieder dort sein, die ersten Gäste. Fünfzehn S-Bahn-Stationen, ohne Umsteigen. In neun Stunden beginnt der Einlass. Alles liegt so eng beieinander: verstiegene Gedankenkrakseleien und platter Stumpfsinn. Philosophie und Demagogie. Fußballstars und Hooligans. Vierzigjahrfeier und Umsturz.
‚Die Mauer in den Köpfen‘, heißt es. Die gibt es nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch zwischen Kellerwohnung und Dachterrasse. Die Quelle der Havel ist von ihrer Mündung in die Elbe 94 Kilometer Luftlinie entfernt. Die Flusslänge beträgt 356 Kilometer. Gewundener geht es nicht. Ich hätte im Ratskeller zu Köpenick mit Giuseppe gegessen. Nicht um zu schlemmen, sondern um in Erinnerungen zu schwelgen, aber ausnahmsweise hatte Giuseppe keinen Hunger, und so groß war mein Appetit auf Vergangenheit nun auch wieder nicht. Wir fuhren zurück. Das Ausflugserlebnis ist dabei so, als führe man von Wedel nach Winterhude die ganze Zeit lang durch Rothenburgsort. Von Manhattan nach Miami durch Müll.
Aus der Tiefgarage im zweiten Untergeschoss beförderte uns der Fahrstuhl ins Parterre. Giuseppe und ich hatten nie eine gemeinsame Arbeit. Wenn man zusammen ist und nicht miteinander arbeitet, verbringt man gemeinsam Freizeit. Giuseppe und ich sind immer tagelang, meist wochenlang zusammen, da muss sich dann nicht einer ständig um den anderen kümmern wie bei einem Kurzbesuch. Wir schlafen, wir reden. Ich schreibe, Giuseppe liest. Giuseppe verlässt das Haus, ich schreibe weiter. Wir essen, wir schlafen. Ich schlafe weiter, Giuseppe liest. Die Zeit läuft ohne Zwang. Hier in Berlin werden die Tage – seltener die Nächte – unserem von mir mit leichter Hand geformten Pflichtprogramm unterworfen. Pflicht ist Glück. Arbeit macht frei. Arbeitslosigkeit ist Unglück. Freiheit machte im Osten oft arbeitslos. Nach der Wende. Früher gehörte es zu meinem Beruf, Programme zu gestalten. Seit ich keinen definierbaren Beruf habe, gehört Programme zu gestalten zum Überlebenstraining.
Als seine Erbtante noch lebte, war sie Giuseppes Pflichtprogramm, und er sagte: „Wenn sie tot ist, bereise ich die Welt.“ Jetzt ist die ‚Tata‘ seit bald zwei Jahren tot, und Giuseppe ist immerhin in Berlin, das sich mehr und mehr für den Nabel der Welt hält.
Der Gendarmenmarkt gilt als der Nabel von Berlin, zumindest ist er, wenn ‚Feldschlösschen‘ nicht gerade für Stimmung sorgt, der schönste Platz, wesentlich distinguierter, also auch ruhiger als die Gegend um die Gedächtnis-Kirche, die vor der Wende als Nabel galt. Dazwischen liegt, anatomisch nicht einzuordnen, das Brandenburger Tor als Wahrzeichen und nach wie vor bestimmt es die Grenze von Lebensgefühlen, aber das wird die Politik, die dort gemacht wird, verwischen. Gehört zum Großstadtnabel, dass es fetzt? Cola, Dreck und grüne Haare? Es gibt keine Bus- oder Bahnstation ‚Gendarmenmarkt‘. Neon-Werbung ist verboten. Könnte so ein Platz auch das Zentrum von Kaiserslautern sein? Unser Pflichtprogramm führte uns vom Nabel mehr in Richtung Oberschenkel, wenn man wie ich Herz und Kopf im Westen geortet hat. Die Gegend nördlich der Linden habe ich erst nach dem Mauerfall angefangen zu erschließen. Vorher war es auch nicht lohnend. Jetzt sind da die Hackeschen Höfe, wo ich Wein trank und Giuseppe was anderes. So schön die Fassaden sind: Diese Innenhöfe sind inzwischen leider jedermanns Pflichtprogramm, sonntags sogar der Einheimischen unter fünfzig.
Der Sonntagnachmittag hat immer einen unangenehmen Beigeschmack: spießig-spaßig. Hier ist der Geschmack selbst unangenehm. Wässriger Weißwein im Pressglas und klebrige Massen im Blickfeld. Sie besichtigen einen abgestandenen Geheimtipp. Aber das ist schnell ausgestanden. Jenseits des Hinterausgangs lässt der Radau nach. Ein Viertel wie in Hamburg St. Georg, nur ohne Sex und aufgeputzter. Hier hat erst Liebknecht agitiert und nachher Goebbels. Jüdische Knabenschule dicht bei katholischem Krankenhaus und evangelischem Kirchhof. Freisinn und Bürgerbewusstsein. Jetzt schaffen Cafés und Galerien ein völlig anderes Klima, zumal man an den Kreuzungen, den Blick nach links, den Fernsehturm wie eine Raumstation hoch über der Idylle sieht. So wie den hatte sich Honecker sein neues Berlin eher vorgestellt. Spießers Moderne. Nicht wie hier unten das Kleinstädtische niedriger Häuser mit ständischen Betrieben: ‚Schuster‘, ‚Bäcker‘, ‚Schankwirt‘ – in Fraktur auf die Wand geschrieben, die Türen aus Holz, die Schaufenster knapp bemessen. ‚Homogene Struktur der kleinteiligen Bebauung in der Spandauer Vorstadt des 18. und 19. Jahrhunderts‘, heißt das in Fremdenführer-Deutsch. Das kann ich Giuseppe nicht übersetzen; er sieht es auch so. Er ist aufmerksam und gebildet. Dafür kann ich ihm, ein paar Hundert Meter weiter, an der Oranienburger Straße die Synagogenfront plus Kuppel bieten. Orient ohne Islam. Als Ersatz für die entgangene Messe heute Vormittag. Der Gott bleibt ja derselbe.
Entspannt gehen wir in den Abend und in unser Appartement zurück. Wohnung kann man es nicht nennen, warum nicht? – So ein Gefühl. Wir putzen uns ab für den Abend – von den ‚City Suites‘ nach Kreuzberg. Man will immer passend gekleidet sein. Das ist keine Servilität, sondern Achtung vor den Mitmenschen. Nur Ignoranten und Obdachlose tragen in der Kirche, in der Oper und in der Hotelbar das gleiche Hemd, die gleiche Hose. Das ist keine Frage des Alters, sondern der Stillosigkeit. Giuseppe und ich tragen am Swimmingpool Badehose und am Mount Everest Sauerstoffgerät. Michael trägt immer schwarzes Gummi oder Leder. Gasmaske nur bei dafür vorgesehenen Szene-Veranstaltungen. Da es sich bei dieser Bekleidung um eine Ausgeh-Uniform handelt, hat sie Unter den Linden wie unter den Gleichgesinnten dieselbe Berechtigung. Michael wohnt im feinen Teil von Kreuzberg, was man seinem Gesicht auch ansieht: ein kunstsinniger Kopf. Wenn ich Roland nicht kennengelernt hätte, hätte ich Michael wahrscheinlich auch nicht kennengelernt. Ohne Katalysator kämen viele Verbindungen nicht zustande.
Wir holten ihn mit Giuseppes BMW ab und fuhren gemeinsam in Kreuzbergs anderen Teil. Bei ihrem vorigen Berlin-Besuch hatte Bo und Ingrid das von Michael empfohlene ‚Abendmahl‘ von allen Restaurants am besten gefallen, deshalb war ich dieses Mal auch nicht dort mit ihnen, sie sollten Neues kennenlernen. Für Giuseppe war das ‚Abendmahl‘ neu und es bot ihm nicht den Gott der Juden, sondern seinen: Christus hängt im Kreise seiner Jünger, wenn auch nur als Bild, an der Wand. Auch sonst ist der Raum gespickt mit Devotionalien. Mittags ist das Lokal, wie sein Name sagt, geschlossen. Irreführend ist, dass es weder den Leib Christi noch anderes Fleisch gibt: bloß Fisch (kein Sushi) und Gemüse. Das ersetzt auch für Strenggläubige ein Hochamt. Da der Abend lau war, feierten wir die Messe draußen vor der Tür, Wein und Brot waren bald zur Stelle, statt Gesangsbuch kam die Speisekarte auf den Gartentisch. Papierservietten. Auch Fisch-Vegetariern muss ein Hauch von Sadismus nicht fremd sein. Um die fleischlosen Gerichte nicht allzu brav klingen zu lassen, heißt ein Gemüse-Eintopf etwa ‚Massaker im Schrebergarten‘, und als Nachtisch empfiehlt sich ein Blutorangensorbet ‚Erste Hilfe auf der Unfallstation‘. Dazu wird ein Heftpflaster aus Marzipan gereicht. Die schrägen Namen erinnern von Ferne an meinen gekrakelten Kahn ‚Egonna Amalia Pumpernickel‘, doch im Gegensatz zu meinen zeichnerischen Fähigkeiten brauchten sich die hiesigen Kochkünste nicht zu verstecken. Sie spiegeln eher die Launen des sehr attraktiven Chefs als den Horizont des Trampels, das die Teller aufträgt, wider. Michael lässt vermutlich keine Schiffe malen, obwohl er Kunsterzieher am Gymnasium ist und entsprechend leise spricht, wie immer. Ich spreche wie immer laut und Giuseppe wie immer wenig, wenn Umgangssprache Deutsch ist. Auf der gegenüberliegenden Seite der schmalen, armseligen Straße ging in einem halb geöffneten Fenster des dritten Stocks die Sonne unter. Ihr Feuer blendete aus der Front des schäbigen Hauses mir entgegen. Spiegelung, Täuschung, rote Wärme. Dann kroch das Licht aus meinem Gesicht heraus und erlosch.
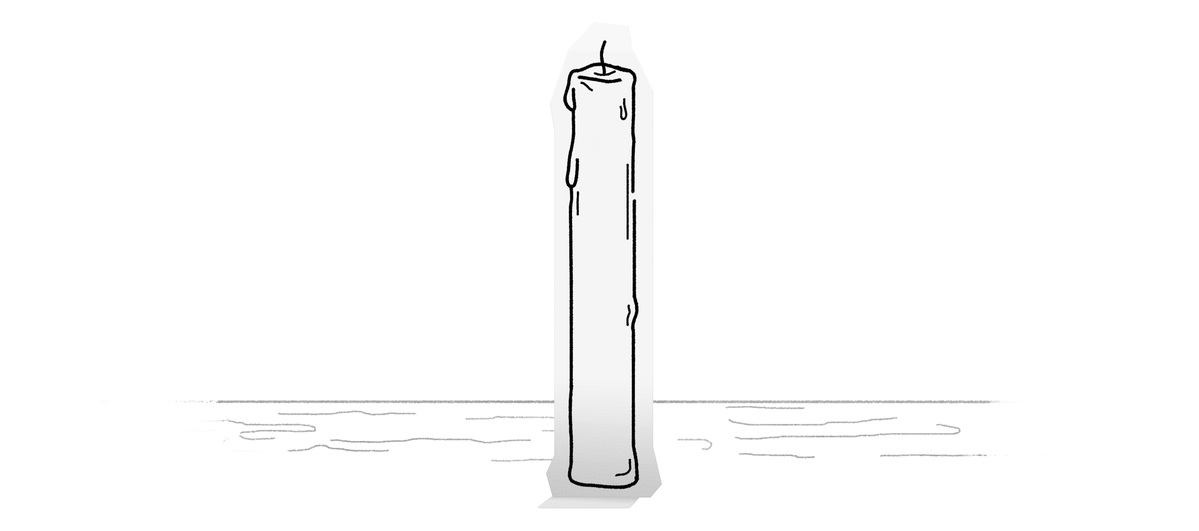
Titelgrafik mit Material von Shutterstock: Billion Photos (Bibel), sangsiripech (Teller), Victor Kulygin (Baum), pixelklex (Mauer), tsuneomp (Sonne) und Material von: A.Savin/Wikimedia Commons, Lizenz Freie Kunst 1.1, CC BY-SA 3.0 (Köpenicker Schloss, Perspektive bearbeitet), Axel Mauruszat/Wikimedia Commons, CC BY 3.0 DE (Tempodrom)









































































Sonntagnachmittage genieße ich zuhuse auf meinem Sofa. Ob da jemand ans Spießertum denkt, ist mit wirklich egal.
Allein sein ist niemals spießig, weder auf dem Sofa noch auf dem Mont Blanc. Und sich darum zu scheren, was wer denkt, wäre sowieso spießig – außer bei Leuten, die auf Einschaltquoten oder Wählerstimmen angewiesen sind.
Das mit der Meinung anderer Leute ist soooo richtig und trotzdem ist es manchmal schwieriger als man es gerne hätte.
Ich denke auch immer kurz darüber nach, was ich schreibe. Manche – auch prominente – Twitterer* tun das nicht.
*geschlechtsneutral
Das kann ja schnell zum Shitstorm führen. In dem Fall macht man sich die Gedanken also besser vorher.
Es sei denn, man gewinnt erst aus dem Shitstorm der Gegner sein Selbstwertgefühl.
In Köpenick war ich noch nie. Aber wenn selbst Sie das als nicht lohnenswert einstufen, wird es auch erstmal dabei bleiben.
Naja. Inzwischen steht ja das Schloss-Café für Events aller Art zur Verfügung.
Romantiker und Rentner geht ja auch gleichzeitig
Sogar am Stock..
Diese Abenddämmerung-Momente mag ich so gerne! Dieses Lucht zwischen Tag und Nacht ist einfach einmalig schön.
… und so vergänglich.
Sie kommt ja zum Glück jeden Abend wieder 😉 Zumindest bleibt das noch solange so, bis die Welt untergeht. Aber das werden wir hoffentlich nicht mehr erleben.
Dabeisein ist alles!
Die Stillosigkeit gilt ja eher für die Ignoranten als für die Obdachlosen, aber grundsätzlich stimme ich schon zu. Es gehört sich einfach, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden.
Die Vorstellung davon, was angemessen ist, geht allerdings oft auch mal auseinander. Da kann man dann auch nicht viel gegen sagen.
Dass eine Jogginghose in der Oper als underdressed angesehen wird, darüber ist man sich aber schon einig, oder?
Eine Gesellschaft ohne Dress-Code gab es in der Menschheitsgeschichte nicht. Sich zu einer Hochzeit nicht feierlich zu kleiden, ist bereits eine Aussage.
Und wenn es die eigene ist?
Wem es egal ist, wie man zur eigenen Hochzeit aussieht, der lässt sich im Zweifel ein halbes Jahr später wieder scheiden oder fokussiert sich einfach auf steuerliche Vorteile.
Von ‚Ganz in Weiß‘ bis ‚Die Braut trug schwarz‘ ist ja die Mode-Palette schon farblich und kulturell abgearbeitet.
Hahaha, Schließung wegen Baufälligkeit ist ja wirklich oft ein Grund, der Neugierige anlockt. Was verboten ist wird eben direkt interessanter. Auch wenn man vorher gar nicht so richtig Interesse gehabt hätte.
Es gibt im Internet ja sogar Top 10 Listen mit den interessantesten verlassenen Gebäuden. Naja, wem es gefällt…
Gut für Location-Scouts.
Ach Gott, wenn ich „Massaker im Schrebergarten“ höre oder lese, dann bleibe ich doch lieber beim Fleischgericht.
Da wird den Fleischessern (oder schon auch den Essern allgemein) ja quasi vorgeworfen, dass sie ihr Fleisch hauptsächlich aus Lust am Töten Essen. Nicht weil ihnen der Geschmack zusagt. Oder warum kommt man sonst mit solch einer Analogie?
Da past ja ein Gedanke von weiter oben im Text: Alles liegt so eng beieinander. Und doch sind die Gräben eben groß. Die einen verstehen die anderen nicht. Oder wollen sie nicht verstehen.
Die Mauer in den Köpfen eben. Das lässt sich auf so viele Themen übertragen und bleibt immer aktuell.
Ein Witz ist ein Witz ist ein Witz.
Berlin hält sich für den Nabel der Welt, die Nicht-Berliner lachen meistens drüber, und die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo dazwischen.
Also am Nabel.
Der Gendarmenmarkt ist so ziemlich das Zentrum Berlins. Aber außer, dass man mal drüber spaziert, ist doch da nicht viel los. Als lebendiges Zentrum fühlt er sich nicht so richtig an.
Times Square und Piccadilly Circus sind natürlich lebendiger. Möchte man also lieber dort seinen Espresso Macchiato schlürfen?
Den trinke ich am liebsten in einem kleinen netten Viertel zwischen den ‚Locals‘. Naja, zumindest so gut wie das eben geht.
Ja das mache ich auch gerne. Aber da kommt man selten an den Sehenswürdigkeiten einer Stadt vorbei. Beides zu kombinieren wird da eher schwierig.
Von der Museumsinsel zum Café Neundrei sind es zu Fuß nur zehn Minuten.