

Mittwoch, 19. Juli
Es hätte sich gehört, heute dem Westen seine Grenzen zu zeigen. Das Egoneum, benannt nach der Pumpernickel, war die vornehmste Hilfsschule Dahlems, das Gymnasium für Zurückgebliebene aus gutem Hause an der Grenze zu Schwachsinn und Steglitz. Gregor Graubrodt besuchte diese Schule fast so pflichtbewusst wie seine Erbtante. Herr Graubrodt saß im Stadtrat. Er betrieb im Kulturausschuss ein Projekt, das zur Demokratisierung beitragen sollte und die Abschaffung der Bildung zum Ziel hatte. Auch er war zurückgeblieben. Im Jahre 1968. Frau Graubrodt saß im Garten. Sie war sensibel. Deshalb spürte sie, wie eine fiebrige Düngeritis von ihrem Körper Besitz ergriff: Gleich würde sie aufspringen und Stickstoff-Granulat in die Rosenbeete streuen.
Ich ließ den Block mit Rechenkästchen vom Bett gleiten und legte den Filzstift auf den Nachttisch. Es ging mir schlecht. Ich schluckte Tegretal. Professor Büchsel, den ich verabredungsgemäß anrief, war beeindruckt. „Das ist sehr gut“, sagte er, „Ihr Hausarzt ist ein sehr guter Therapeut.“
Das Wetter war schlecht und mir nicht nach Westen.
Ich hatte mir auf Kristina Jentzschs Bitte ‚Die Zeit‘ gekauft, weil sie mich zu Änderungsvorschlägen für das Layout ermuntern wollte. Sie macht gerade eine Foto-Reportage über Montenegro für das ‚Zeit-Magazin‘ und glaubt, man könne die Macher durch Dreinreden beeindrucken. ‚Die Zeit‘ ist ohnehin schwer zu lesen. Im Bett ist es fast unmöglich. Ein Camus-Zitat fiel mir auf: ‚Das Geschlechtsleben wurde dem Menschen geschenkt, um ihn von seinem eigentlichen Weg abzulenken.‘ Die – vertane? – Zeit, die ich mit Sexuellem verbracht hatte, war sie nicht auch Triebstoff für meinen Motor gewesen? Aneinandergereiht würden es Monate, ach, Jahre sein. Und der Lachs, den ich rechtzeitig genossen habe, bevor er wegen seines Sexualverhaltens am Laichplatz gestorben wäre, er würde einen Kühlraum füllen, der Wein, den ich getrunken habe, eine Schlosskellerei. Na und?
Der ‚eigentliche Weg‘, die Fondamenta degli incurabili – ich verbiss mich wieder in den Stadtplan. Ich konnte ganz in ihn versinken wie in die Bibel – das Ziel ist weniger Erkenntnis als Meditation. In Malchow, im Osten, gibt es doch tatsächlich eine ‚Anlage Märchenland‘. Da heißen die Straßen: Rübezahl-, Frau-Holle- und Zwerg-Nase-Weg. Die Hauptstraße, die all die putzigen Straßen durchkreuzt, heißt Gebrüder-Grimm-Weg.
Ich stelle mir einen Lastwagenfahrer vor, der einen Unfall verursacht. Der Anhänger kommt ins Schleudern, der vordere Wagen knallt durch die Leitplanke. Ein entgegenkommender Porsche wird zusammengequetscht: von 180 auf 0 km/h. Blut, überall Blut. Krankenwagen, Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr sprüht Schaum gegen die Flammen. Ein mürrischer Polizist schreibt das Protokoll in seinem Wagen auf den Knien. Der Kugelschreiber schmiert. „Wohnhaft?“, fragt er. Der bullige Trucker reibt sich die Pranken an den speckigen Jeans. Er schlurft mit dem Kinn über den aufgerauten Kragen seiner Lederjacke. Schweiß rinnt seinen Kragen herab, und tonlos sagt er: „Schneeweißchen- und Rosenrot-Weg einundzwanzig b.“
Der Stadtplan als Lebensplan. Man muss sich in eine Sache so lange und so tief hineinversetzen, bis man weise oder wahnsinnig wird. Das kann Berlin sein oder ein Bakterium oder der Buddhismus, entscheidend ist die vollkommene und ausschließliche Beschäftigung damit. Sich in seiner Stadt oder seiner Biografie auszukennen wie in seiner Westentasche – hilft das? Bestätigt es? Gibt es Sicherheit? Oder Daseinsberechtigung? So wie es Daseinsberechtigung gibt, wenn man zwar kein Schiff zeichnen kann, aber mit dessen Namen die anderen zum Lachen bringt? Selbst wenn sich Spott in das Lachen mischt, vielleicht mischt sich auch Bewunderung hinein. Beim Bockspringen habe ich immer zwei Handhupfer gemacht, ohne dabei den Bock mit dem ‚Gesäß‘ zu berühren: wie die Vorschrift es verlangte. Es sah wohl komisch aus, aber ich hab’s geschafft. Ein Clown sein, ein Narr sein. Klassenclown, Waffennarr. Gefährdet oder gefährlich. Sich auskennen und durchdrehen. Hürdenläufer, Amokläufer, als Letzter durchs Ziel: bravo! Dabei sein ist alles! Man schätzt, in einigen Jahren könne es keine sportlichen Rekorde mehr geben. Auch wenn die Athleten zwanzig Stunden am Tag trainierten, windschnittige Vollkörperanzüge trügen und Bewegungsoptimierungen aus dem Computer vertrauten, selbst wenn ein Hundertstel Sekundensplitter schon genug wäre – nein. Gibt’s nicht! Der Mensch ist als Sportmaschine ausgereizt. Ob dann das Einstellen von Rekorden noch Millionen von Menschen faszinieren wird? Oder ob die olympische Idee mitsamt ihren Spielen als Geschäftszweig an Attraktion verlieren wird wie eine Stadt, die perfekt funktioniert, weil sie all ihre Probleme gelöst und verdrängt hat und nur noch aus Hans-im-Glück-Wegen besteht? Die Einwohner haben ihr Ziel im Kreisverkehr erreicht. Sie tragen nicht mehr atmungsaktiven Hochleistungsdress, sondern wieder Anzug, in dessen Westentasche sie sich auskennen. Die Grenze zwischen Überglücklichem und Todunglücklichem haben sie so oft überschritten, dass sie sie niedergerissen haben: Sie können das eine vom anderen nicht mehr unterscheiden. Sie sitzen fest, im Zentrum ohne Mitte. Ampel überflüssig.
Das Telefon klingelte. Es war Guntram. Irene könne es nicht mehr durchstehen. Ob ich nicht zurückkommen könnte. Die Frage traf mich nicht unerwartet. Sie hätte schon viel früher kommen können. Seine fortschreitende Hilflosigkeit, ihre wachsende Überforderung. Es ist ja mehr als Krankenpflege, die gebraucht wird an der Schwelle von Endlichkeit und Unendlichkeit.
Berlin und ich. Freunden die Stadt zeigen, neue Eindrücke gewinnen und auch Abstand; Kontakte pflegen, Anregungen sammeln für Eigenes – alles das. Spaß haben, Energie tanken, gewiss. Aber es war auch Flucht gewesen. Vor den Grenzen des Möglichen, des Aushaltbaren, auch vor den eigenen Grenzen, jenseits derer keine Rekorde locken. Die Abwesenheit von dort durchstehen, die Anwesenheit hier durchstehen, und sich an alles das erinnern, was man auch sein könnte oder einmal war. Zu Ende Gegangenes. Endliches und Unendliches. Grenzenlosigkeit nachspüren, da, wo einmal die einschneidendste Grenze der Welt war.
Ich versprach, zum Wochenende zu kommen: übers Wochenende.
Es war kein großes Opfer. Ich hatte nichts vor an den Tagen. Vor zwanzig Jahren und noch vor zehn hätte ich auf alle anderen Zeiten eher verzichtet als auf die beiden Nächte von Freitag auf Sonnabend und von Sonnabend auf Sonntag – und dann der Sonntagabend. Wenn der Druck weg und die Enttäuschung groß ist, das war immer die bessere Zeit gewesen, um die Schürze gegen den Himmel zu halten: Da purzelten die Sterntaler, da fielen einem alle Perlen aus den Kronen direkt in den Schoß.
Ich stand auf. Ich hörte das Klingeln durch das müde Surren meines Rasierapparates hindurch und ging nur deshalb in Vertretung meines Anrufbeantworters ans Telefon, weil ich die Entwarnung erwartete, ich solle wegbleiben, es ginge schon alles. „Nein, nein, ich komme morgen.“
„Es ist aber nicht nötig.“
„Morgen Abend komme ich.“
„Wirklich?“
Bis zur Rechtfertigung hin würde ich mein Erscheinen durchsetzen – musste ich aber nicht.
Dorothee kann mit Recht erwarten, dass man alle Termine im Kopf hat, die mit ihr sowieso, also braucht sie nur gutentaglos zu sagen: „Wir treffen uns da. Meine ‚Nichte‘ will mir vorher noch ihre Wohnung zeigen. Kopenhagener Straße, das ist Schönhauser Allee. Meine ‚Nichte‘ bestellt den Tisch.“
„Gut“, fasste ich unkorrekt zusammen.
„Sie schließen um sieben, also, wenn wir um halb sechs da sind, reicht das.“
„Gut, halb sechs. Meine Eltern haben angerufen. Ich fahr’ übers Wochenende nach Hamburg.“
„Ach!“ Sehr viel Ausdruck in der Stimme. –
„Ich muss los. Also, bis später! Ich freu’ mich.“
Meine Vorkenntnisse Dorothees und der Stadt reichten aus, um unser Gespräch folgendermaßen zu interpretieren: Die dreißig Jahre alte, bei der Kulturbehörde angestellte Architektin Marion Blachian beabsichtigt, bevor sie morgen in ihre Geburtsstadt Mailand fliegen wird, um ihre Eltern zu besuchen, der Patentante ihrer besten Freundin, Dorothee Koehler, heute noch ihre neue Wohnung zu zeigen und anschließend mit ihr auf deren Anregung hin gegen Ende der Öffnungszeit in das gerade fertiggestellte Vitra Design Museum zu gehen, das dem ehemaligen Umspannwerk Prenzlauer Berg eine neue Funktion gibt, nachdem dieses Umspannwerk zur Stromerzeugung nicht mehr gebraucht wird. Der Bau liegt in der Kopenhagener Straße, die von der U-Bahn-Station Schönhauser Allee aus zu Fuß zu erreichen ist. Die Patentante der besten Freundin will einen Freund aus Hamburg, der kulturell interessiert sei, mit dazubitten und beide, Marion selbst und den schöngeistigen Hamburger, anschließend in das Thai-Restaurant einladen, von dem sie, die Patentante der besten Freundin, so viel Gutes gehört hat. Marion, die auf der morgen anzutretenden Reise auch das Zweithaus ihrer Eltern am Gardasee zu restaurieren plant, möge, weil sie in der Nähe wohnt und die Telefonnummer des Lokals unbekannt ist, einen Tisch bestellen.
Luft schnappen. Ich lief auf die Straße und gleich einer Bettlerin unter die Finger. Widerwillig gab ich ihr die fünf Mark, die ich mir in die Tasche gesteckt hatte. Eigentlich gönnte ich ihr das Geld nicht, aber dann gab sie mir aufmerksamerweise ein Bild von Christus. Man konnte, wenn man wollte, seine Rippen zählen, oder sonst was machen. Er würde sich nicht wehren, weil er festgenagelt war. Das versöhnte mich etwas.

Titelbild (Montage) mit Material von Pauli-Pirat/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Infotafel), Maximilian Dörrbecker/Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5 (Berlin-Karte, bearb.)

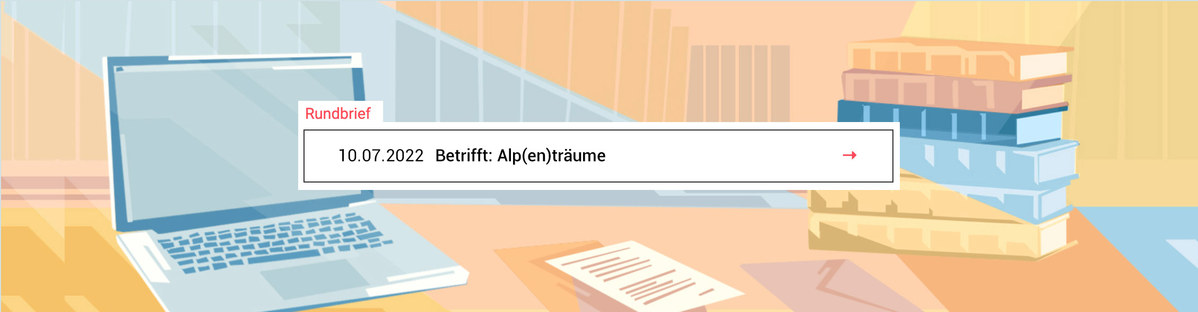







































































Die olympische Idee hat mittlerweile ja wirklich an Attraktivität verloren. Für die Sportler gilt das natürlich nicht, da bleibt das immer noch ein großes Karriereziel, aber die Zuschauer sind diese riesigen Geldspektakel doch größtenteils leid.
Nur ist der Grund ein anderer. Nicht, dass man das menschliche Können bis zum Gehtnichtmehr ausgereizt hätte, aber kaum ein Land will noch diese horrenden Summen in ein solches Event investieren.
Anderen ist das Prestige wichtig. Wenn alle wie ich wären, würde kein IOK und kein FIFA auch nur einen Cent verdienen.
Na deshalb finden die meisten dieser Veranstaltungen nun auch in Dubai, Katar, Beijing etc. statt. Der Westen ist da zurückhaltender.
Der Westen dachte eben, er hätte die Antwort auf die Frage gefunden, wie ein politisches System zu funktionieren habe. Jetzt staunt er.
Die Schwelle von Endlichkeit und Unendlichkeit klingt schön
Als Begriff ja, in der Realität eher nicht.
Wer sie übertreten hat, spricht nicht drüber.
Das ist ja ein wirklich einschneidender Moment, wo man sich bewusst wird, dass das Leben endlich ist. Jedenfalls war das bei mir so. Als meine Eltern langsam aber doch sehr spürbar älter wurden…
Als Kind hatte ich immer Angst vor dem Tod meiner Eltern, und dann wurden sie beide über 90.
Als Kind habe ich da nie dran gedacht. Obwohl meine Schwester relativ jung gestorben ist. Trotzdem schien die Chance, dass so etwas noch einmal passieren könnte, immer unglaublich weit entfernt.
„Die Zeit“ gefällt mir eigentlich nach vie vor ganz gut. Nur ist sie zugegebener Maßen sehr groß.
Breiter als das Bett, in dem man sie lesen möchte.
Und länger als die Arme, die man zum Lesen zur Verfügung hat…
Eine Ablenkung muss ja nicht gleich auch vertane Zeit sein. Was wäre der Mensch ohne das Sexuelle?
Geschlechtslos. Würde den Gender-Streit an der Humboldt-Universität abkürzen.
Hmmm, ob man sich als Mann oder Frau identifiziert hat ja eben nicht mal unbedingt etwas mit Sex zu tun. Das ist doch gerade der Denkfehler.
Ich könnte mich aber schlecht mit dem einen oder mit dem anderen oder mit sonst noch was ‚identifizieren‘, wenn es Vagina und Penis nicht gäbe. Wäre natürlich schade …