

Wir verließen den Potsdamer Platz. Eine Steigerung war nur noch theoretisch möglich. Also bestiegen wir den nagellackroten Informationscontainer ‚Info-Box‘ auf dem noch nicht vorhandenen Leipziger Platz, um uns über die Zukunft zu unterrichten. Außerdem konnte man von dort oben aus nach allen vier Himmelsrichtungen blicken, ohne irgendetwas Bemerkenswertes zu sehen. Das war schon faszinierend. Ähnliches haben Rom oder Paris nicht zu bieten, da hätte man immer gleich in Bedeutendes geguckt.
Das Bemerkenswerte am Leipziger Platz, auf dem wir uns befanden, ist, dass er in achteckiger Form und mit Namen auf jeder Übersichtskarte und jedem Stadtplan erwähnt ist, ungeachtet der Tatsache, dass er nicht existiert und angedachte Pläne wieder verworfen wurden; sie lassen sich wegen der U-Bahn-Linie 2, die unter dem Gelände hindurchführt und zumindest unterirdisch den Potsdamer Platz mit der wahren Innenstadt verknüpft, nicht realisieren: Offenbar verträgt das sumpfige, durch Untertunnelung zusätzlich strapazierte Erdreich keine Wolkenkratzer. Auf waschechter Berliner Muttererde konnte man noch niemals hoch hinaus, dazu musste man in die Weite, wovon die Eroberungskriege im Osten seit Jahrhunderten zeugen. Ohne den instand gesetzten Leipziger Platz bleibt der Potsdamer Platz Insel, allenfalls Halbinsel, denn er hat nach Westen hin eine gewisse, beampelte Anbindung an das Kulturforum, jenes nachträglich zur Konstruktion (v)erklärte Beieinander von Philharmonie, Staatsbibliothek, Gemäldegalerie und Gewerbemuseum, das seinerseits auch im luftleeren Raum rumhängt.
Oder man sagt wie manche Menschen: Das Zentrum bin ich! Das ist eine bequeme, wenn auch nicht immer glaubwürdige Masche, um zu bestehen. Dann liegt das Zentrum losgelöst vom Rest der Welt, die Kirche außerhalb des Dorfes, weder dem Kurfürstendamm noch den Linden zuzuschlagen. Schlimmer noch: Dieser Unort, Ziel meiner lang gehegten Vorfreude, ist noch nicht mal dort aus dem Boden gestampft, wo er, historisch gesehen, hingehört. In Berlin ist nichts echt: weder Lutter & Wegner noch das vollständig nachgebaute Charlottenburger Schloss, und der hochgejubelte Potsdamer Platz schon gar nicht. Der bestand immer nur aus dem winzigen Treffpunkt von ein paar Straßen (Potsdamer, Königgrätzer, Bellevue), die man entweder weiter entlangkutschieren konnte oder man bog ein in den Leipziger Platz. Wer es so genau wie ich wissen will: Die Königgrätzer erinnert inzwischen nicht mehr an die Schlacht, in der Preußen Österreich schlug, sondern heißt bis zum fiktiven Potsdamer Platz hin Stresemannstraße und jenseits dieses gedachten Punktes Ebertstraße – oder umgekehrt, je nachdem, ob man vom Wannsee kommt oder vom Brandenburger Tor. Jedenfalls steht die Strecke ganz im Zeichen der Weimarer Republik, an die sonst hier rein gar nichts gemahnt, außer dass bisweilen von ihr als Anknüpfungspunkt gefaselt wird, damit niemand denkt, irgendjemand wolle an irgendein Reich anknüpfen.
Der Potsdamer Platz jedenfalls knüpft an so gut wie gar nichts an. Er bestand ja seit jeher aus nichts weiter als aus einer Gabelung mehrerer Straßenbahnlinien. Das, was den Besuchern heute als Potsdamer Platz gilt, ist das große leergebombte Gelände dieses einst mehr oder eher weniger markanten Knotenpunktes, an dem bis zu Hitlers letztem Geburtstag die Elektrische mittels Weiche ihrer Zielstation entgegengelenkt wurde.
Gewiss, eine derartige Fügung – links oder rechts – kann schicksalsentscheidend für die Verkehrsteilnehmer sein: Man kommt unter die Räder oder man fährt ins Glück. Aber das, was man gemeinhin unter einem Platz versteht, auf dem Wagenrennen veranstaltet oder Veilchen verkauft werden, das ist so ein Dreieck nicht gerade. Der richtige Platz, das war nie der Potsdamer, sondern immer schon der achteckige Leipziger, mit Häusern drumherum und erst Rasen, dann einer Verkehrsinsel in der Mitte, mit dem richtungweisenden Prachtbau an der Nordost-Ecke, der bis zu dessen Enteignung Hermann Tietz gehörte, Berlins größtem Kaufhaus: Wertheim, gebaut ab 1896, weggeDDRt 1958. O Margot! Wäre dieses die Leipziger Straße hinunter nicht ‚führende‘ Gelände mehr als eine lange leere Stelle mit Trampelpfad davor, dann könnte man bis zur Wilhelmstraße promenieren und käme so wirklich ohne Beeinträchtigung für Schuhe, Blick und Lebensgefühl zur jetzt behaupteten Stadtmitte. In fünf bis zehn Jahren vielleicht, wenn entweder die Linie 2 abgeschafft worden ist oder die Mieten so hoch geworden sind, dass sich auch niedrigere Gebäude rechnen. Ach, wird das schön! Man flaniert vom wiedererstandenen Oktogon des Leipziger Platzes aus (ursprünglich gestaltet 1734) den der Großstadt zurückgewonnenen Streifen entlang: unter Gründerzeitimitat als Straßenbeleuchtung; Nordsee, Schlemmer, Schlecker und Eduscho säumen den Weg bis zur Friedrichstraße, wo sie auf Joop und Jil treffen und sich die Ströme von Pauschaltouristen mit den Strömen von Geschäftsreisenden erst rempeln und dann mischen im Fluss der Geschichte. Das Interessante an Berlin ist, was weg ist und was sein wird. Immer schon. In kaum einer anderen Stadt ist das Heute so sehr der im Kopf und im Grundriss verwurzelte Übergang der Vergangenheit in die besser erhoffte Zukunft. Für die Praxis bedeutet das zurzeit: Leipziger Straße meiden und sich über die Reste der Voßstraße durchschlagen zur Wilhelmstraße, und das taten wir auch. Dazu noch ein letztes Wort, bevor ich vorübergehend meine Straßomanie an der Ampel des Mitgefühls auf Rot schalte.
Eine meiner ersten Erinnerungen. Ich sehe sie – wie nichts sonst – als Schwarz-Weiß-Film: der kastige Wagen meines Vaters, Mercedes 170, er selbst am Steuer, meine Mutter neben ihm. Ich hinten zwischen meinen Großeltern. Die Sicht für mich ist schlecht. Wir werden angehalten, fahren weiter, durch das Brandenburger Tor. Im Osten! Wenige Menschen auf den Straßen. Ruinen, leere Flächen. Der Weg scheint ziellos. Trümmer, Krater. Hin und her. Verfahren. Nichts ist wiederzuerkennen für die anderen. Für mich ist alles neu: die abgebrannte Hölle.
Meine Großmutter liest die Buchstaben auf einem Schild, der Pfahl steht schief, Weiser ohne Weg. „Voßstraße!“, ruft sie aus, „mein Gott, die Gräfin Voß!“ So endet der Film. Daraus schließe ich, dass wir wohlbehalten in den Grunewald zurückgekommen sind.
Eine hauslosere Straße als die Voßstraße ist nach wie vor schwer vorstellbar; man geht nicht eine umgrünte Allee entlang, sondern einen Weg durch Trümmer, die schon vor Jahrzehnten weggeräumt wurden: surreal. Am einen Ende die weggerissene Mauer, am anderen Ende die nicht mehr nach Grotewohl, sondern wieder nach Wilhelm benannte Straße. Überquert man die und tut nichts Komplizierteres, als einfach geradeaus weiterzugehen, dann befindet man sich auf der Mohrenstraße, ist also nach wenigen Schritten am Eingang zu unserem ‚Madison City Suite‘. Man lernt daraus im Berliner Bildungsprogramm, dass auch Nichtabschweifen Wandel bringt. Die Nahtstelle von Voß-/Mohren-/Wilhelm-Straße hieß in der DDR Thälmannplatz (hat man da nichts Anständigeres für den Märtyrer des Sozialismus gefunden, als eine Kreuzung ‚Platz‘ zu nennen?), nun heißt sie wieder gar nicht mehr, und die U-Bahn-Station heißt auch nicht mehr Thälmannplatz, sondern wieder Mohrenstraße und ist nicht länger Endstation der DDR-U-Bahn, sondern führt, wie einst bis zum Mauerbau, wieder zum Potsdamer Platz, um die Bebauung des Wertheim-Geländes zu erschweren. Straßennamen-Archäologie in der jüngsten Hauptstadt Europas (Preußen mitgerechnet): Mohrenstraße? – ‚Mohrenstraße‘ hat doch hoffentlich nichts mit Kolonialismus zu tun! Vielleicht war da der erste Sarotti-Laden. Wilhelm kennen wir ja, aber das mit der Gräfin Voß bleibt wieder unklar. Ich meine zu wissen, sie sei eine Hofdame der Königin Luise gewesen, jedoch: In meinem ‚Meyer’s‘ aus dem vorvorigen Jahrhundert finde ich als einzige Namensträgerin ‚Julie von, morganatische Gemahlin (seit 1787) König Friedrich Wilhelm II.‘ Im ‚Meyer’s‘ von 1999 heißt es dazu unter ‚M‘: ‚morganatisch: Ehe zur linken Hand‘ und unter ‚L‘: ‚Linker Hand: beim Hochadel standesungleiche Ehe (…) Die Lage der nebenbürgerlichen Frau und der (…) Kinder wurde hierbei gegenüber der einfachen Missheirat durch Einräumung eines Titels und Ranges verbessert.‘ Ungefähr wusste ich das ja schon. Trotzdem ist es lustig, solche fernen Worte in einem Lexikon aus dem vorigen Jahr(-hundert) zu lesen. War die Voß demnach etwa bloß eine geborene Pumpernickel? Ganz ohne ein ‚von‘ bei der Geburt? Stand ihr überhaupt eine Straße zu, die von schwarzen Menschenfressern her kommt, Wilhelm überquert, in Königgrätzer landet (wie hieß diese Straße wohl vor der Schlacht?), von 1961 bis 1989 gegen die Mauer prallte und jetzt baum- und baulos in die Ebertstraße mündet, die dem interessierten Besichtiger bisher auch nicht mehr als den Namen zu bieten hat? Schall hin, Rauch her: Diese Linie war halt achtundzwanzig Jahre lang nichts weiter als Mauerverlauf, da kann man zehn Jahre später keine Fifth Avenue verlangen. Aber nicht mal Buden, wie überall da, wo sonst nichts ist? Kein bisschen Kentucky-Fried-Chicken amerikanischerseits und kein klein wenig Broiler-Imbiss da, wo sich andererseits der sowjetische Einflussbereich verflüchtigt hat? Wo eigentlich genau? Vom Eisernen Vorhang ist nicht mal eine Tüllgardine übrig.
Für Ebert besteht wenigstens noch Hoffnung. Im neuen ‚Meyer’s‘ kommt es gleich dreimal vor: 1) Albert, Maler und Grafiker, 2) Carl, amerikanischer Theaterintendant, 3) Friedrich, Politiker. Nun kann sich der Wissbegierige so seine Gedanken machen, welchen von den dreien die bordsteinlose Strecke wohl dem Vergessen entreißen will.
Nachtrag 2022, dank Wikipedia: Die Voßstraße heißt so zu Ehren des 1871 verstorbenen Generals Graf von Voß, dem Letzten seines Geschlechts. Die Ebertstraße hieß dauernd anders: 1831 zum Beispiel Schulgartenstraße und ab 1945 nicht mehr Hermann-Göring-Straße.
Um Hermann Tietz steht es weitaus schlechter. Über ihn steht nirgendwo irgendwas. Hab’ ich mir den etwa ausgedacht? Kommt von dem nicht Hertie? Oder verwechsel’ ich das, und stattdessen ist Karstadt die Abkürzung von ‚Karl-Heinz Stadtbauer‘? – Wie schäbig! In Berlin muss ich mich dauernd beherrschen, um mich nicht vor meinen ausländischen Gästen zu schämen. Wenn man Touristen sechs Tage lang durch das aus dem Ei gepellte Hamburg geführt hat, bei leidlichem Wetter, zu Wasser und zu Land, alles ist sauber, gepflegt und durchdacht – dann wirkt das jahrhundertelang ruinierte Berlin im mürrischen Sonnengrau doch sicher wie ein Abstieg, nicht wie eine Steigerung. Märkisches Auffanglager statt hanseatischer Hotels. Kaltschnäuzigkeit gegen Hochnäsigkeit – wer gewinnt da? Teilt sich das Aufregende dieses behaupteten Aufbruchs der Ex- und Hoppla-Hauptstadt Fremden mit?
Und bin ich, der ich die glatte Haut der Unbekümmertheit auch lieber sehe als die Narben und Schwielen der Geschichte, begeistert genug, um zu begeistern?
Verfehltes Neues bremst ja den Elan noch peinlicher als Verrottetes oder Unterlassenes. Und das kann man jetzt weder Margot noch Adolf in die Schuhe schieben, sondern muss es kritisch werten. Man muss sich erlaufen, was da oder weg ist und Stellung beziehen: an jeder Ecke. Das hat Hamburg nicht zu bieten! Hamburg nimmt man hin und freut sich. Berlin wühlt auf: seine Erde und seine Besucher. Und meine Begleiter sind nicht als Touristen hier, sondern als Freunde. Sie werden Berlin mit den Augen der Liebe sehen, wenn ich es ihnen mit den Augen der Liebe zeige.
Ich fühle mich gestärkt. Schon vor dem Nachmittagsschlaf, und danach erst recht, sodass es mir ein Vergnügen sein wird, meine Gäste hurtig weiterzugeleiten. Ihnen sind meine Skrupel wahrscheinlich sowieso fremd.
Wer in Mason Vicentino im Veneto wohnt oder in Bromma bei Stockholm, der verzagt nicht unter den Linden von Berlin. Dem ist diese kaputte, kregle Metropole mehr Urlaub vom Zuhause als Hamburgs stadtstaatliche heile Welt.

Titelgrafik mit Material von: Pixfiction/Shutterstock (Basecap), Kevin George/Shutterstock (Straßenschild Potsdamer Platz), Digital signal/Shutterstock (Straßenschild Leipziger Platz) und Wikimedia Commons: Kandschwar, CC BY-SA 2.0 DE, (Infobox), Azanulbizar74, CC BY-SA 4.0 (Pickelhaube), Norbert Aepli, Switzerland, CC BY 2.5 (Verkehrsturm)

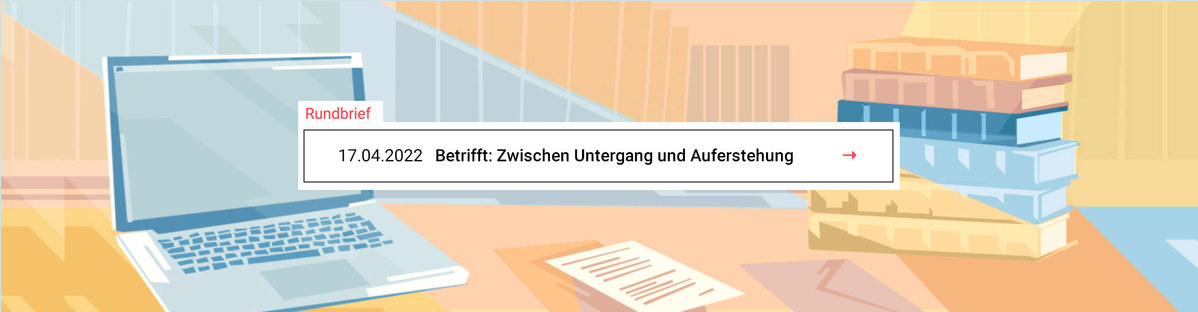







































































Ich mag diese kaputte Metropole ja einfach wahnsinnig gern.
Berlin? Keine Frage. Ich hör auch immer wieder, wie sich Leute über das Chaos in der Stadt lustig machen. Soll mir alles egal sein. Wem Berlin nicht gefällt, der soll einfach wo anders hingehen.
Wie es beruflich und privat manchmal so geht: Die einen wollen hin und können nicht, die anderen wollen weg und können auch nicht. Schön, wenn mehr als die Hälfte der (Un)Beteiligten zufrieden ist.
es gibt ja auch immer wieder genügend leute, denen es einfach spaß macht über die zustände in der stadt zu meckern. letztendlich bleiben sie aber doch dort.
‚Kaputt‘ ist Berlin eigentlich kaum noch. Als ich im Grunewald aufwuchs, gab es überall Ruinen. Jetzt kann man von spießig bis herrschaftlich alles finden, was man sucht. Spätestens in den Kulissen von Babelsberg.
Statt kaputt könnte man vielleicht dysfunktional verwenden. Meister im Organisieren sind die Berliner nämlich nicht gerade. Aber jeder Stadt ihre Stärken und Schwächen.
Ach, da wird auch einfach unnötig viel genörgelt.
Improvisieren geht über (in) Organisieren!
Über den Ursprung der Mohrenstraße lese ich immer wieder unterschiedliche Geschichten. Ist man sich da eigentlich immer noch nicht einig?
https://www.tagesspiegel.de/berlin/streit-um-strassennamen-warum-heisst-die-mohrenstrasse-mohrenstrasse/7332938.html
Umbenennungen sind genauso modern wie das Gendern. Vielleicht setzt sich der Wandel ja auch in den Hirnen fest.
Wollen wir es hoffen. Ich hänge beileibe nicht an der Mohrenstraße, aber skeptisch, ob die Energie da in die richtige Richtung aufgebracht wird, bin ich trotzdem.
Ich bin mit dem Sarotti-Mohr groß geworden. Rassitisch sei ich dadurch angeblich nicht geworden, behaupten schwarze Freude. Woke Weiße wissen: Die irren sich.
Schlecker und Joop sind ja gar nicht so weit auseinander 😂
Aber auch kein Paar.
Was macht Wolfang Joop denn heute überhaupt? Hat er sich nicht schon lange zurückgezogen?
Zuletzt ist er durch seine etwas unglücklichen Kommentare über die Modewelt aufgefallen. Aber er ist mittlerweile auch schon 77. Selbst aktiv ist er wohl nicht mehr.
Jedenfalls nicht in Bekleidung.
Der Potsdamer Platz wird immer nur zur Berlinale kurz zu einem Hotspot der Stadt. Ansonsten taugt er nur als Anlaufpunkt wenn man Richtung Philharmonie oder Nationalgalerie will.
Ich mochte das große Kino dort immer. Aber leider ist das ja mittlerweile von den hohen Mieten verdrängt worden.
Die kleinen Programmkinos sind mir eh lieber…
Ich kam zur Philharmonie immer von der Tiergartenstraße her. Potsdamer Platz war ein ödes Stück Mauer. Jetzt ist er nicht ideal, aber akzektabel im Vorbeigleiten.
Mittlerweile gibt es den Leipziger Platz auch. Das hilft dem Potsdamer aber auch nicht weiter.
Es hilft einem weiter, wenn man vom Potsdamer Platz weg will. Aber auch dort gibt es keinen Grund anzuhalten.
Die riesige Mall of Berlin ist dort. Die ist allerdings auch oft leer.
Eine Fehlinvstition. Auch sonst gibt es am Leipziger Platz nichts, wo man draußen sitzen und in die Gegend gucken will. Das ‚Peppone‘ ist eingegangen. Schade!
Verfehltes Neues – der BER kommt einem gleich in den Sinn.
So schlimm wie alle tun, kann er doch gar nicht sein.
Er ist halt einfach veraltet. Und das obwohl er immer noch recht frisch eröffnet ist. Das merkt man leider an vielen Stellen.
Fliegen ist sowieso umweltschädlich.
Das haben die Flughafenplaner wahrscheinlich schon mit eingerechnet. Hahaha.
Oh ja .. Berlin wühlt auf, andere Städte nimmt man hin. Das ist gar keine schlechte Beschreibung.
Ob man Berlin, London, Paris oder Gelsenkirchen hinnimmt oder wegzieht, liegt oft am jeweiligen Stadtteil und dem eigenen Charakter.
Es hat ja auch gar nicht jeder die Chance in seiner Lieblingsstadt zu leben. Bei vielen bleibt es bei ein paar vereinzelten Besuchen.
Paris und Rom sind so unglaublich anders, da nützt einem auch Unter den Linden nichts. Das gilt natürlich nur, wenn man sich nach dem Schönen und Faszinierenden dieser Städte sehnt. Wer das Raue und Lebendige an Berlin zu schätzen weiss, der denkt über so etwas nicht allzu lange nach.
Wir meinen ja in London auch nicht Ilford oder in Paris die Banlieues, sondern den Hyde Park und die Place de la Concorde. Paris und London haben viel mehr Quadratkilometer als Berlin, aber zwischen Grunewald und Rummelsburg findet man genug Abwechslung.
In Berlin gibt es so viele tolle Orte. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Wer sich trotzdem nicht wohl fühlt, fährt einfach woanders hin. Easy.
Mir ist Berlin lieber als London oder Paris. Beide Städte empfinde ich hauptsächlich als überlaufen und stressig.
Auch außerhalb der touristischen Zentren?
Ich habe in London am Hampstead Heath und in Paris im Marais in stillen Straßen gelebt und für Juni ein Hotel Nähe Bahnhof Friedrichstraße gebucht. Ich hoffe auf Schallschutzfenster im obersten Stockwerk.