

Sonntag, 23. Juli
Die lieblose Aufzählung soll willkommene Leser meines Tagebuchs nicht täuschen: Wir bilden eine Einheit, mit Leibern und Seelen. Auch wenn Guntram sich in dem Stadium zu befinden scheint, in dem die DDR 1989 war. – Wer zu spät geht, den bestraft das Leben. – Ich verstehe seine Verbitterung. Auch wenn es schmerzhaft ist zu sehen, dass seine geistige Beweglichkeit den Verlust der körperlichen nicht auszugleichen vermag, nicht für ihn. Statt mit den Beinen über den Golfplatz zu laufen: Mit der Musik, der Literatur Schritt zu halten – er kann es nicht. Geschichte der Futurologie. Briefmarken, Rosen, Aktienkurse, nichts rettet ihn aus seiner Befangenheit. Das Schicksal, das ihm bisher Schmerzen erspart hat, hat ihn mit dem Verlust der Mobilität an seiner verwundbarsten Stelle getroffen – oder wäre jede Stelle die schlimmste gewesen? Die Lähmung seiner Beine legt sich über das Haus, ein Pilz, der die Gedanken und Empfindungen umfingert, ein Absterben der Triebe: Der Wille wird fähig, sich selbst zu verneinen. Auf diesem Umweg macht das Lähmende auch mir ungeheuer zu schaffen. Es stoppt meine Raserei über ein Innehalten hinaus.
Raserei war mir immer wichtig, und ein paarmal habe ich sie ja auch ausprobiert. Bis auf Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit, Selbstmordversuchen mittelbar Beteiligter und Scherben wertloser Gläser ist dabei aber nichts herausgekommen, also gar nichts zum Aufbewahren. – Kein Wunder, Raserei ist Augenblick, und wenn man sich dabei weder Aids noch sonst wie den Tod holt, folgen unweigerlich all die vielen Augenblicke der Ernüchterung und verbreiten Stillstand. Mein Traum von der unendlichen Raserei ist wohl der Traum, dass Anfang und Ende eins sind: der Traum vom Stillstand.
Den aber will Guntram noch lange nicht, obwohl er es behauptet. Er weiß es nicht besser, er hat keinen guten Umgang mit sich. Die Wendigkeit, seinen Zustand wie früher zu überspielen, hat er nicht mehr, aber die Kraft, ihn hinzunehmen, ist ihm nicht zugewachsen. Loslassen und ertragen. Sich begnügen mit dem, was bleibt. Wer es geschafft hat, der werfe den ersten Stein!
Irene stand plötzlich im Raum. Lady Macbeth, Rachegöttin, Bittstellerin. Ich schreckte auf, ertappt beim Fortsein – hatte ich beim Denken geschlafen oder beim Schlafen gedacht?
„Guntram ist hingefallen. Er hat versucht aufzustehen. Ich kann ihn nicht allein zurückkriegen ins Bett.“
Ich war sofort zurück und sprang auf.
Sie ging vor, ich folgte ihr. Mehr und mehr kommt mir der schmale Gang, der die Wohnung meiner Eltern von meiner trennt, vor wie die Glienicker Brücke.
Da lag er, mein Vater. Den Kopf blutig geschlagen an der Wand, hilflos und verwirrt.
Die Messen waren längst abgefeiert, als ich so endgültig aufwachte, dass ich bereit war, den Tag zwar nicht zu heiligen, aber ihn anzunehmen. Beim Mittagessen erzählte ich von Berlin: den Ausstellungen und Familienmitgliedern. Leben aus zweiter Hand ist traurig. Leben in virtuellen Welten ist zeitgemäß: je durchgeknallter, desto abgefahrener.
Ich fuhr ab: traurig. Die ‚Liebesfluchten‘ hatte ich beendet. Ich schrieb: den Anfang dieser Aufzeichnungen: ‚Zwischen Hamburg und Berlin‘.
Am Bahnhof Zoo fiel ich verabredungsgemäß Dorothee in die Arme, in dieser Sekunde meiner ältesten, liebsten, besten Freundin, die nicht nur ohne Klagen, sondern mit Feuereifer die neun Stationen bis Warschauer Straße mit mir fährt. Man läuft von der S-Bahn wacker die paar Schritte hinüber zur U-Bahn, die dort ihre Endstation hat (Optimisten sagen: Anfangsstation), fährt über Berlins – seit der Kapitalismus sie repariert hat – wieder schönste Brücke: die in wilhelminischer Pracht und dem späten Sonnenlicht erstrahlende Oberbaumbrücke, erreicht das südliche Spreeufer und ist in Kreuzberg, im früheren sogenannten Westen. Schlesisches Tor – Görlitzer Bahnhof: Da steigen wir aus und gehen die Eisentreppe hinunter in den Orient. Der Nachmittag hat sich in den Abend verabschiedet, Sonntagsschläfrigkeit regelt den Verkehr. Wir gehen durch nackte Straßen: keine Bäume, keine Frauen, keine Kinder. Wenige Männer in Gruppen, geschlossene Läden mit armseligen Auslagen; aus den schmalen Kneipen und Cafés wehen Männerstimmen von den Tischen und Frauenstimmen aus den Lautsprechern, ein Singsang, der sich nirgends fängt und weitertreibt.
Schweißiger Geruch von Zwiebeln und Gewürzen. Nichts ist heimelig oder unheimlich. Die Straße strahlt: glanzlos und ohne Heiterkeit.
Als ich schon befürchtete, an der letzten Kreuzung in der verkehrten Richtung gegangen zu sein, erreichen wir das ‚Abendmahl‘. Ich habe gestern von Hamburg aus bestellt. – Überflüssig. Drinnen ist alles leer, draußen sitzen fünf junge Männer. Ihre wogende Lebendigkeit der Worte und Gesten mildert die Tristesse der Szene zur Melancholie.
Dorothee will aus Solidarität auf Wein verzichten, aber ich lasse es nicht zu. Sie erzählt von Breslau, von Rom und von Berlin im Krieg. Im Frühjahr 1945 war sie in Sacrow. Sie erzählt von einem schweren Gefecht und davon, wie sie anschließend geholfen hat, die Toten auf dem Friedhof zu schichten.
Es schaudert mich. Massaker im Schrebergarten. Ein Sechster wird begrüßt und setzt sich zu den jungen Männern. Sie trinken Wein und Bier. Eine Platte mit Fisch wird aufgetragen. Das Aluminium schimmert rosa. Wer hier isst, ist nicht von hier.
„Ach, mein Schatz“, sagt Dorothee. Wirke ich bedrückt? Wir sitzen drinnen. Erst haben wir gezögert, aber dann waren wir uns ohne Worte einig: Die Wärme kann die Nacktheit nicht vertreiben.
Es tut gut, zuzuhören und nichts zu wollen.
„Ich nehme keinen Nachtisch“, sagt Dorothee, „nimmst du einen?“ – „Na schön, dann nehm’ ich auch was.“
Der Rückzug zum Schlesischen Bahnhof kommt mir kürzer vor und noch menschenleerer. Diese Gegend wird auch im alternativen Reiseführer des Barbaren aufgezählt. Er empfiehlt den Freitagvormittag, da sei es hier wie im Bazar. Ich hatte mir einen Ausflug vorgemerkt, aber jetzt hake ich das Viertel neugierlos ab. Ich fange an, die Tage einzuteilen: der Anfang vom Ende. Bis zum Halleschen Tor fahren wir zusammen, dann fährt Dorothee weiter oben dem Kurfürstendamm entgegen, ich gleite unter die Erde: zwei Stationen bis Stadtmitte.
Die Deutschen sind hier in der Minderheit, würde Guntram in meinem U-Bahnwagen grimmig vermerken und nicht den Pass meinen. Es ist wirklich seltsam: Je leerer die Züge sind, desto weniger Deutsche fahren. Eine Türkin starrt in sich hinein. Zwei junge Schwarze reden schnell und gleichzeitig. Drei Japanerinnen recken die Köpfe hilfesuchend und bemühen sich, die Stationsnamen auf der langgestreckten Grafik zu entziffern. Das fällt auch mir schwer. Jemand steigt ein. Jemand steigt aus. Ein Gescheitelter, der aussieht wie ein SED-Funktionär, klappt das ‚Time Magazine‘ zu und gähnt mit schlaffem Mund. CIA? Ich komme aus Kreuzberg, ich komme aus Hamburg. Ich komme aus einer anderen Welt. Sieht man mir das an? Mein Spiegelbild verschwindet im Fenster. Stadtmitte, ich bin da.
Das Ticket, das die ‚Madison‘-Tür öffnen soll, funktioniert nicht. Fluch der Elektronik? Ich habe oben in der großen Schale neben den Astern noch ein Ticket, das wird wohl das richtige sein. Die Helligkeit ist lichtlos geworden. Ich versuche es noch mal. Sinnlos, nichts zu machen. Durch den Haupteingang gelange ich in den Innenhof. Am Bürofenster ein Schild: ‚Sollten Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten eintreffen, wenden Sie sich bitte an den Portier.‘ – Na, immerhin. Die Portiersloge ist gut versteckt am anderen Ende des Hofes. Im Fenster ein Schild: ‚Bin gleich zurück‘. Erst denke ich an Dorothees Sofa, dann an meine Kreditkarte, dann kommt nach einem sehr ausgedehnten ‚gleich‘ der Portier. Er vertraut mir, was ich leichtsinnig von ihm finde, aber es macht mich stolz. Ich putze mir die Zähne traditionell. Meine elektrische Bürste lädt derweil auf. In Hamburg.

Titelbild mit Material von IngolfBLN/Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
#2.42 | Pflichten wahrnehmen#2.44 | Versuche, das Leben zu ertragen

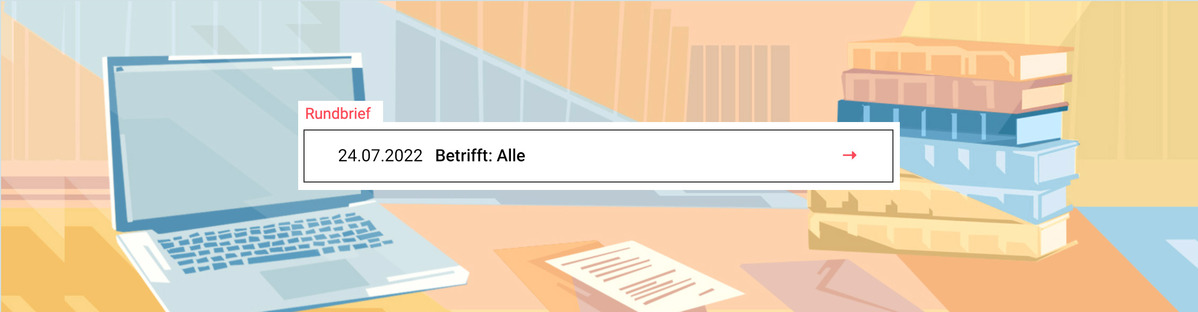







































































Der Verlust der Mobilität scheint mir persönlich auch ein Schicksal zu sein, dass besonders schwer zu ertragen wäre. Aber wahrscheinlich kann man so etwas von Außen gar nicht richtig einschätzen.
Jeder Einschnitt dieser Art muss für den Betroffenen schlimm sein. Schließlich verändert sich durch so etwas das ganze Leben.
Wie schlimm, wenn sowas passiert. So ein Sturz ist im Alter ja leider gar keine Seltenheit. Ich kenne da ähnliches. Man darf wirklich nicht alt werden.
Mir ist das durch meinen Schlaganfall schon mit 64 passiert. Mein Vater war 89, als er nicht mehr laufen konnte.
TikTok-Reels anzuschauen ist letztendlich ja auch nichts anderes als Leben aus zweiter Hand.
Ja das ist was dran, aber Social Media ist mittlerweile so ein präsenter Teil in unseren Leben … gerade bei den jüngeren Generationen. Aber es kommt ja auch drauf an, ob man nur konsumiert oder auch selbst Content schafft.
Ein Leben aus zweiter Hand ist immer noch besser als ein Leben ohne Hand und Fuß.
Manche finden online ja auch eine Art des Teilhabens, das sie auf der Straße eben nicht finden. Das sollte man gar nicht beurteilen.
Und erst recht nicht verurteilen.
Hmm, sieht man einem wirklich an woher man kommt? Ich mache mir jedenfalls immer vor, dass dies nicht der Fall ist.
Ich glaube das liegt nicht zuletzt daran, wie sehr man sich mit dem Ort, wo man lebt, identifiziert.
Man kann durch Kleidung und Aufmachung sehr von seinem Herkommen ablenken, wenn man das will. Im Gespräch ist das schwieriger.
Ich weiss nicht. Jeder sieht unterschiedliche Städte doch auch mit ganz anderen Augen.
Aber trotzdem finden die meisten Augen doch Rom schöner als Remscheid.
Das ist sicher keine Frage. Auch wenn Schönheit subjektiv ist, gibt es da ja objektive Unterschiede. Aber ist man sich auch einig was typisch römisch ist?
Je weniger einig man sich ist, desto mehr wird darüber geredet: marketingmäßig ein Plus.
Die Gegend um das Schlesische Tor ist ja vor allem am Wochenende immer richtig überlaufen. Da scheinen die jungen partyhungrigen Touristen aus allen Ecken zu kriechen und ihren Weg nach Kreuzberg zu machen.
Nicht alle kriechen, manche nehmen den Bus.
Ich lese immer, dass es die in letzte Zeit eher nach Neukölln zieht. Stimmt das gar nicht?
Vor vier Wochen war ich in Britz, das zu Neukölln gehört. Da war es sehr ruhig.
Dabei ist der Schlosspark doch so hübsch…
… weil er so ruhig ist.