Rückblick in den Mai 1997
Ein Bandscheibenvorfall ist nicht der Weltuntergang, aber auch kein Schnupfen. Gepaart mit einer nicht genügend schließenden Venenklappe deutet er an, dass man nicht schwer heben soll, sich etwas schonen muss und die Fünfzig erreicht hat. Ich trug stramme Wadenstrümpfe aus dem Laden, der auch Rollstühle führt, und einen neuen – vor allem aber sperrigen – Koffer, als ich vom Bahnhof Zoo aus Berlin beschritt. Obwohl ich mir meiner Gebrechen voll bewusst war oder vielleicht gerade, weil ich mich für schwächlich hielt, traute ich mich nicht, einen Taxifahrer, der vielleicht nicht nur zwei Stunden am Stand rumgelungert, sondern auch eine kranke Frau und drei bettlägerige Kinder hatte, dazu aufzufordern, mich um die Ecke ins ‚Savoy‘ zu fahren. Ja, wenn man Skrupel hat, hat man schon verloren. Und wenn man wissend ist, auch. Denn als unwissender Fremder wäre ich einfach in die Taxe gestiegen, ohne zu wissen, dass die Fahrt kürzer ist als nach Zehlendorf. Das Problem hätte sich eventuell auch dadurch lösen lassen, dass ich gesagt hätte: „Hören Sie, ich habe nur einen kurzen Weg, aber einen lahmen Rücken. Ich gebe Ihnen 10 Mark, fahren Sie mich!“ Dann hätte er gesagt: „Nein, nein. Wir müssen sowieso fahren. Sie sind ein Kunde wie jeder andere!“, und das Taxameter hätte neun Mark neunzig gezeigt. Irgendwie fand ich, dass ich mich nur mit zwanzig Mark nobel aus der Affäre gekauft hätte, weniger wegen der Frau als wegen dieser bettlägerigen Kinder, aber das war ich auf keinen Fall bereit, anzulegen, lieber hätte ich mir das Kreuz gebrochen, und so lief ich zu Fuß mit Umhängetasche und über den Asphalt scheppernden Rollkoffer die Hardenbergstraße herunter, in der Hoffnung, dass die Wadenstrümpfe das Ganze irgendwie zusammenhalten würden.
Immerhin, mein Zimmer im ‚Savoy‘ war reserviert, wenn auch noch nicht frei. Bo, hilfsbereit wie immer, bot gleich an, dass ich mein Gepäck bei ihm lassen könnte. Bos Frau, die ich dadurch, dass sie neben ihm stand, gleich wiedererkannte, sagte nichts. Sie spricht kein Deutsch und nur drei Worte Englisch, die sie aber nie in irgendeinen Zusammenhang hineinzwängen kann. Es ergeht ihr wie bei diesem Intelligenztest, bei dem man aus den Wörtern ‚Hase‘, ‚Feld‘, ‚Jäger‘ einen Satz bilden soll, was aber nur gelingen kann, wenn einem in der angepeilten Sprache noch vier bis fünf weitere Begriffe zur Verfügung stehen.
Ich war vertrauensselig genug, mein Gepäck beim Portier zu belassen, vor allem wusste ich, dass mein Programm nicht flexibel genug gestaltet war, irgendwelche Verzögerungen zuzulassen.
Zunächst mal wurde das Karree Fasanenstraße–Lietzenburger–Uhlandstraße abgewandert, das stand pars pro toto für die ganze Ku’damm-Umgebung, dieser Berlin-Aspekt war somit ausgestanden. Ich fand Bos und Ingrids Schritt etwas schleppender, als ich mir das ausgemalt hatte, auch die Verzögerungen vor den Schaufenstern waren von mir nicht bedacht worden. So kam es, dass wir erst fünf nach halb eins in der ‚Paris Bar‘ eintrafen, was zwar meinen Neigungen, vor halb zwei keine Nahrung aufzunehmen, ein paar Zentimeter entgegenkam, es ging aber nicht um meine Neigungen, sondern um die Einhaltung eines Terminplans.
Teil dieses Terminplans war es, dass auf der Bühne alles ganz locker und ungezwungen aussehen sollte, egal wie hinter den Kulissen gekeucht wurde. So aßen wir Vorspeise, Hauptgericht und keinen Nachtisch, der Umweg zu meinem Gepäck wurde unterlassen und schnurstracks der Bahnhof Zoo aufgesucht. Wir kauften uns eine 7-Tage-Karte für 40 Mark, jeder von uns, und ich drückte mich später, am Ende der Reise etwas davor, nachzurechnen, ob sich das ausgezahlt hatte, mir schwante nämlich: eher nicht. Zumindest konnten wir von da an alle Verkehrsmittel sorglos benutzen, ohne Markstücke, Abstempelungen oder Schwarzfahrten einkalkulieren zu müssen.
Tiergarten–Bellevue–Lehrter Bahnhof, das ist Kindheitschronik, aber ich schwieg, weil sich so was angesichts von misslungenen Sechzigerjahre-Bauten und ein paar Parkbäumen schwer vermitteln lässt in der knappen Zeit. Dazu hätte es dreimal des Berliner S-Bahn-Ringes bedurft, und der ist, seit Guntram den Krieg verloren hat, noch immer nicht wieder ganz geschlossen worden. Der Lehrter Bahnhof lag so lange, wie ich zurückdenken kann, immer etwas am Rande der Zivilisation, jetzt liegt er in der Sahara, und nur die Temperatur und die Kräne deuten an, dass man sich nicht in der Wüste befindet, sondern dass hier der neue Hauptbahnhof entstehen soll.
Wir staksten zum nahe gelegenen Hamburger Bahnhof, den ich dank Dorothees Empfehlung bereits von außen kannte, und betraten ihn. Ich war in der Erwartung gekommen, dort ein Technik-Museum vorzufinden, stattdessen gab es moderne Kunst. In den riesigen Hallen hingen all die Elvis Presleys und Comics, die man von Warhol und Roy Lichtenstein aus den Illustrierten kennt, in Originalgröße und so original wie Siebdrucke sein können.
Bo und Ingrid hatten Grund, den Genius Loci zu bewundern, die Exponate bedeuteten ihnen meiner Einschätzung nach wenig. Ich mochte nicht zugeben, dass mein Darm die ganze Aufregung nicht verkraftete und tarnte meine verbissene Suche nach der Toilette durch Hingerissenheit über die vierfach geklonte Marilyn Monroe. Dort jedenfalls fand Bo mich zehn Minuten später, nach schon etwas angestrengtem Ausschauhalten wieder, während Ingrid vor der Suppendose verharrte. Ich war inzwischen erleichtert, Bo auf seine Weise jetzt auch, und wir konnten gehen. „Es sollte ja nur so ein allgemeiner Eindruck sein“, sagte ich, wohl wissend, dass beide keine Minute länger hätten bleiben wollen.
Ehrfürchtig überschritten wir die Sandkrugbrücke am ehemaligen Grenzübergang Invalidenstraße, und ich machte auf die Charité aufmerksam, die mich von der S-Bahn aus zwischen Lehrter Bahnhof und Friedrichstraße immer fasziniert hatte. Sie klebt als erstes Gebäude im Osten an der Spree wie ein Stück Alt-Nürnberg auf den Lebkuchenbüchsen. Nachdem ich hinterfragt hatte, dass Bo und Ingrid die Namen ‚Virchow‘, ‚Robert Koch‘ und ‚Sauerbruch‘ nichts sagten, sah ich die Chancen des Instituts, Anerkennung zu finden, schwinden und merkte bloß an: „Hier lag Honecker, nachdem er abgesetzt wurde. Von hier aus kam er gleich ins Gefängnis.“ Achtung einflößend war allerdings die Länge des Gebäudekomplexes, den wir voll durchmaßen, ungefähr wie vom KaDeWe bis zur Gedächtniskirche und wieder zurück. Am anderen Ende standen Taxis, aber nun hielt ich die Reststrecke für nicht weiter als Zoo–‚Savoy‘, was, schon wegen der bettlägerigen Kinder, das Besteigen einer Droschke ausschloss. Wir überquerten etliche Trümmer, kamen am Deutschen Theater sehenswerterweise vorbei und erreichten unser Ziel, den Friedrichstadt-Palast. – Na schön, es war mehr die Strecke Siegessäule–Brandenburger Tor gewesen, aber die beiden gingen auch so lahm, ich immer acht Schritte vorweg, um sie auf Trab zu bringen. Da man sich mit ‚Hase‘, ‚Jäger‘, ‚Feld‘ weder Büchner noch Brecht seriös nähern kann, hatte ich um Ingrids Sprachkenntnisse willen alles Anspruchsvolle – abgesehen von Warhol – ausgeschlossen und mich mehr aufs Heitere kapriziert. Da schien mir eine Revue im Friedrichstadt-Palast gerade das Richtige, zumal im Berlin-Führer gestanden hatte, diese Show sei einmalig in Europa. Dasselbe hatte mir Peter Böhme1 am Telefon auch gesagt, mit einem etwas eigenartigen Tonfall in der Stimme. Ich hatte noch in Hamburg gedacht: ‚Genau das, was man Sonnabendabend will.‘ Aber – ausverkauft. Ich hatte nur noch Karten für die Nachmittagsvorstellung buchen können, abzuholen eine Stunde vor Beginn der Vorstellung. – Ist auch viel besser, es wird sowieso regnen, da ist man froh, wenn man was vorhat, hatte ich mich getröstet, aber das mit der Stunde vorher nicht akzeptieren wollen. Deshalb waren wir jetzt, Freitag Nachmittag, hier, um uns vom Diktat der Tageskasse unabhängig zu machen. Zugegeben, das Gebäude – firlefanziger Plattenbau – ließ Schlimmstes vermuten. Unmöglich, sich vorzustellen, dass hier anderes stattfindet als sozialistisches Trallala, aber erstens bin ich in Stockholm auch eigentümlichen Darbietungen ausgesetzt gewesen, und zweitens habe ich schon in abgewetzten Kinos spannende Filme gesehen.

Donnerstag, 29. Juni
Es gibt Menschen, die schlafen abends ein und wachen morgens auf. Dann fragen sie: ‚Was kost’ die Welt?‘ und ‚Wo bleibt das Frühstück?!‘ Sie halten nach der vierten Tasse Kaffee nach den Bäumen Ausschau, die sie ausreißen könnten; die Ärmel hatten sie schon hochgekrempelt, bevor sie sich angezogen haben. Zu diesen Menschen gehöre ich nicht. Ich tauche jede Stunde auf und gleich wieder ab, wenn es schön still und dunkel ist. Dämmert es durch Rollläden oder Tücher hindurch, schlafe ich auch gleich wieder ein, aber beunruhigt. Scheint es draußen hell zu sein, schlafe ich sofort weiter, aber alarmiert. Mit dem heutigen Tag ist diese Tortur um eine weitere Qual bereichert: Giuseppe im Bad rumoren zu hören.
Ich fühle mich in Berlin als Gastgeber noch weitaus mehr in die Pflicht genommen als in meiner Wohnung: In meinem Kühlschrank kennt Giuseppe sich aus, in Berlin nicht. Glücklicherweise ist Giuseppe kein Frühaufsteher, und Bo und Ingrid sind extrem vertrödelt. Ich dagegen brauche, wenn Not am Mann ist, zehn Minuten vom Bett bis auf die Straße. Wenn ich keine Unterhose anziehe, schaffe ich es in acht Minuten, weil das Suchen wegfällt. Diese Dreiviertelstunde Vorsprung kalkuliere ich bei meinen Schlafgewohnheiten ein.
Aber heute halfen weder Vorsatz noch Pflichtgefühl. Es war mir vollkommen unmöglich, mich länger auf den Beinen zu halten, als eine Demonstration dauert, um zu zeigen, dass man sich nicht auf den Beinen halten kann. Ich musste keineswegs wohl, sondern nur übel Giuseppe den erfahrenen Berlin-Besuchern Bo und Ingrid anvertrauen, in der Hoffnung, dass sie mir keine Schande machten, sondern nun Giuseppe einer genauso sorgfältigen Führung aussetzen würden wie ich vor drei Jahren sie. Mir blieben somit der Tag und das Bett, um mich zu regenerieren und dabei zurückzudenken an diese Zeit, die – bei Dunkel besehen – auch nicht besser war als jetzt die dämmernde Gegenwart.
Während ich also im Zwielicht des ausgesperrten Tages auf meinem Laken döse, schmuggle ich nun die verknappten Eindrücke jener gerade erwähnten 1997er-Reise ein. Meine Ausrede: Ich hatte das alles ja genauso im Gedächtnis, während ich ausgestreckt den Fortgang unseres gegenwärtigen Berlin-Aufenthalts plante. Überschneidungen zu damals sollten vermieden werden, aber Wiedererkennungswert hat auch was Schönes. Meine Aufzeichnungen belegen, wie erbarmungslos ich als Reiseführer vorging, und ich kann nicht aufhören zu denken, dass die halbseitige Lähmung seit meinem Schlaganfall die irdische Strafe dafür ist, dass ich unterwegs meine Programme allen Beteiligten gegenüber immer so tyrannisch durchgezogen habe. Vielleicht bleiben mir zum Ausgleich ein paar Grad Fegefeuer erspart.
Who is who? (Akkordeon)
1 – Peter Böhme
[ˈpeːtɐ] [ˈbøːmə]
Der für Karten und Zeremoniell Verantwortliche der Berliner Festwochen, sieht aus wie von El Greco gemalt. Natürlich mit Dorothee befreundet, aber mit mir auch, und mit Roland schon vor mir.
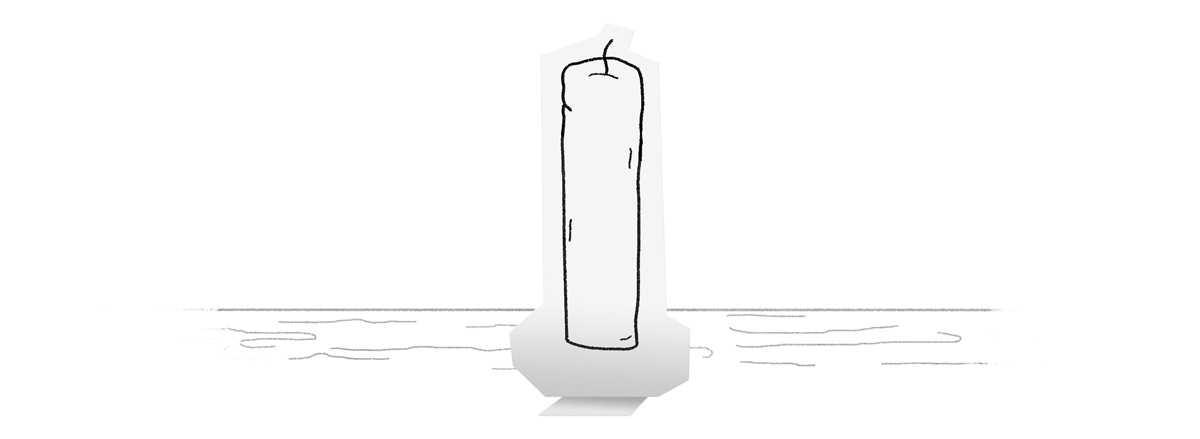
Titelgrafik mit Material von: Wolfgang Pehlemann, Wiesbaden, Germany/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE (Berlin Bahnhof Zoo Zoologischer Garten, Foto 2007, Wolfgang Pehlemann, Wiesbaden, IMG_4621), Roehrensee/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Lehrter Bahnhof), Dosseman/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Hamburger Bahnhof), SuriyaPhoto/Shutterstock (Bilderrahmen), by-studio/Shutterstock (Umleitungsschild), Henrik Donnestad/unsplash (Gemälde)
#2.04 | Mitte#2.05 (B) | Spree/Havel – alles unter einem Hut









































































Ich höre auch immer wieder, dass der Friedrichstadtpalast mit seinen Shows einmalig sein soll. Aber ist es nicht wirklich nur Firlefanz?
Ach was. Nicht alles was entertaint ist billiger Quatsch. Die machen doch wirklich tolle Shows.
Die Shows ähneln sich natürlich in der Machart. Meine erste dort war die beste, aber das liegt wohl mehr an meiner Erwartungshaltung als am Regie-Konzept.
Das ist ja meistens das Geheimnis zu einem tollen Theater-Erlebnis. Möglichst wenig Erwartungen und dann eine schöne Überraschung – entsprechend groß wird die Begeisterung sein.
Alles, was nicht Steigerung ist, wirkt beim zweiten Mal schon weniger großartig. Aber es gibt doch Menschen, die sich manche Filme zehnmal ansehen, ganz ohne Wachstumsrate!
Es soll ja sogar Fans geben, die für dasselbe Musical zehnmal Karten kaufen. Jedem das Seine, würde ich sagen. Mich selbst lockt eher Neues.
Obsessiv
Es gibt Menschen, die sagen, sie entdecken bei jeder Wiederbegegnung etwas Neues. Das trifft aber wohl eher auf die Sixtinische Kapelle und Beethovens späte Streichquartette zu als auf ‚Ich tanz‘ mich in dein Herz hinein‘.
Das hat ja fast etwas Meditatives, im Alten wieder und wieder etwas Neues zu entdecken. Ich würde mir dazu aber auch kein Musical aussuchen wollen.
Einen Schlaganfall darf man doch nicht als Strafe sehen.
Manchmal ist das angenehmer als der Gedanke, dass Krankheiten und Schicksalsschläge generell einfach zufällig passieren.
Selbst wenn man nicht an Strafe glaubt, ist es doch nett, sich als Ausgleich eine Abkürzung in den Himmel vorzustellen.
Ich finde das Leben hier immer viel aufregender als die Vorstellung vom Himmel. Bin ich die Ausnahme?
Wer aber Aufregungen nicht schätzt, stellt sich lieber einen Himmel vor, in dem es bis in alle Ewigkeit nichts zu tun gibt, außer zu genießen, dass es nichts zu tun gibt.
Ich brauche morgens meine Tasse Kaffe um auf die Beine zu kommen. Aber länger als 30 Minuten brauche ich auch nicht vom Bett bis aus dem Haus.
Wer das Frühstück als die schönste Mahlzeit des Tages empfindet, sieht das natürlich anders. Ich mache lieber von 21.30 Uhr bis 13.30 Uhr eine gesunde16-Stunden-Pause. In der Theorie.
Hmm, frühstücken kann schon schön sein. Aber das gilt für mich eher am Wochenende, wenn ich eh zuhause ausspannen will. Oder wenn Freunde zu Besuch kommen. In der regulären Arbeitswoche bin ich da pragmatischer.
Das Frühstück hat man sich nicht verdient. Träume werden nicht belohnt.
Außer man träumt vom Frühstück und belohnt sich gleich selbst.
Träume schmecken nach dem Aufwachen leicht ein wenig fad.
Na als Reiseführer muss man doch erbarmungslos sein. Wenigstens ein bisschen. Man muss ja führen, nicht nur vorschlagen.
Trotzdem bietet es sich natürlich an im Blick zu haben, was die Freunde oder die Gruppe, die man herumführt, überhaupt sehen wollen.
Wenn man die Geführten als wissbegierig einstuft, will man – je nach Temperament – möglichst viel hineinstopfen in die Zeitspanne. Ich schildere mich da leicht ironisch als übereifrig.
Ich zeige Freunden immer was ich selbst an meiner Stadt mag. Wenn sie allein unterwegs wären würden sie wahrscheinlich andere Dinge anschauen, aber das ist doch gerade das Schöne.
Darum vertrauen wir ja Ortskundigen lieber als Broschüren.
Ich bin immer erstaunt, dass diese ganz klassischen Reiseführer nach wie vor beliebt sind. Im Mobiltelefon-Zeitalter überrascht das ja doch etwas.
Solche Wochenkarten lohnen sich ja meistens nur, wenn man vorhat wirklich viel mit den Öffentlichen unterwegs zu sein. Meiner Erfahrung nach haut das am Ende oft nicht hin. Aber was soll es. Man erspart sich zumindest die Überlegungen bzgl. Ticketkauf etc.
Fürs Schwarzfahren war ich nie zu moralisch, aber meistens zu feige.
Ich bin dafür meistens einfach zu faul. Das beinhaltet ja dann oft, dass man bei jeder Station im Blick haben muss ob Kontrolleure zusteigen.
Chuzpe reicht.
Ich hatte vor Jahren mal einen Bandscheibenvorfall im unteren Rücken. Das war wirklich keine Freude. Man fühlt sich ja mit einem Schlag so wahnsinnig eingeschränkt und hilflos.
Ein Vorgeschmack auf den Schlaganfall, aber keine Vorbereitung.
Auf so etwas kann man sich auch wirklich nie vorbereiten, oder?
Man kann sich alles ausmalen, aber wie man nachher wirklich empfinden wird – das ist schwer vorhersehbar.
Ich habe in abgewetzten Kinos sogar ein paar der besten Filmerlebnisse gehabt. Die großen modernen Blockbuster Kinos zeigen ja oft nur das, was der größten Masse zusagt.
Es gibt glücklicherweise auch ansehnliche Filmkunsttheater und sogar sehenswerte Blockbuster in Kinopalästen.
Das kann ich nur bestätigen. Mein Programmkino ist alles andere als abgewetzt, sondern im Gegenteil sogar viel gemütlicher und gepflegter als das große Multiplex in der Stadt.