

Donnerstag, 13. Juli
Gegen Viertel nach drei am Nachmittag wachte ich endgültig auf. Wie weit ich auch dachte: Ich hatte keine Verpflichtungen mehr. Meinem Körper ging es schlecht, aber ich war frei. Kamillentee und Haferflocken hatte ich schon am Anfang der Woche besorgt. Irgendwann trank ich, irgendwann aß ich, und bis zum Müdewerden wand ich mich in meinem Buch langsam den mühseligen Weg aus der Monarchie in die Demokratie.
Freitag, 14. Juli, Wochenende
Meine Abstinenz wurde nicht belohnt. Beim Aufwachen ging es mir genauso schlecht wie jeden Tag. Was im Leben wird überhaupt belohnt? Ich las die ‚Fragen an die deutsche Geschichte‘ zu Ende. Dann holte ich von Lafayette meine Jeans ab, ohne sie anzuprobieren. Stattdessen schlüpfte ich in den bindfadenfarbenen Pullover. Schließlich hatte ich viel Geld an Budapester Schuhen gespart. Er stand mir nicht, labberte an mir runter. – Wieder gespart. Wieder nicht gelebt. Ich umrundete den Gendarmenmarkt, zwecklos. Zurück. Meine echten Blumen welkten, das kommt davon. Haferbrei, Kamillentee. Ich fing an, ‚Großes Solo für Anton‘ zu lesen. Endzeit.
Sonnabend, 15. Juli
Ich riss die Gardine energisch auseinander, das war Programm. Das Licht biss mir wie Zwiebeln in die Augen. ‚Schönes Wetter‘, dachte ich, ‚das muss man ausnutzen‘, schloss den Vorhang bedächtig, kehrte ins Bett zurück, in die Heimat, und war noch in derselben Minute wieder zu Hause.
Das Telefongellen krallte sich mir in die Ohren. „Wieso bist du noch da?“, Dorothees Frage beschuldigte mich, nicht in Sanssouci, in Aktion, höchstens in Alarmbereitschaft zu sein, warf aber doch ein befremdliches Licht auf sie selbst.
„Ich warte noch auf deinen Anruf“, sagte ich.
Immerhin lachte sie.
Weil ich sie nicht überfordern wollte, sah ich lieber auf meine Armbanduhr, statt sie zu fragen, wie spät es sei.
„Ich bin doch nicht nach Mailand geflogen“, erklärte sie mir.
„Ach, warum nicht?“, fragte ich. Es wäre nicht nett gewesen, sie zu fragen, warum sie denn überhaupt hätte fliegen wollen. Dass Dorothee eine der unendlich vielen Reisen, von denen sie mir erzählt, wirklich antreten könnte, glaube ich erst, wenn sie wieder zurück ist.
„Dafür fahre ich Anfang August nach Salzburg“, fuhr sie fort. Außer im Touristischen war der Zusammenhang unklar. Aber ich konnte mir zusammenreimen, dass Mailand einer ‚West Side Story‘-Aufführung in der Scala gegolten hätte, von der Craig schon berichtet hatte, und dass Salzburg Abbado, Boulez oder Pollini betreffen würde, also fragte ich nicht weiter.
Dorothee erinnerte mich daran, dass wir am Nachmittag in die Ausstellung einer neu eröffneten Galerie in der Auguststraße gehen wollten. Genauer gesagt: Sie wollte gehen und ich sollte mitkommen. Eigentlich interessierte die Ausstellung sie nicht besonders, aber die Räumlichkeiten.
Nach drei Tagen der Tatenlosigkeit konnte ich mich ihrem Drängen auch vor dem eigenen Gewissen kaum entziehen, zumal Dorothee durch forsches Abfragen – „Was hast du gemacht?“ – ein Gefühl der Minderwertigkeit im Angesprochenen zu erzeugen versteht, wenn der nichts weiter getan hat, als Bücher über die Letzten Dinge zu lesen.
Aber auch nicht alle Aktivitäten, die mehr Eigeninitiative erfordern, als im Bett zu liegen und eine Seite umzublättern, finden ihren Beifall.
„Ihr wart im Dom? Ach, schrecklich! Der ist doch so bramsig wie Kohl, der ihn aufgebaut hat, ausgerechnet den Dom!“ Dass der Aufbau weder mit Kohls Händen noch auf seine Anweisung hin stattfand, ist Dorothee gegenüber kein stichhaltiges Argument. Auf DDR-Hinterlassenschaft lässt sie nichts kommen. Denn so, wie sie in den Siebzigerjahren als Vorreiterin der Avantgarde jedes ohrenzerfetzende Konzert in Donaueschingen besuchte, so fühlt sie jetzt mit den Geknechteten und Entrechteten unseres Staates, die sie vorzugsweise im Osten ortet. So ist sie eine kämpferische Gegnerin des Schlosses, wobei sie, weil ihr das besser in den Kram passt, behauptet, das Schloss sei ein nichtswürdiges Machwerk der wilhelminischen Zeit. – Schlicht falsch! Und im Palast der Republik hätten viele Menschen viel Freude gehabt. – Schlicht, aber richtig. Erwähnt man, dass man den Zoo besuchen wolle, kontert sie: „Der Ostzoo in Friedrichshain ist doch viel schöner.“ Mag man die Gegend um den Bahnhof Friedrichstraße nicht, empört sie sich, wie abscheulich es rings um den Bahnhof Zoo aussähe. Weil es mich ärgert, dass mich das ärgert, habe ich mir angewöhnt, sie bewusst zu provozieren, und wenn sie dann reagiert, wie ich es erwartet habe, bin ich zufrieden.
Nachdem ich ihr für den Nachmittag zugesagt hatte, kam ich mit etwas besonders Abgefeimtem: „Ich bin neulich mal die Dorotheenstraße runtergegangen, da muss ja noch sehr viel gemacht werden. Aber gut, dass sie nicht mehr Clara-Zetkin-Straße heißt, das war ein scheußlicher Name.“
„Die Irma Schack1 war ganz entrüstet, die hat gesagt: ‚Clara Zetkin hatte große Verdienste‘“, schob Dorothee erst mal eine Bekannte vor, aber dann gab sie zu, Irma Schack darüber belehrt zu haben, dass Dorotheenstraße der historische Name sei, der nun rechtmäßig wieder eingesetzt worden ist.
„Wusste die Schack das nicht?“, fragte ich ungläubig. „Alle Luisen, Charlotten und Dorotheen sind doch immer preußische Prinzessinnen, das weiß jeder.“
Dorothee lachte jungmädchenhaft, und dabei beließen wir es.
Wir waren am ‚rechten Seiteneingang, wenn man vor dem westlichen der beiden Hauptausgänge steht‘, verabredet, was Dorothee in der Tat drei Schritte sparte und für mich kein Umweg war. Diese Ökonomie ist erstaunlich an ihr, denn mit Dorothee unterwegs zu sein, heißt, für alles zu büßen, was man jemals Gehbehinderten angetan hat. Auch wer von mir mit Häuserzeilen oder Straßenschildern gequält worden ist, findet in ihr seinen Racheengel. Mein linker Fuß hatte sich nach dem Tanz-Abenteuer auf der Festlichkeit meines Onkels ganz erheblich verschlechtert. Donnerstag hatte ich wieder gehinkt und geflucht, dass ich nicht sitzen geblieben war wie der nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmte Herr mir schräg gegenüber. Trotzdem will man ja nicht vor einer Zweiundachtzigjährigen schlappmachen, wenn man schon nicht mit Anna ums Regierungsviertel joggt.
Also: Friedrichstraße, über die Weidendammbrücke mit dem gusseisernen preußischen Adler; hinten links hockt, fast verschüchtert, Bert Brecht in seinem Pärkchen vor seinem Theater. Ein paar Hundert Meter weiter, auch auf der linken Seite (ich hab’s gelernt!): sein Grab; aber wir biegen vorher rechts in die Oranienburger Straße ab, doch schon vor dem Tacheles, der chaotisch geflickten Ruine des alten Prunk-Kaufhauses, gingen wir nach links, in die Auguststraße.
Dorothee betrachtet jedes Haus wie ein Juwelenhändler Diamanten. Wenn etwas so vollkommen sich selbst und seinen achtlosen Bewohnern überlassen geblieben ist, dass es an seiner Echtheit fast zusammenbricht, freut sich Dorothee, und wenn es schnieke herausgeputzt ist, freut sie sich auch. Sogar die kahlen Stellen findet sie stadtgeschichtlich bemerkenswert, und das ungeordnete Nebeneinander von Stillstand, Abriss und Aufbau freut sie am meisten. – City in Progress. Zwischen frisch verputzten Fassaden der runtergekommene Eingang zu ‚Clärchens Ballhaus‘. Wann wurde hier wohl der letzte Walzer getanzt?
Ein Stück der Straße ist abgesperrt. Die Wagen stauen sich. Die Leute gaffen. Die Polizisten langweilen sich, weil es nichts zu regeln gibt. Aus einem Hoftor kommen, eine nach der anderen, junge, überwiegend weibliche Personen, skurril bekleidet: eine Modenschau. Die meisten schlurfen wie bei einer Demo und sehen missmutig an den nicht klatschenden Passanten vorbei, einige wiegen sich selbstsicher im Mannequin-Schritt, was zwischen den Behelfsmodels auf dem Straßenlaufsteg furchtbar affig wirkt. Sie ziehen vorbei wie ein Karnevalszug am Aschermittwoch.
„Siehst du“, sagt Dorothee, „hier ist immer etwas los. Alles spielt sich im Osten ab.“
Dann kommen wir durch das offene Tor im Haus in den Innenhof. Menschen, viele junge, sitzen bei Kaffee, Bier oder – neiderregend – Wein. Zwei Nussbäume schaffen Idylle. Am anderen Ende des Innenhofs führt die Tür zur Ausstellung. Dorothee kauft beschriebenes Papier und stellt Fragen. Die Blonde informiert lustlos.
Wir müssen die Treppe runter, aber ich würde nicht sagen, in den Keller, denn der Raum hat keine Decke; nach oben hin, und auch sonst ist alles offen. Sechzehn Bilder: vier pro Seite, alle sehr raumgreifend. Vergrößerungen von Zinnfiguren in künstlicher Landschaft. Spielzeug – riesig, KZ und Krieg. Die Zinnsoldaten sind verstümmelt, Eingeweide und Blut. Ein SS-Offizier aus Zinn kniet vor einem Lagerinsassen, gestreifte Kleidung aus Zinn, und bläst ihm einen. Orale Befriedigung für den Aufseher, visuelle für den kunstsinnigen Betrachter.
„Schrecklich,“, sagt Dorothee, „aber der Raum ist schön, nicht? Ganz fabelhaft!“
Zu ebener Erde treffen wir eine Freundin mit Freund. „Habt ihr das gesehen?“, fragt Dorothee.
„Jaja“, sagt die Freundin, „aber wir kommen aus der Foto-Ausstellung im Paket-Amt, dagegen ist das hier gar nichts.“
„Da wollt’ ich auch immer hin“, Dorothee vibriert, „wie lange ist da geöffnet?“
„Bis elf.“
„Da können wir anschließend noch hingehen“, feuert Dorothee mich an.
Wir gehen in den ersten Stock. Mein Fuß tut weh. Bilder, Bilder, Bilder. Und eine Plastik. Aus Plastik. Eine Selbstdarstellung des Künstlers, wie das Schildchen besagt. Ein zerfetzter Körper, der Rippenbogen entfleischt, auch der Kopf zerschmettert mit rausquellendem Hirn; ein Bein bis auf einzelne Fetzen nur Knochen. Alles Plastik in einer Blutlache, auch aus Plastik. Ich zwinge mich, den Anblick zu ertragen. Schwer.
„Sieh mal!“, sagt Dorothee. Sie steht am Fenster. Unter den Nussbäumen sieht man Köpfe und Bänke. Tische mit Gläsern und Tassen. „Das ist alles neu gemacht. Hier war nichts.“
Ich nicke. Frische rote Dächer, Ziegel, Schindeln. Dahinter die Silhouette von Bürgerhäusern, Plattenbauten, Kirchturm. Dahinter die Skyline von Kuppeln, Hochhäusern, Werbung. Wahrzeichen und Zeichen der Verlogenheit. Noch dahinter der frische Abend, der im Juli wie ein gut erhaltener Nachmittag aussieht.
„Ja, schön“, sagte ich. „Hast du die Plastik gesehen?“ „Das interessiert mich nicht; ich weiß nicht, was das soll. Gehen wir noch ins oberste Stockwerk?“
Ja, das taten wir. Und wir gingen durch die Sophienstraße, sicher auch einer preußischen Prinzessin gewidmet. Die liebevoll restaurierten Wände strotzten vor Graffiti: Im Flanieren dachte ich mir Strafmaßnahmen aus: Die Mauern werden mit den Stirnen der Sprayer blank gescheuert. Die Übeltäter werden gezwungen, sich gegenseitig die Hände abzukauen. Der Langsamere wird von Füßen in leichten, schwarzen Slippern zertrampelt. Sie müssen die Zeichen und Schriftzüge mit den Zähnen aus den Wänden beißen und runterschlucken, bis alles blitzsauber ist. Ein Schmuckstück könnte dieses Viertel sein, wenn man nur genügend Fantasie hätte, die nötigen Maßnahmen zu legalisieren.
„Hier gibt es die besten Bagels“, sagte Dorothee. Das hatte der ‚Barbar in Berlin‘ auch herausgefunden. Ich konnte die Kringel schon in New York nicht leiden. Hier finde ich sie total daneben.
Ein paar Häuser weiter kann man in einem Schlafsaal für eine Stunde ein Bett mieten. Wenn ich mich nicht irre, gilt das Projekt als Kunstwerk. – Irre; gegenüber Donaueschingen und Eingeweiden aus Zinn oder Plastik natürlich arg meditativ. Das, was unsere Kunstszene überhaupt nicht gebrauchen kann, ist der Rückzug in die Innerlichkeit. – Narzisstisch. Dagegen ist die Aussage, dass es keine Aussage mehr geben kann, diskussionsfähig. Was kann es, was darf es noch geben, nach Auschwitz? Wo Kunst immer noch versucht, Kunst zu sein, führt sie sich selbst ad absurdum. Nur da, wo sie sich denunziert, ist sie noch sie selbst. Die Foto-Ausstellung im Paket-Amt ließen wir rechts liegen. Ich hatte erfolgreich auf Dorothees Vergesslichkeit spekuliert.
Wir tranken nichts in den Hackeschen Höfen, nichts unter den Arkaden der S-Bahn. Dorothee wollte draußen sitzen; mir war alles egal, weil ich Wasser trinken würde, wozu ich keine Lust hatte. Wir schlenderten zu den Linden hin.
„Furchtbar, dieser Klotz!“, kommentierte ich das Hotel ‚Unter den Linden‘.
„Da hab’ ich oft gewohnt“, sagte Dorothee. „Wenn Pollini gespielt hat. Auch mit Henze.“
Ich schlug vor, dann sollten wir uns doch dort hinsetzen, aber so gut gefiel es Dorothee auch wieder nicht.
Den anderen Restaurationsbetrieben ging es nicht besser. Mal musste man eine regelrechte Mahlzeit einnehmen. Mal wurde neben dem einzig freien Tisch geraucht. Mal war es zu abgeschieden, mal zu hektisch. Und nach jeder Pleite sagte Dorothee drohend: „Ich fahr’ jetzt nach Hause.“ So landeten wir schließlich in der Halle des Grandhotels. Ein weiter Weg vom Zinngedärm jenseits der Spree. Einmal, 1991, hatte ich da auch übernachtet und schon 1984 hatte ich Bernstein dort abgeholt. Angeekelt hatte ich mir in einer Hotelbar, die das war, was sich Margot Honecker unter Eleganz vorstellen mochte, einen Martini-Cocktail bestellt und lauwarmen Cinzano Bianco bekommen. Bernsteins Manager Harry Kraut, der Whisky trank, lachte schadenfroh. Inzwischen war das Dekor geändert. Dorothee bekam Tee auf einem Stövchen mit Kerze und ich mildes Wasser. Am Nebentisch aßen zwei Mädchen, etwa acht und zehn Jahre alt, sperrige Club-Sandwiches. „Entzückend“, sagte Dorothee. Die Mädchen spülten die Toastbrocken mit Cola weg. Die Ältere orderte auf Englisch die Rechnung. Die Jüngere ging zum Pianisten und sagte etwas zu ihm. Er beendete seinen Lauf und ließ sie auf den Schemel. Sie begann, durch ‚Für Elise‘ durchzustolpern. Nachdem sie sich bis zum Schlussakkord durchgeholpert hatte, klatschten die Damen und Herren Beifall, der Pianist auch – sehr tapfer! Er setzte seinen Vortrag mit einer spielerischen Variation von ‚Elise‘ fort und leitete über in ein swingendes Medley klassischer Themen. Einfach gekonnt! Kein Mensch beachtete ihn. Aber die Kleine war so süß gewesen. Hoffentlich wird sie später solche Arthritis in den Händen kriegen, dass sie gefüttert werden muss.
Dorothee stieg an der ‚Französischen Straße‘ in die U-Bahn, ich ging ins Bett. Samstag Nacht in der Hauptstadt. Im Fernsehen lief der zweite Teil einer vierteiligen Serie über Aufstieg und Fall einer Industriellen-Familie im Dritten Reich. Danach begnügte ich mich mit wenigen Telefonsex-Angeboten. Träume sind süßer.
Who is who (Akkordeon)
1 – Irma Schack
[ˈɪʁma] [ʃak]
Eine resche Frau, ausgebildete Schauspielerin, also bestens geeignet, den Betriebsrat bei der ‚Deutschen Grammophon’ zu leiten. Auf den Betriebsversammlungen führte sie den Präsidenten vor, nach beider Pensionierung führte er sie in sein Schlafzimmer. Seither lebten sie zusammen.

Titelbild mit Material von Clärchens Ballhaus/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

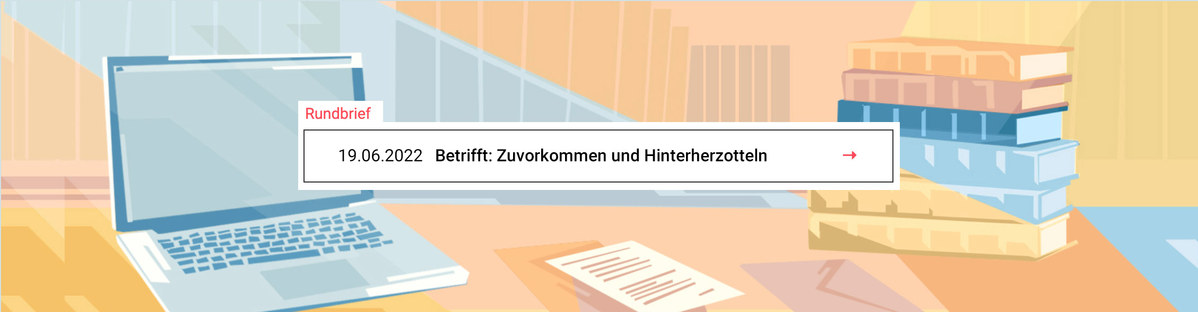







































































Den Ostzoo kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber sind Zoos mittlerweile nicht eh irgendwie non-pc!?
Mit political correctness hat das glaube ich wenig zu tun. Man sperrt Tiere halt nicht mehr so gerne grundlos ein.
Man tut immer weniger, was anderen Menschen, Tieren, Pflanzen schadet. Es sei denn, es ist gerade Krieg.
Wie wahr. Momentan wirbt ja selbst Habeck dafür, die Kohlekraftwerke weiterlaufen zu lassen.
In der Not frisst der Teufel Fliegen. Da sind Kohlen eine schluckbare Kröte.
Oh der Darm aus Zinn klingt schon im Titel schmerzhaft. Nee Danke.
Wer viel trinkt braucht am ehesten einen Darm aus Stahl. Gesund ist auch das nicht.
Ein Soldat aus Zinn existiert sehr gut mit einem Darm aus Zinn. Zinn 40 ist ein Weinbrandt, den man unbedenklich im Zinn-Flachmann aufbewahren kann, während ich bezeifle, dass es den Darm-Bakterien im Stahlbett sehr gemütlich wäre.
In Clärchens Ballhaus wird doch sogar immer noch jede Woche Walzer getanzt. Auch wenn man es dem Gebäude vielleicht nicht so richtig ansieht.
Das ist der viel beschwörte Berliner Charme. Runtergekommene Gebäude…
Aber bei Clärchen ist wirklich immer wahnsinnig viel los.
Ein Publikum 60+ oder hipper?
Die sind meiner Erfahrung nach sogar deutlich hipper.
Haben die nicht schon wieder einen neuen Investor? Ich erinnere mich, dass da vor nicht allzu langer Zeit mal etwas in den Zeitungen stand. Ob das Ballhaus so wie es ist bestehen bleiben soll, weiss ich aber auch nicht.
Die Berlin Cuisine Jensen GmbH ist jetzt ‚Clärchen‘.
Das klingt eher nach Großunternehmen als nach Lokalkolorit. Mal schauen was das für diesen Ort und seine Zukunft bedeutet.
Darum heißt es jetzt auch nur noch ‚Clärchens‘, um einen hippen sächsischen Genitiv vorzutäuschen.
Ich bin ja wahnsinnig gespannt was nun mit dem alten Tacheles passiert. Immerhin tut sich etwas. Ob es die ganzen Luxuswohnungen braucht, naja, aber dass das Fotografiska dort einen Ausstellungsort bekommen soll, finde ich schon einmal vielversprechend.
Nächstes Jahr soll es fertig sein. Aber zurzeit kann man ja keinem Bauprojekt trauen.
Wenn es genauso läuft wie mit dem BER … aber ich habe schon das Gefühl, dass das besser laufen wird. Der Fakt, dass die Stadt nicht involviert ist, macht Hoffnung 😉
Königin Sophie Luise. Ja genau.
Hochzeit am 28. November 1708 im Humboldt-Forum, äääh, Berliner Schloss.
Die Hochzeit war aber nicht damals schon von Paul Spies organisiert? 😉
After-Party im Soho-House. Die Sophienstraße ist übrigens recht hübsch. Mitten in Mitte und trotzdem so ruhig.
Ich glaube ich habe noch nie etwas interessantes im KW in Berlin gesehen. Das wirkt zwar alles immer wahnsinnig zeitgenössisches, aber auch unglaublich bemüht und angestrengt.